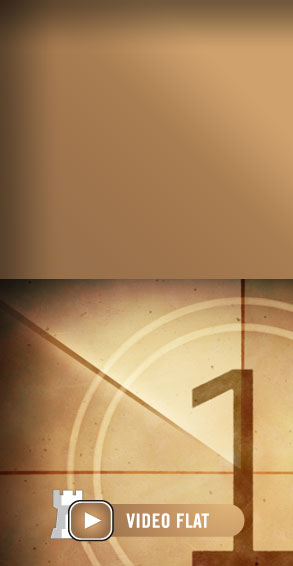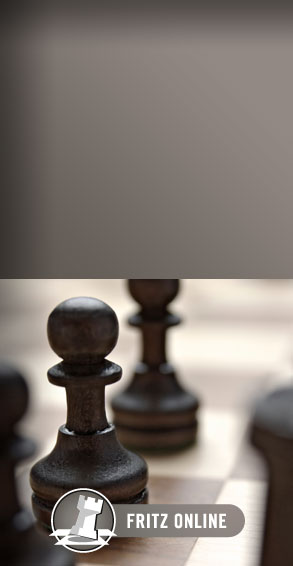Rezension von Christian Hesse
S/Madness - Von Schönheit und Schrecken des Schachspiels und der Kennung ISBN 978-3-85164-212-4 erblickte das Licht der Druckerschwärze in der Druckerei Gerin Druck des österreichischen Album Verlages. Geburtstermin war der 22.Mai 2022. Mit einem Volumen von 24 cm x 15 cm x 4 cm und einem Geburtsgewicht von 1100 g bei 608 Seiten Innenleben ist es schon äußerlich eine stattliche Erscheinung, die Sie für 36 Euro Ihr Eigen nennen können.
Das sind einige der Daten, die man bei auf die Welt gekommenen Geschöpfen mitteilen kann. Für den Schöpfungsakt zeichnen Michael Ehn und Ernst Strouhal verantwortlich. Sie haben aus einer Vielzahl ihrer Beiträge für Zeitungen, Magazine, Zeitschriften und insbesondere ihrer inzwischen Kult-Status besitzenden Kolumne in der Tageszeitung Der Standard 180 Stücke ausgewählt und zu diesem Buch verwoben.
Nach dieser Kollektion des Faktischen kommen wir nun zu den Einschätzungen des Rezensenten, also zu meinen ganz persönlichen Eindrücken nach längerer Lektüre.
Um das Gesamturteil gleich vorweg zu nehmen: Bei dem genannten Werk, das aus Einzelstücken besteht, handelt es sich dennoch um ein Gesamt-Kunstwerk, das ohne Übertreibung als eines der besten Schachbücher des bisherigen 21. Jahrhunderts bezeichnet werden kann.
Die in ihm versammelten und unabhängig voneinander lesbaren Proben sind allesamt schach-literarische Filetstücke. Stück für Stück sind es Happy-Hour-Häppchen für genussvolle und lehrreiche, tiefgründige und scharfsinnige und stets unterhaltsame Lektüren, zum Genießen vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen, am Wochenende oder wann immer Ihnen danach ist.
Die Beiträge sind in acht große Abschnitte gegliedert. Insgesamt decken sie ein breites Spektrum von Themenbereichen ab: biographische Details bekannter und auch weniger bekannter Schachpersönlichkeiten, philosophische Gedankensplitter, die das größere ganze eines klugen Gedankengebäudes bilden, Highlights der Spiel- und Kompositions-Kunst, illustre Infotainments aus dem kulturellen Schachleben, sowie auch Auslotungen der Abgründe des Königlichen Spiels, welche die Betroffenen mit noch so viel Philosophie nicht aufzufüllen vermochten, sondern vielmehr unter die Räder des Schicksals gerieten.
Eine der Abschnittsüberschriften - „Zu schwer, aber nur ein bisschen“ - ist eine Anspielung auf die von Alexej Suetin gegebene Antwort darauf, warum Schach auf viele Menschen eine solch große Faszinationskraft ausübt: „Schach ist zu schwer für uns Menschen, aber nur ein bisschen.“ Diese gelungene Einschätzung eines großen Spielers, Trainers und Schachkommunikators hat es bis auf den hinteren Buchdeckel geschafft.
In jedem der acht großen Abschnitte finden sich Episoden, deren Überschriften sogleich Leselust erzeugen, wie zum Beispiel:
“Django Unchained am Schachbrett – Theophilus Thompson”
““Wenn ich Schach spiele habe ich keine Angst!“- Phiona Mutesi“
“Ein Mann in Turings Team – Codebreaker Hugh O`Donel Alexander”
““Scharfsinn der Verzweiflung” – Samuel Becketts Partien“
„Ein Mann aus Brooklyn – Bobby Fischer in Buenos Aires“
„Kafkas Affe – Imaginäre Partien, ergänzte Wirklichkeiten“
„him hanfang war das wort…“ höfliche Verbeugung vor Ernst Jandl (1925 – 2000)“
„Das Ende der Gemütlichkeit – Arnold Schönbergers Schachmusik“
„Spinoza gegen den Salzstreuer – Mit Wittgenstein spielen“
Diese kleine Auswahl suggeriert bereits, dass es den Autoren darauf ankam bemerkenswerte, nicht-triviale Beziehungen zwischen dem Königlichen Spiel und fast allem anderen herzustellen, einschließlich der Wortkunstwerke Ernst Jandls, der Musik Arnold Schönbergs und der Philosophie Ludwig Wittgensteins.
Das Prinzip der six degrees of separation ist im Buch außer Kraft gesetzt: Schach ist im Durchschnitt über weniger als sechs Ecken mit Allem und Jedem verbunden.
Übrigens: Die erstgenannte obige Episode mit Bezug zu Django Unchained zeigt zudem, dass die Autoren, falls nötig, auch keine Scheu haben, ein klares, kritisches Wort zu sprechen, wie zum Beispiel: „Die Sklaverei, geduldet von der Kirche, betrieben von einem erbarmungslosen Kapitalismus, der Europa unermesslichen Reichtum und weltweite Vorherschafft verschaffte, war eines der größten Verbrechen der Menschheit.“
Jede Episode, die es ins Buch geschafft hat, wird bereichert durch eine Partie, von denen einige recht bekannt und andere – erfreulicherweise – noch wenig oder gar nicht publizierte Fundstücke aus den Tiefen von Schacharchiven sind. Meist sind sie auch für Amateurspieler geringerer Spielstärke verständlich kommentiert, da sie den Partieverlauf aus der Vogelperspektive betrachten und sich nicht in detailliert aufgelösten Verästelungen langer Varianten verlieren.
Eine der außergewöhnlichsten Partiestellungen des Buches stammt aus der Partie Szalanczy gegen Nguyen Thi Mai, die 2009 bei einem Turnier in Budapest gespielt wurde. Nach dem 58. Zug von Weiß 58.a8D waren sechs Damen auf dem Brett.

Schwarz am Zug
Es ist nicht leicht, diese Stellung einzuschätzen. Die Einschätzung und der weitere Partieverlauf mit Kommentaren sind im Buch festgehalten und deshalb soll hier jeder Spoiler vermieden werden.
Zusätzlich zum bisher vermerkten enthält das Werk 16 Seiten mit Schachproblemen und Schachstudien, die von ganz leicht über ganz schön bis ganz schön schwer reichen. Es sind Kreationen eines Genres, das eine Kunstform für sich bildet, deren Premium-Produkte von ihren Komponisten oft jahrelange schöpferische Arbeit erforderte.
Ein besonders schönes Exponat ist die folgende Studie von Richard Reti aus dem Jahr 1923:

Weiß zieht und gewinnt.
Nach kurzer Inspektion scheint es, dass Schwarz mindestens Remis erreichen kann. Um Schwarz in die Knie zu zwingen, benötigt Weiß wohl ein oder zwei Wunder. Das erste Wunder in Form eines Geniestreiches wird sofort gebraucht. Welcher ist es?
Übrigens: Zu allen Problemen und Studien sind im Buch auch die kommentierten Lösungen angegeben.
Zudem gibt es Gelungenes bei nicht unwichtigen Sekundäraspekten, wie zum Beispiel bei der belletristischen Aufbereitung des Erzählten. Die große Sprachkunst der Autoren zeigt sich auf vielen Seiten wie schon gleich zu Beginn mit einem Passus, der die erklärte Absicht der Autoren beschreibt:
„(Es) wird eine Geschichte des Schachspiels erzählt – als eine labyrinthische Geschichte der räumlichen und zeitlichen Passagen, die es im Laufe seiner langen Reisen quer durch alle Kulturen durchlief, und als Geschichte eben jener Gleichzeitigkeit der Affekte, die dieses Spiel auslöst und es so besonders macht.“
Da auch der Autor dieser Rezension seit knapp 50 Jahren das Schachspiel und sein Umfeld zu seinen Interessen zählt und sich seit Jahrzehnten zur Entspannung mit Schachliteratur vieler Arten und Sparten beschäftigt, hat sich naturgemäß auch bei ihm ein gewisser Fundus von Schachgeschichten angesammelt. Bei der Lektüre des Buches ergab sich, dass die beiden Buchautoren und der Rezensent erfreulicherweise eine Überlappung bei den Themen haben, für die sie eine besondere Leidenschaft hegen. Insofern ließe sich durchaus von einer schach-thematischen Seelenverwandtschaft sprechen.
Dennoch habe ich bei der Lektüre von S/Madness viel Neues gelernt. Dazu zählen nicht zuletzt die bereichernden biografischen Details der im Buch auch gewürdigten skurrilen Persönlichkeiten, die jenes Biotop mitbevölkern, welches man die Schachwelt nennt.
Ein berührendes Beispiel ist das des Wiener Taxifahrers, Gewichthebers und Boxers Hermann Bermadinger (1951-2003), der sich in seinen späteren Jahren noch bemühte, Schachgroßmeister zu werden. Woran er allerdings letztlich scheiterte. Ihm wird mit Episode 46 ein Denkmal gesetzt.
Oder betrachten wir das, was über die viel zu früh verstorbene Eva Moser (1982-2019) geschrieben ist: „Sie war zart, (…) sie war freundlich und verletzlich, sie konnte (…) stur sein, sie war blitzgescheit und sie spielte brillant. Sie war nur eine der Personen, nach deren Begegnung man wusste, warum man sich für dieses Spiel und die Menschen, die es spielen, interessiert.“ Kann man es empathischer und bewegender ausdrücken?
Auch die Hommage an den Rätselkönig Samuel Lloyd (1841-1991) sticht hervor. Mit ihm, so schreiben die Autoren, würden sie im Falle ihres Ablebens, gern auf einer Wolke sitzend eine kleine Ewigkeit verbringen. „Denn alles andere wird ja irgendwann langweilig.“
Ein weiteres Stück, das mir besonders gut gefällt, weil ich daran emotional und biographisch anknüpfen kann, betrifft den Funktionär des russischen Schachs, der naturbelassen Alexander Ilyin (1894-1941) hieß. Er war aber nicht nur Funktionär, sondern auch ein starker Spieler. Das zeigt die im Buch enthaltene Partie. Diese spielte er bereits unter dem Namen Alexander Ilyin-Genevsky.
Und das kam so: 1914 nahm besagter Ilyin an einem stark besetzten Turnier in Genf teil. Als er das Turnier gewann, begeisterte ihn das so sehr, dass er fortan seinem eigenen Nachnamen den Namen der Stadt in englischer Version anhängte (Geneva) und sich Ilyin-Genevsky nannte.
Diese recht ungewöhnliche Art einen Turniersieg zu feiern erzählte ich bei den Dortmunder Schachtagen 2008 als ich für eine gewisse Zeit auf Einladung von Dr. Helmut Pfleger sein Gast-Kommentator sein konnte. Ich fügte dann noch hinzu, dass sei etwa so, als wenn Arkadij Naiditsch, der 2005 die Dortmunder Schachtage gewann sich anschließend Arkadij Naiditsch-Dortmundinsky genannt hätte.
Dies löste beim Publikum, das die Partien live und den Kommentar über Kopfhörer verfolgte, ein größeres Gelächter aus, und zwar just in dem Moment als einer der Protagonisten auf der Bühne, Vasyl Ivanchuk, gerade seinen Zug ausgeführt hatte und aufgrund des Gelächters zusammenzuckte und erschrocken zunächst aufs Brett und dann ins Publikum schaute. So weit, so nicht weiter schlimm, könnte man denken.
Doch das Vorkommnis hatte noch ein Nachspiel: Ivanchuk fragte später beim Schiedsrichter, worauf sich das Gelächter des Publikums bezogen habe und dieser nannte meinen Namen als Gast-Kommentator und Verursacher.
Ivanchuk schien sich das gemerkt zu haben. Denn einige Monate später als ich netterweise dafür auserkoren war bei der Dresdner Schacholympiade am Brett von Ivanchuk gegen Aronian den symbolischen ersten Zug zum Start der 4.Runde zu machen und schon am Brett bereitstand, sagte Ivanchuk deutlich hörbar, dass er definitiv nicht wolle, dass ich für ihn mit Weiß den ersten Zug ausführe. Na ja, Kommentatoren-Pech!
Doch es gab noch ein Happy-End: Levon Aronian, der Ivanchuks Worte gehört hatte, sagte (übersetzt): „Sie können gerne den ersten Zug für mich als Schwarzspieler machen.“ Und so ergab es sich, das wohl zum einzigen Mal ein symbolischer erster Zug zur Eröffnung einer Partie mit den schwarzen Steinen ausgeführt wurde.
Um nach diesem persönlichen Einschub nun zum Ende zu kommen: Das Buch von Michael Ehn und Ernst Strouhal erwies sich als gewaltige Fundgrube für manches mir noch nicht Bekannte, bot mir viele Stunden an Leselustbarkeiten, sorgte für mancherlei Berührendes und Einiges, woran ich mit eigenen Erlebnissen anknüpfen konnte. Es ist ein Buch mit so vielen wunderbaren und wundersamen Facetten, dass es mir bei der Lektüre ans Herz gewachsen ist. Eine solche Vielzahl von Geschichten auf solch hohem Qualitäts-Niveau zwischen zwei Buchdeckeln zu vereinen, kompiliert aus einem noch viel größeren eigenen Fundus, ist eine Meisterleistung.
Es ist zudem ein überaus freundliches und quicklebendiges Buch, immer verständnisvoll am Puls der darin auftretenden Personen. Es hebt sich dadurch ab von den trockenen Erzeugnissen all jener selbst ernannter Schachhistoriker, die weder hinreichende Schachfähigkeiten noch eine Minimalausbildung als Historiker besitzen und die man mit einigem Wohlwollen noch als Schachfaktensammler bezeichnen kann, sofern sie auf Invektiven gegen andere Autoren verzichten.
Noch ein Wort zum Einband: Schach als Spiel und als Teil der Kultur hat eine starke visuelle Ausstrahlung auf vielen Ebenen. Dieser Visualität wird im Buch durch zahlreiche Abbildungen Rechnung getragen und durch einen ungewöhnlichen Einband.
Dieser Einband in überwiegend dunkelgrauer Farbe mit entsprechend eher düsterer Anmutung ist dennoch in seiner Schlichtheit betörend innovativ. Das Design des Einbands ist auch insofern mutig, als es einen Kontrapunkt zum glamourösen Inhalt darstellt.
Ja, aber wo bleibt denn das Kritische in dieser Rezension? Das werden sich nun vielleicht einige von ihnen fragen. Da gibt es nur wenig zu berichten: Einzig die Fotos auf den Seiten 1-3 und 608, allesamt sogenannte Film-Stills aus dem Film Chess Fever von 1925 unter der Regie von V. Pudovkin und N. Shpikovsky, sind kritisch zu beurteilen. Ihre Qualität ist nicht wirklich gut. Die Stimmung, die sie erzeugen ist schlecht, Sie sind inhaltlich nahezu nichtssagend und insofern verzichtbar. Sie schmälern aber den Gesamteindruck des Buches nicht im Geringsten.
Es ist und bleibt ein großer Wurf zweier großer Meister des Geschichtenerzählens. Das scheint nicht nur meine Meinung zu sein. Denn dieses Buch gewann 2022 den renommierten Staatspreis in der Kategorie Schönste Bücher Österreichs.

Es ist ein Buch, das nur Michael Ehn und Ernst Strouhal schreiben konnten.

S/Madness, 608 Seiten, 36 Euro
Über die Autoren:
 Michael Ehn, Jahrgang 1960, ist Soziologe und verfasste an der Universität Wien eine soziologisch-historische Diplomarbeit über die Lebensgeschichte von sozialen Devianten. Er ist Autor von mehr als einem Dutzend Bücher zur Schachgeschichte, die ihn aufgrund ihrer Präzision, Erkundungsvielfalt und ausgewogenen Sachlichkeit zu einem der renommiertesten Schachhistoriker machen. Zusätzlich arbeitet er als Buchhändler.
Michael Ehn, Jahrgang 1960, ist Soziologe und verfasste an der Universität Wien eine soziologisch-historische Diplomarbeit über die Lebensgeschichte von sozialen Devianten. Er ist Autor von mehr als einem Dutzend Bücher zur Schachgeschichte, die ihn aufgrund ihrer Präzision, Erkundungsvielfalt und ausgewogenen Sachlichkeit zu einem der renommiertesten Schachhistoriker machen. Zusätzlich arbeitet er als Buchhändler.
 Ernst Strouhal, Jahrgang 1957, ist Professor an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und Autor zahlreicher Bücher (von denen einige herausragende Preise gewannen) sowie Kurator mehrerer Ausstellungen zum Thema Kulturgeschichte des Spiels. 2024 wurde er mit der Goldenen Ehrennadel für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.
Ernst Strouhal, Jahrgang 1957, ist Professor an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und Autor zahlreicher Bücher (von denen einige herausragende Preise gewannen) sowie Kurator mehrerer Ausstellungen zum Thema Kulturgeschichte des Spiels. 2024 wurde er mit der Goldenen Ehrennadel für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.
Die beiden Autoren bilden seit mehr als drei Jahrzehnten ein Dream-Team, das rund 1500 essayistische Beiträge zur Kultur und Geschichte des Schachspiels veröffentlicht hat.
Über den Rezensenten:

Christian Hesse, Jahrgang 1960, ist Professor für Mathematik an der Universität Stuttgart, zudem Adjunct Professor an der Hertie School of Governance in Berlin,
sowie seit Januar 2024 Gast-Professor an der UCLA in Los Angeles. Mit Frederic Friedel verfasste er das Buch Schachgeschichten. Geniale Spieler - Faszinierende Probleme, für das Garri Kasparow ein Vorwort schrieb.