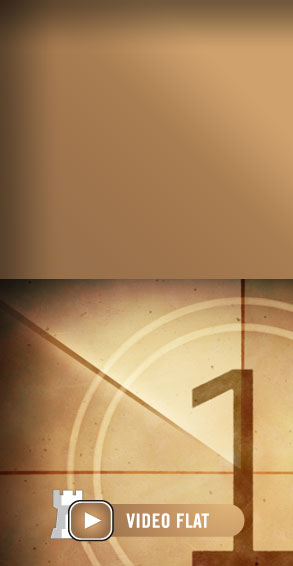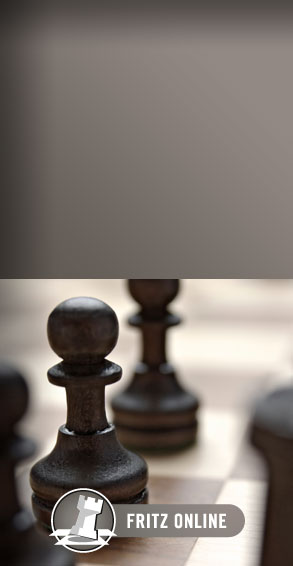Auf der Suche nach der Wahrheit
Von André Schulz

Am linken Rand, in Brissago, wird die WM gespielt, rechts, oberhalb von Ascona
am Monte Veritá wohnen die Spieler. In der Mitte liegen die Brissago Inseln,
auch Inseln der Seligen genannt.

 Henri Oedekoven, Sohn eines sehr reichen Antwerpener Großindustriellen, war
Anfang Zwanzig und schwer krank. Jahrelang rang er mit dem Tode, bevor ein
Leipziger Naturheilkundler ihn schließlich heilen konnte. In den Jahren seines
Leidens hatte er sich Gedanken über sein bisheriges Leben als verwöhnter Dandy
gemacht und sich radikal neu orientiert. Aus dem genussfreudigen Jüngling wurde
ein nachdenklicher Mann, der sein ganzes Leben neu ausrichten wollte. Er strebte
nach einem gesunden Leben im Einklang mit der Natur, wurde zunächst Vegetarier,
schließlich wollte er sich überhaupt nur noch mit Früchten ernähren. Bei einem Besuch in
der Naturheilanstalt Rikli in Veldes (Österreich) hatte der 24-Jährige die
wesensverwandte, 11 Jahre ältere Ida Hofmann kennen gelernt. Zusammen
beschlossen sie, ein Leben jenseits von bürgerlichem Schein, Luxus, Egoismus, Lüge
und Heuchelei zu führen. Schließlich kamen sie auf den Gedanken, in einer
Kolonie abseits der Zentren der Zivilisation die neue Lebensphilosophie zu
verwirklichen.
Henri Oedekoven, Sohn eines sehr reichen Antwerpener Großindustriellen, war
Anfang Zwanzig und schwer krank. Jahrelang rang er mit dem Tode, bevor ein
Leipziger Naturheilkundler ihn schließlich heilen konnte. In den Jahren seines
Leidens hatte er sich Gedanken über sein bisheriges Leben als verwöhnter Dandy
gemacht und sich radikal neu orientiert. Aus dem genussfreudigen Jüngling wurde
ein nachdenklicher Mann, der sein ganzes Leben neu ausrichten wollte. Er strebte
nach einem gesunden Leben im Einklang mit der Natur, wurde zunächst Vegetarier,
schließlich wollte er sich überhaupt nur noch mit Früchten ernähren. Bei einem Besuch in
der Naturheilanstalt Rikli in Veldes (Österreich) hatte der 24-Jährige die
wesensverwandte, 11 Jahre ältere Ida Hofmann kennen gelernt. Zusammen
beschlossen sie, ein Leben jenseits von bürgerlichem Schein, Luxus, Egoismus, Lüge
und Heuchelei zu führen. Schließlich kamen sie auf den Gedanken, in einer
Kolonie abseits der Zentren der Zivilisation die neue Lebensphilosophie zu
verwirklichen.
Im Oktober 1900 versammelten sich insgesamt sieben Gleichgesinnte
im Haus von Ida Hoffmanns Verwandten in München und diskutierte über die zu
gründende Lebensgemeinschaft, unter welchen Bedingungen sie eingegangen werden
könne und wer überhaupt dazu gehören solle. Schließlich wurden der ungarische
Oberleutnant Karl Gräser, von vielen anarchistischen Idealen durchflutet, die
hübsche, aber etwas überspannte Bürgermeistertochter Lotte Hattemer, Ida
Hoffmanns Schwester Jenny, im Gegensatz zur Schwester eher nüchtern und
sachlich, und Ida Hoffmann und Henri Oedenkoven selbst für geeignet befunden,
den Aufbruch ins Paradies abseits des bürgerlichen Lebens zu wagen. Karl Gräsers
jüngerer Bruder Gustav drängte sich selber auf und kam einfach mit.
Als Ort der Kolonie war zunächst Lenno am Comer See vorgesehen. Die Gruppe warf
ihre bürgerliche Kleidung fort, hüllte sich in luftige Gewänder und machte sich
zu Fuß auf den Weg durch die Alpen. Die ließen sich Bärte wachsen und auch ihr
Haupthaar wurde immer länger, so dass es auf dem Weg in den Süden zu mancher
Verwechslung kam, wenn einige Dorfburschen den Tunika behängten Gustav Gräser
mit dem Heiland verwechselten.
Am Comer See angekommen fand sich jedoch kein geeignetes
Grundstück. Die Kolonisten erforschten die nähere und weiter Umgebung und fanden
sich schließlich vom Dorf Ascona und den vorgelagerten Brissagoinseln magisch
angezogen. Die Inseln waren einst Stätte einer Klostergemeinschaft gewesen,
deren Mitglieder der Botschaft der christlichen Nächstenliebe zu direkt gefolgt
waren, so dass sogar der Papst eingeschritten war, um die Ausschweifungen zu
beenden. Nun hatte eine russische Gräfin sich hier niedergelassen und
verwandelte die Inseln durch zahlreiche Anpflanzungen in ein kleines Paradies.
In den Orten am Lago Maggiore und den Tälern in der Nähe hatten sich bereits
einige Alternative nieder gelassen: Vegetarier, politische Freidenker und
Sonnenanbeter.
Bei Ascona fand Oedekoven schließlich einen kleinen Berg, dessen felsiger Grund
für Ackerbau nicht geeignet war und kaufte hier Land an. Die Gruppe nannte den
Berg nun Monte Veritá und das wurde auch der Name ihrer Kolonie.
Bald nach der Gründung gab es Streit zwischen Henri Oedenkoven und Gustav
Gräser. Gräser musste gehen. Statt seiner stieß der ungarische Militärarzt
Albert Skarvan, der sich im Tessin als Flüchtling aufhielt, hinzu. Mit ihrer
eigener Hände Arbeit begannen die fünf Kolonisten Bäume zu roden, Häuser zu
bauen und den Berg bewohnbar zu machen. Bald mussten sie jedoch Hilfe von
Handwerkern aus der Umgebung anzufordern. Auch dann ging die Arbeit nur zäh
voran. Als besonders störend erwies sich die rasche Popularität des
Unternehmens. Über verschiedene Insiderzirkel für alternative Lebensformen,
Vegetarismus, Gleichberechtigung der Frau verbreitete sich die Kunde vom neuen
Modell rasch und zog allerlei Leute an, die vor allem gerne über ihre
Weltanschauungen diskutierten und die Kolonisten ansonsten von der Arbeit
abhielten.


Nach einigen Mühen gelang es nach und nach, den öden Hügel
oberhalb Asconas in ein kleines Paradies zu verwandeln. Während Oedenkoven und
Hoffmann immer ihre Idee eines Naturheilsanatorium im Auge behielten,
versammelten sich in der zeitweise genossenschaftlich organisierten Kolonie
zahlreiche Phantasten, Theosophen, radikale Vegetarier, Spiritisten,
Anarchisten, Kommunisten. Zahlreiche Nichtsnutze in weltanschaulicher
Verkleidung waren darunter, die auf Kosten anderer ihr Leben zu bestreiten
gewohnt waren, aber auch einige Köpfe, die das europäische Geistesleben später
nachhaltig geprägt haben.


Der Expressionist Werner Ackermann, nach 1923 einer der Besitzer des Berges, hat unter dem Pseudonym Robert Landmann ein
unterhaltsames und detailreiches Buch über den Monte Veritá veröffentlicht, in
dem dessen kurze Geschichte erscheint die kleine Gesellschaft dort wie ein
Mikrokosmos des menschlichen Zusammenlebens. In durchaus ironisch-distanzierten
Notizen werden viele Personen noch einmal kurz lebendig, die in dieser Zeit, zu
Anfang des letzten Jahrhunderts, an diesem Ort eine Rolle gespielt haben und in
einer Zeit großer Umgestaltungen der Lebensbedingungen für viele Menschen im
Zuge der zunehmenden Industrialisierung entwurzelt wirken.


Unter denen, die sich von den Ideen des Monte Veritá angezogen fühlten und die
Kolonie besuchten, waren Namen wie Hermann Hesse, Erich Maria Remarque, Hugo
Ball, Else Lasker-Schüler, Stephan George, Isidora Duncan, Carl Eugen Keel, Paul
Klee, Rudolf Steiner, Mary Wigman, Max Piccard, Ernst Toller, Henri van de Velde,
Fanny von Reventlow, Frieda und Else von Richthofen, Otto Gross, Erich Mühsam
und Gustav Stresemann.

Ich liebte nicht die Totenkopfhusaren,
Und nicht die Mörser mit den Mädchennamen,
Und als am End die grossen Tage kamen,
Da bin ich unauffällig weggefahren.
Hugo Ball |
Hugo Ball und die aus Flensburg stammende mit ihm verheiratete Emmy Hennings
traten später im von Ball, Hülsenbeck und Arp 1926 gegründeten Dada-Theater "Cabaret
Voltaire" in der Züricher Spiegelgasse 1 auf und standen mit ihren
offensichtlich aufrührerischen Inhalten unter ständiger Beobachtung der Polizei.
Nur wenige Häuser weiter. in der Spiegelgasse 14
wohnte "ein gewisser Herr Uljanow alias Lenin". Der gelehrte Russe erregte bei
den Behörden viel weniger Aufmerksamkeit als die chaotischen Künstler vorne im
Eckhaus. Mit seinen kommunistischen Freunden spielte Lenin gerne Schach, eine
harmlose Leidenschaft, die nicht ahnen lässt, dass er später, nachdem er mit
deutsche Hilfe nach Russland gelangt ist, dort die Macht übernehmen und zusammen
mit seinen Nachfolgern und anderen Parteifreunden daran gehen wird, Russland
ohne Rücksicht auf Menschenleben radikal umzugestalten und Europa und die Welt in einen
folgenreichen ideologischen Konflikt zu stürzen, der auch heute noch nicht ganz
überwunden ist.

Gorki, Bogdanow, Lenin (Capri 1908)
Unter den russischen Exilanten und Schachfreunden Lenins
befindet sich auch jener Nikolai Krylenko, später Justizkommissar der
UdSSR, der als Chef des Schachverbandes der UdSSR für den Schachboom in der
Sowjetunion sorgen wird. Von ihm stammte der Spruch: "Es genügt nicht die
Schuldigen zu erschießen, erst wenn man ein paar Unschuldige liquidiert, sind
die Leute beeindruckt." In den Tagen des Terrors ließ Stalin ihn hinrichten.
Unschuldig war er nicht, aber wahrscheinlich auch nicht dessen schuldig, dessen
er beschuldigt wurde.
Die Dada-Idee wurde von den Surrealisten aufgenommen und wirkte noch weit in die
heutige Zeit hinein, z.B. in der New Wave- Bewegung der Popomusik der Achtziger
Jahre des letzten Jahrhunderts. Eine bekannte Gruppe nannte sich ebenfalls "Cabaret
Voltaire".
An die Scheiben schlägt der Regen
An die Scheiben schlägt der Regen.
Eine Blume leuchtet rot.
Kühle Luft weht mir entgegen.
Wach ich, oder bin ich tot?
Eine Welt liegt weit, ganz weit,
Eine Uhr schlägt langsam vier.
Und ich weiß von keiner Zeit,
In die Arme fall ich dir ...
Emmy Hennings
|
 Die Schriftstellerin und
Darstellerin Emmy Hennings (li.) war eine ganz besonders illustre Persönlichkeit. Ihre
sinnesfrohe Lebensauffassung ließ sie u.a zur Geliebten von Hans Arp,
Johannes R. Becher, Erich Mühsam oder auch Hermann Hesse werden.
Die Schriftstellerin und
Darstellerin Emmy Hennings (li.) war eine ganz besonders illustre Persönlichkeit. Ihre
sinnesfrohe Lebensauffassung ließ sie u.a zur Geliebten von Hans Arp,
Johannes R. Becher, Erich Mühsam oder auch Hermann Hesse werden.
Erich Mühsam nennt sie ein "erotisches Genie": ´"Das arme Mädchen kriegt viel zu
wenig Schlaf. Alle wollen mit ihr schlafen, und da sie sehr gefällig ist, kommt
sie nie zur Ruhe." Ferdinand Hardekopf,
Reichstagsstenograf und Journalist, große Liebe und Zuhälter der Hennings, hatte
Mühsam diese zur Übernahme angeboten, als ihm die Behandlungskosten ihrer
Typhuserkrankung zuviel wurden. Doch Mühsam lehnte ab.
Emmy Hemmings war
Tingel-Tangel-Mädchen, Dichterin, Prostituierte, Drogensüchtige und überzeugte
Katholikin. Nach 1910 trat sie im Berliner Café Größenwahn auf. Ihre literarische Begabung erregt den Neid und die
andauernde Feindschaft von Else Lasker-Schüler. Sie lernte u.a den
Expressionisten Georg Heym kennen, der 1912 beim Eislaufen auf dem Wannsee
ertrinkt. Der spätere DDR-Kultusminister Becher, mit dem zusammen sie die
Drogensucht nach Äther und Morphium teilt, verfällt ihr völlig.
 1914 wird Hennings wegen Beischlafdiebstahls verhaftet, Mühsam besucht sie und
besorgt ihr einen Anwalt. Als Mühsam selbst 1933 von den Nazis in Berlin verhaftet
wird, lebt seine frühere Liebe im Tessin und versucht von dort aus, mit allen
Kräften seine Freilassung zu
erreichen. 1934 reist sie nach Berlin, um Mühsam im KZ Oranienburg zu besuchen.
Es ist nicht bekannt, ob sie ihn noch einmal gesehen hat.
Erich Mühsam wird drei Wochen später von KZ-Schergen zu Tode geprügelt, weil er sich weigerte das
Horst-Wessel-Lied zu singen. Emmy Hennings starb 1948 im Tessin an den Folgen
einer Lungenentzündung.
1914 wird Hennings wegen Beischlafdiebstahls verhaftet, Mühsam besucht sie und
besorgt ihr einen Anwalt. Als Mühsam selbst 1933 von den Nazis in Berlin verhaftet
wird, lebt seine frühere Liebe im Tessin und versucht von dort aus, mit allen
Kräften seine Freilassung zu
erreichen. 1934 reist sie nach Berlin, um Mühsam im KZ Oranienburg zu besuchen.
Es ist nicht bekannt, ob sie ihn noch einmal gesehen hat.
Erich Mühsam wird drei Wochen später von KZ-Schergen zu Tode geprügelt, weil er sich weigerte das
Horst-Wessel-Lied zu singen. Emmy Hennings starb 1948 im Tessin an den Folgen
einer Lungenentzündung.
Oedenkoven und Hoffmann realisierten ihren Traum vom selbst geschaffenen
Paradies vor allem mit den Mitteln des eigenen Vermögens. Wo das nicht reichte,
half Oedenkovens Mutter aus. Große Pläne wurden geschmiedet. Das ganze
Maggia-Tal sollte in eine genossenschaftlich organisierte Vegetarierkolonie
verwandelt werden. Die Kolonisten und die Gäste des Sanatoriums ernährten sich
vor allem von Körnern und destillierten Früchten. Wollkleidung war ebenso
verpönt wie Milch und Milchprodukte. Einzig Sandalen aus Leder waren in
Ermangelung einer Alternative zugelassen. In der Kolonie bewegte man sich gerne
nackt, was zahlreiche Neugierige anzog und von einer Reederei am Lago Maggiore
mit Ausflugsschiffen nach Ascona zum Geschäft gemacht wurde.
1914 verliebte sich Oedenkoven in eine junge Engländerin, die nichts von freier
Liebe hielt und auf Heirat bestand. Die beiden heirateten und bekamen sogar zwei
Kinder, was Erich Mühsam zwnag, seine These von der Kinderlosigkeit
vegetarischer Verbindungen zu revidieren. Der erste Weltkrieg sorgte jedoch bald für den
Niedergang der Sanatoriumsgeschäfte auf dem Monte Veritá. Theodor Reuß kaufte
sich 1917 ein und gründete die geheimnisvolle Gesellschaft O.T.O, "Ordenstempel
des Ostens, unter deren Deckmantel er seine sexuellen Fantasien mit seinen
Anhängerinnen in den Gärten des Monte Veritás verwirklichte, bis er endlich
wieder rausgeschmissen wurde. Sein "Wirken" hatte die Kolonie stark in Verruf
gebracht. Inzwischen
hatten sich sich auch zuviele Salonanarchisten und andere Selbstdarsteller dort versammelt, die zwar für ein buntes Treiben
sorgten, aber mit den Oedekovenschen Grundgedanken nichts mehr gemein hatte.
Oedekoven verpachtete schließlich den Berg und verließ Ascona zusammen mit seiner Frau
Isabella und seiner Ida Hoffmann schließlich im Jahr 1920. Der Berg verkam zum
Rummelplatz und wurde bald völlig verlassen. Nach einigen Jahren
wechselte der Berg den Besitzer, 1926 wurde er von dem Kunstsammler Eduard
Freiherr von der Heydt gekauft, der dort einen Hotelbetrieb mit
Sanatoriumscharakter etablierte. Heute dienen die Gebäude am Monte Verítá als
Museum und Kongresshotel.

Die Brissago-Inseln
Auf dem Weg vom Monte Veritá nach Brissago kann man auf halber Strecke auf der
Höhe von Ronco einen Blick auf die legendären Brissago-Inseln werfen.


Diese
waren in schon in römischen Zeiten eine Kultstätte und waren zur Zeit der
Christenverfolgungen ein Zufluchtsort für die frühen Christen aus der Umgebung.
Auf der kleineren Insel wurde die erste christliche Kirche der Gegend gebaut.
Später, seit dem 12.Jh. hatte der Orden der Umilati auf den Inseln seinen Sitz.
Papst Pius V. löste in 1574 wegen zu großer Degenerierung und Entfernung von der
christlichen Botschaft auf. Die Inseln blieben unbewohnt, bis sie im Jahr 1885
von der Baronin de St. Léger gekauft wurden.
Waren unter den Besuchern des Monte Veritá schon einige mit bewegenden
Biografien, so wurden diese von der der Geheimnis umwitterten Baronin noch
übertroffen. Man munkelte, dass die in St. Petersburg geborene Frau de St. Léger,
einer Liasion zwischen einer Tänzerin und einem ranghohen Mitglied des
russischen Zarenhofes entstammte. Einige meinten, Zar Alexander II. sei ihr
Vater gewesen. Sie erhielt eine gute Ausbildung und wurde wegen ihrer zarten
Natur in Begleitung einer Gouvernante zur Erholung nach Nepael geschickt und
dort beim deutschen Konsul Jäger untergebracht, den sie bald heiratete. Sie
reiste viel und lernte in Rom u.a Liszt kennen, von dem sie als letzte Schülerin
Klavierunterricht erhielt. Danach begann sie, sich als Kunstsammlerin zu
betätigen. Nach der Scheidung von ihrem Mann reiste sie mit ihrem Sohn umher und
heiratete dann den irischen Diplomaten Baron de St. Lèger. Wegen des angenehmen
Klimas ließ sich das Paar am Lago Maggiore nieder. 1885 kaufte der Baron für
25.000 Franken die Inseln.
Die Baronin begann sofort mit der Umgestaltung der Inseln und ließ unzählige
Pflanzen aus allen Ecken der Welt anpflanzen. Bald war ein blühendes Paradies
entstanden.






Gleichzeitig knüpften sie zahlreiche Kontakte und war in viele
Geschäfte verwickelt, die Haute Volaute der näheren und weiteren Umgebung gab
sich die Klinke in unzähligen Gartenfesten die Hand. Dem eher ruhigen Baron
wurde das bald zuviel, ließ sich nach Nepal versetzen und kehrt nicht wieder.
1923 starb er in Neapel. Aufgrund ihrer vielen nicht immer einträglichen
Geschäfte und ihres aufwändigen Lebenswandel musste die Baronin nach Ende des
Ersten Weltkrieges bald Stück um Stück ihres Besitzes verkaufen. Schließlich
musste sie die Inseln selbst für veräußern. Der Hamburger Warenhausbesitzer Dr.
Emden kaufte sie 1927 für 350.000 Franken. Bis zum vereinbarten Auszugstermin
wusste Antoinetta de St. Léger nicht, wo sie mit ihren zahlreichen Kisten voller
Erinnerungsstücke hin sollte, bis Dr. Emden schließlich gegenüber von den
Brissago Inseln eine alte Mühle mit einigen Gebäuden für sie kaufte. Sie starb
völlig verarmt im Altersheim von Intrinata.
Mit dem Hamburger Kaufmann Max Emden kam ein ganz anderer Lebensstil auf die
Inseln. Das Haus der Baronin und die Reste der alten Kirchen wurde gesprengt,
ein neuer prächtiger Palazzo mit 30 Räumen in luxuriöser Ausstattung gebaut.


Emden, der im Alter von knapp 50 Jahren seine Warenhäuser verkauft hatte und nun
unbegrenzte Mittel zur Verfügung hatte, konzentrierte sich vor allem auf die
Kunst zu leben. Der Park wurde ausgebaut. Er ließ ein 33 Meter großes offenes
römische Bad erreichten, in dessen Mitte ein Schwimmbecken aus Marmor. Der
Hamburger Bildhauer Wrba schuf ein Frauenfigur, die am Bassin aufgestellt wurde.

Der Badeplatz war von einer Mauer umgeben. An einer Ecke wurde eine bogenförmige
Öffnung eingelassen, die durch ein schmiedeeisernes Gitter gesichert war.


Heute...

...damals. Andere Zeiten, andere Sitten.
Am 9.April 1956 stand Konrad Adenauer vor dem Aussichtsfenster und bezeichnete
es als schönsten Aussichtspunkt, den er jemals in Europa gesehen habe.

Neben Golf war Emdens Hobby das
Sammeln von schönen, jungen Frauen. Zahlreiche Mädchen bevölkerten die Insel.
Eines seiner Spiele bestand darin, Münzen in das Schwimmbecken zu werfen und den
nackten Nymphen zuzuschauen, wenn sie danach tauchten. Wenn der Lebemann täglich
mit einem seiner 10 Boote Boot auf dem Lago kreuzte, lagen braun gebrannten
Körper auf dem Deck. Zusammen hatte man viel Spaß am Leben.

Zu den Gästen der
Insel in jener Zeit gehörten u.a. Aga Khan und Erich Maria Remarque. Max Emden
starb 1940 im Alter von 66 Jahren und ist in Ronco begraben. Die Inseln waren
bald wieder verlassen und Geheimnis umwittert. Nach dem Tode Mussolinis hieß es
zeitweise, die Gebeine des Duces seien über die Grenze auf die Brissagoinseln
geschafft worden.
Literatur:
Robert Landmann: Ascona Monte Veritá, Zürich 1973
Andreas Schwab und Claudia Lafranchi (Hrsg.): Sinnsuche und Sonnenbad, Zürich
2001
Guiseppe Mondada: Die Brissago Inseln, Brissago 1975