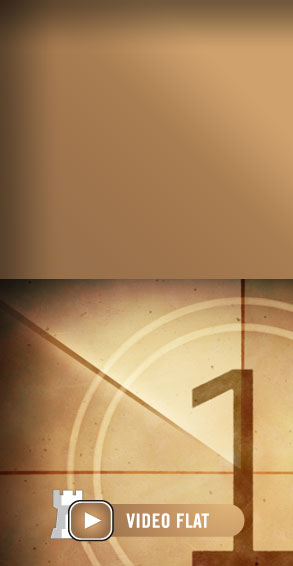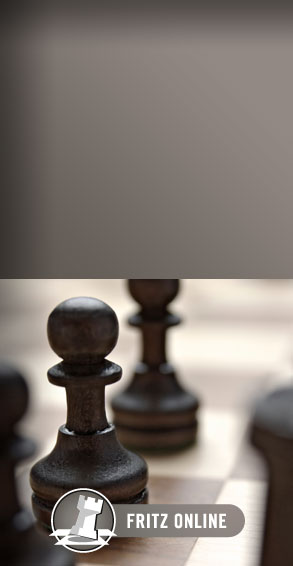DER EGOMANISCHE, ENIGMATISCHE MIMOPHANT
Eine neue Biographie, eine merkwürdige psychologische Studie und nun auch noch
ein Film: das Rätselraten über Bobby Fischer (1943-2008) und seine unberechenbaren
Eskapaden geht weiter
Von Peter Münder
Im chaotischen Kleinkrieg hinter den Kulissen der Schach-WM in Reykjavik 1972,
als Bobby Fischer die Entfernung von TV-Kameras, andere Sessel und Lampen, mehr
Geld sowie ein Verbot des Bonbonverzehrs wegen unerträglicher Knistergeräusche
verlangte und mit einem Turnier-Abbruch drohte, prägte der Bestseller-Autor
Arthur Koestler ("Sonnenfinsternis") - als irritierter Beobachter und Reporter
damals vor Ort - den wunderbaren Terminus "Mimophant": Das war eine mimosenhafte
Kreatur, die gereizt und überempfindlich auf alles reagierte, was sie selbst
betraf, aber gedankenlos und unsensibel mit einer geradezu elefantösen Rücksichtslosigkeit
die persönlichen Belange und Empfindlichkeiten anderer niedertrampelte - womit
er natürlich Bobby Fischer meinte.
Der sensible, kultivierte Boris Spasski war dieser brachialen Powerplay-Mentalität
Fischers ("Ich bin immer im Krieg") nicht gewachsen - jedenfalls war offensichtlich,
dass er mit seiner Nachgiebigkeit gegenüber Fischers zahlreichen Änderungswünschen
auch aus dem mentalen Gleichgewicht geraten war. Vor allem nach dem Umzug aus
der großen Laugardalshöll-Kongreßhalle in das kleine Hinterzimmer, das eigentlich
nur als improvisierter Pausenraum und zum Relaxen an der Tischtennisplatte vorgesehen
war, begann der Abstieg des Russen. Der amerikanische Mimophant, der vor der
WM noch nie gegen Spasski gewonnen hatte, irritierte ihn ja schon vor Beginn
der WM mit immer neuen Forderungen und Bedingungen, hinzu kam noch der Druck
vom russischen Schachverband und den krypto-stalinistischen Funktionären, die
den armen Spasski schon früh aufgefordert hatten, sofort nach Moskau zurückzukehren,
um gegenüber dem unverschämten Yankee das Gesicht zu wahren - was Spasski ja
abgelehnt hatte. Boris Spasski fand Bobby trotz all ihrer Querelen und Dispute
sogar sympathisch: " Er ist ein seltsames Geschöpf im Alltagsleben dieses Jahrhunderts-
ich mag ihn aber und ich glaube, ich verstehe ihn auch".

Diese Details erwähnt Frank Brady in seiner faszinierenden Bobby-Biografie,
die er trotz einer immer noch spürbaren Sympathie für das im Januar 2008 in
Island verstorbene Schachgenie aus einer souverän-distanzierten, objektiven
Perspektive geschrieben hat. Dabei blendet Brady keineswegs aus, wie angewidert
und irritiert er Fischers hämische Haßtiraden gegen die USA nach den Terroranschlägen
vom 11. September und dessen antisemitische Hetzkampagnen- die ja bis zum Leugnen
des Holocaust reichten- zur Kenntnis nahm. In "Endgame" wird der Leser nicht
aus dritter Hand mit obskuren Anekdoten und Gerüchten traktiert, sondern zum
größten Teil mit Eindrücken und Erfahrungen konfrontiert, die der Schachexperte
und ehemalige Fischer-Freund Brady selbst gemacht hat: Brady hat als Turnierleiter
und Schiedsrichter schon den jungen Bobby im Turniersaal erlebt und hunderte
von Partien gegen ihn gespielt. Er hockte mit Fischer zusammen in einem kleinen
Kabuff des Marshall Chess Clubs am Telex, als Bobby die Einreise nach Kuba von
den US-Behörden verwehrt wurde und er alle Partien gegen die in Havanna spielenden
Teilnehmer des Capablanca-Gedächtnisturniers über das Telexgerät mit anschließender
Telefonanalyse abwickelte- ein zermürbender, extrem anstrengender Stresstest.

Cover der Fischer-Biographie von Frank Brady
Und Brady war während der WM 1972 in Reykjavik als Reporter vor Ort, hatte Kontakte
zu Bobby und sogar zu Spasski selbst, während alle anderen Russen ihm mißtrauisch
aus dem Weg gingen und kein einziges Wort mit ihm wechselten. Er erlebte auch,
wie Bobbys Mutter heimlich und unerkannt in Reykjavik erschien, um ihren Wonder-Boy
zum Durchhalten zu motivieren- sie trug damals eine blonde Perücke, was ihren
Inkognito-Auftritt überhaupt erst ermöglichte. Frank Brady, 77, ist Präsident
des Marshall Chess Clubs, war Gründer von Chess Life und ist Autor großer Biografien
über Orson Welles, Onassis und Barbara Streisand; er ist Medien-Professor an
der New Yorker St. Johns University und hatte bereits 1973 eine Kurzbiografie
über den jungen Bobby verfaßt ("Bobby: Profile of a Prodigy"). Da Brady sich
meistens dezent im Hintergrund hält und eine penetrante "Ich-und-Bobby-Pose"
vermeidet, wirkt er besonders überzeugend.

Frank Brady bei Recherchen in Island
Außerdem kann er viele Situationen so lebendig und detailliert beschreiben,
dass wir direkt neben Fischer zu stehen scheinen und ihm sozusagen über die
Schulter blicken. Ob es um Interna und Querelen aus dem Turnierbetrieb geht,
um bisher unbekannte Marotten des Mimophanten, um seine Angst vor KGB-Attentaten,
seine Heiratsannoncen und seinen Wahn, unbedingt einen Sohn als genialen Nachfolger
zu zeugen- Brady erläutert diese Details immer im Kontext der Ereignisse, die
Bobby gerade heimgesucht haben und ihn darin bestätigten, an irgendeine jüdische,
russische oder amtliche US- Verschwörung zu glauben. So kann man viele Aktionen
des unsensiblen Mimophanten nachvollziehen, ohne sie aber richtig begreifen
oder akzeptieren zu können. Seinen abgelaufenen Paß hatte Fischer ja xxx in
der Schweizer US-Botschaft in 40 Minuten problemlos erneuern können, obwohl
damals schon nach dem Rematch gegen Spasski in Sveti Stefan und der Mißachtung
des Boykotts ein amerikanischer Haftbefehl gegen ihn existierte. Als er jedoch
seine Haßtiraden gegen Amerika, sein Jubelgeschrei angesichts der Terrorattacken
vom 11. September ("wunderbare Nachrichten! Die USA müssen ausradiert werden"!)
produzierte, war offensichtlich, dass die US-Regierung den militanten Regierungsgegner
und Sympathisanten islamistischer Terrorgruppen nicht länger mit Samthandschuhen
anfassen wollte. Daher dann die Direktive an die Japaner, ihn auf dem Tokioter
Flughafen festzunehmen.

Fischer wird am Flughafen in Tokio verhaftet.
Das Bild des kauzigen Außenseiters, der eigentlich nur spielen wollte, verändert
sich also: Bobby Fischer trampelte auf den Gefühlen vieler Freunde und Sympathisanten
herum, er verbreitete seine idiotischen, unsäglichen Holocaust-Thesen im Kreise
jüdischer Freunde und wunderte sich dann, als er von der sonst so gastfreundlichen
Familie Polgar, die viele Angehörige in Nazi-KZs verloren hatten, rausgeworfen
wurde.

Fischer spielt gegen eine junge Susan Polgar Chess960
Mit einer unsäglichen Unsensibilität ließ er meistens nur seine eigene Meinung
gelten und verdammte abweichende Ansichten in Grund und Bogen: Als Sofia Polgar
in Budapest an einem von der US-Botschaft gesponserten Simultanturnier teilnahm,
hatte er sie wutschnaubend angepöbelt und wollte ihr das verbieten, was dann
auch das Ende ihrer Beziehung bedeutete. Brady beschreibt den Spagat zwischen
Größenwahn und Depression, zwischen Genie und Illusion sehr einfühlsam und einer
analytischen Schärfe, die "Endgame" zum spannenden Krimi werden läßt. Einziger
Schwachpunkt des Buches sind fehlende Zeittafeln und Turnierlisten mit Wettkampfergebnissen,
während Namensregister sowie ausführlichen Literaturangaben dagegen vorbildlich
sind.
Brady hat keinen hermeneutischen Tunnelblick: Er will keine der gängigen einseitig
idealisierenden Thesen über Fischers einmalige Genialität oder die aufs Pathologische
fixierten Befunde über seine vermeintliche paranoide Schizophrenie beweisen,
sondern nur möglichst genau die Stationen beschreiben, die als wichtige Phasen
in Fischers Biographie von prägender Bedeutung waren. Brady kannte die ärmlichen
Verhältnisse der Familie Fischer selbst aus erster Hand und geht auf diese profanen
materiellen Bedingungen ein, weil die später so ausgeprägte Geldgier des Schachgenies
auf seine frühen entbehrungsreichen Jahre zurückzuführen war.
Regina Fischer mußte als alleinerziehende Mutter von Bobby und der sechs Jahre
älteren Schwester Joan jeden Cent dreimal umdrehen und konnte ein Bus- Ticket
für eine Fahrt zu einem Schachturnier nur mit Unterstützung des Marshall-Schachclubs
finanzieren.

Regina Fischer
Für Brady ist Fischer jedenfalls kein Psychopath, auch wenn er kritisch- entsetzt
einige ins Asoziale driftende Verhaltensmuster beschreibt und der Untertitel
"bis zum Rand des Wahnsinns" suggeriert, hier werde wieder einmal das elaborierte
Psychogramm eines Verhaltensgestörten aus diversen Puzzleteilchen zusammengesetzt.
Als Weltmeister konterte Fischer ja Karpows Herausforderung zum Titelkampf mit
eigenen rigorosen FIDE-Reformvorschlägen und Forderungen nach Einführung neuer
Turnierregeln, womit er sich selbst Patt setzte und den längst beabsichtigten
Verzicht auf eine Revanche begründen konnte . Er lehnte sogar einen exotischen
Millionendeal (fünf Millionen Dollar für ein Match in Manila) , diverse Sponsoren-und
Werbe- Angebote ab und spendete Tausende von Dollars seiner schrillen christlichen
"Worldwide Church"- Sekte in Pasadena - dann war er jedoch pleite und lebte
jahrelang in jämmerlichen Verhältnissen von der Stütze seiner Mutter. In dieser
"Down and Out-Phase" erwies sich die 17jährige vielversprechende ungarische
Schachspielerin Zita Rajcsanyi als rettende Samariterin: Zuerst schrieb sie
Bobby nur Briefe, um zu eruieren, weshalb der brillante Weltmeister einfach
untergetaucht war. Dann konnte sie über ihre Kontakte zur ungarisch-jugoslawischen
Schachszene das Rematch mit Spasski im jugoslawischen Sveti Stefan einfädeln,
das Bobby plötzlich wieder als Märchenprinz (mit vier Bodyguards) und als Multi-Millionär
auferstehen ließ. Doch schließlich mußte sich Fischer wie ein Schwerverbrecher
auf der Flucht möglichst unauffällig bewegen, weil er wegen der Boykottverletzung
auf den Fahndungslisten der US-Regierung gelandet war.

Spassky gegen Fischer 1992
Besonders eindringlich beschreibt Brady die letzte, ebenso irritierende wie
aufwühlende Phase Fischers in Island: Wieder einmal beschimpft und verflucht
Bobby gerade diejenigen, die sich besondere Mühe gegeben hatten, um ihm zu helfen
und ihm das Leben in Island zu erleichtern. Ein spezielles isländisches RJF-Komitee
hatte ihn ja mit Hilfe eines Parlamentsbeschlusses aus dem japanischen Knast
geholt und wollte ihm ein unbeschwerte Existenz in Freiheit, mit einem isländischen
Paß ermöglichen.
Selbst Fischer-Experten der ersten Stunde dürften überrascht sein über einige
faszinierende Exkurse in Bradys Biographie. Wer wußte schon, dass Bobby sich
noch vor seinem WM-Revanche-Match gegen Spasski von 1992 fast ein ganzes Jahr
inkognito in Deutschland aufgehalten hatte? Da besuchte er in Bamberg Lothar
Schmid, den ehemaligen Schiedsrichter der WM in Reykjavik und hielt sich unter
Schachfreunden in der Pulvermühle auf. Erst mit dem Auftauchen eines "Stern"-Reporters
hatte diese erholsame und für Bobby sehr angenehme Phase ein abruptes Ende:
Er ergriff sofort die Flucht. Und während dieser Zeit hatte er sich auf eine
Affäre mit der Schachspielerin Petra Stadler eingelassen, deren Adresse er von
Boris Spasski bekommen hatte. Doch Petra Stadler- sie heiratete 1992 den russischen
GM Rustem Dautov- veröffentlichte über ihre Beziehung mit Bobby ein Buch mit
dem reißerischen Titel "Bobby Fischer- Wie er wirklich ist. Ein Jahr mit dem
Schachgenie"- was Fischer natürlich sehr empörte.
Der rabiate Ego-Cruncher hatte die Demütigung seiner Gegner immer genossen und
konnte es nie akzeptieren, zurückgewiesen zu werden oder überhaupt irgendeinen
Kompromiß einzugehen. Umso traumatischer war für ihn wohl die Ablehnung seines
Heiratsantrags - ausgerechnet von der jungen Frau, die ihn aus seiner Misere
erlöst und das Rematch mit Spasski 1992 eingefädelt hatte. Brady beschreibt
diese merkwürdige Romanze mit Zita Rajcsanyi, die Bobby zuerst nur einen Fan-Brief
schickte und fragte, warum es um ihn so still geworden war. Dann trafen sich
die beiden, Fischer verbrachte viel Zeit mit ihr und sie konnte über ihre Kontakte
den überraschenden Deal mit dem dubiosen jugoslawischen Wirtschaftskriminellen
Jezdimir Vasilijevic (er wurde später inhaftiert) einfädeln, der für eine WM-Neuauflage
fünf Millionen Dollar anbot. Fischers Heiratsantrag lehnte Zita aber kategorisch
ab- seine antisemitischen Tiraden konnte sie ebensowenig akzeptieren wie seine
egomanische Art: Bobby ignorierte einfach ihre eindeutigen Hinweise auf ihre
feste Beziehung zu einem Freund, von dem sie sich keinesfalls trennen wollte.
Außerdem ging er von ihrer totalen Unterordnung unter sein patriarchalisch-autoritäres
Gehabe aus. Als es dann zum Bruch kam, hatte Fischer darunter wohl mehr zu leiden,
als er sich anmerken ließ, deutet Brady an.
Zu den vielen Paradoxien im Leben Fischers gehört vor allem die, besonders auf
seine Gesundheit geachtet zu haben und gerade dadurch einen selbstzerstörerischen
Strudel ausgelöst zu haben, der ihn schließlich unheilbar krank werden ließ.
Mit seiner eigenen Saftpresse in der Plastiktüte marschierte Fischer damals
in Pasadena in vegetarische Restaurants, packte unter den erstaunten Blicken
von Kellnern und Gästen seine Presse nebst mehreren Orangen aus und bereitete
sich selbst seinen gesunden Saft zu, weil er befürchtete, Russen oder Juden
könnten ihm irgendwelche gefährlichen Substanzen unterjubeln. Seine Zahnplomben
hatte er sich entfernen lassen, weil er das Quecksilber der Plomben für ungesund
hielt und außerdem Attacken russischer Geheimdienste befürchtete, die seiner
Ansicht nach über Mikrowellensender in implantierten Plomben operierten. Da
er keine Ersatzplomben einsetzen ließ, hatte sich Fischer so seine Zähne ruiniert.
Weil er schließlich nach der Befreiung aus dem japanischen Knast als frischgebackener
Isländer mit der verbiesterten Uneinsichtigkeit eines Zeugen Jehovas jede medizinische
Behandlung und selbst die Einnahme von Tabletten rigoros ablehnte, richtete
er sich selbst zugrunde.
Er hatte jahrelang unter urologischen Problemen, Atembeschwerden und einem gravierender
Nierenschaden gelitten, was dann in Reykjavik schließlich diagnostiziert wurde-
doch niemand durfte ihn behandeln. Eine Dialyse hätte dem "Mozart am Schachbrett"
das Leben retten können, doch davon wollte Bobby Fischer nichts wissen: "Ich
lasse keine Maschine an meinen Körper", betonte er immer wieder. Zweifellos
hatte Fischer in diesen letzten Lebensjahren einen Hang zur Selbstzerstörung
entwickelt- jedenfalls waren nicht nur die hilfsbereiten isländischen Freunde
über sein plötzliches Ende im Januar 2008 konsterniert. Auch Boris Spasski,
der Fischer kurz vor dessen Ende noch kontaktiert hatte, war bestürzt: "Ich
habe ihn geliebt", erklärte der sympathische Russe, der ja längst beim Moskauer
Bürokratenapparat in Ungnade gefallen war, nach Frankreich emigriert war und
schwer getroffen auf Bobby Fischers Tod reagierte.

Fischers Grab (Foto: Hans van Brandwijk)
Kritiker, die monieren, manche Details wären vielleicht zu sehr auf eine Yellow-Press-Klientel
zugeschnitten, sollten zur Kenntnis nehmen, dass Fischers Aufstieg und Fall
abhängig war von seinen Erfolgserlebnissen und er mit seinem Rückzug aus den
Turniersälen eben nur auf sich und seine introvertierte Nabelschau fixiert war.
Wie der Dachs, der sich in Franz Kafkas Parabel "Der Bau" immer neue komplizierte
Fluchtsysteme baut, merkt Fischer erst viel zu spät, dass es nicht seine Feinde
sind, die ihn am stärksten bedrohen: Für den Dachs erweist sich das Pfeifen
eines nahenden , bedrohlichen Außenseiters als sein eigenes Pfeifen. Und auf
der Paranoia-Skala des Schachgenies muß man Bobby selbst wohl den höchsten Wert
zubilligen- jedenfalls in seinen letzten Jahren.

Kann aus laienhafter Unwissenheit und naiver Unvoreingenommenheit ein Meisterwerk
werden? Allerdings, wie Liz Garbus dies mit ihrem eindrucksvollen Dokumentarfilm
über die vita des Schachgenies gezeigt hat. Sie hatte einfach zu wenig Vorinformationen
über Bobby, die ihren analytischen Blick getrübt oder einseitig beeinflussen
konnten. Die amerikanische Dokumentarfilmerin stellt im Juli ihren biografischen
Film über Bobby Fischer in London vor; sie las vor drei Jahren kurz nach seinem
Tod zufällig im Flieger einen Nachruf auf Bobby und war total elektrisiert,
als sie die wichtigsten Details über den Siegeszug des eigenwilligen Individualisten
gegen die kollektive sowjetische Schachmaschine mitbekam: "Da stand für mich
fest, ich mache meinen nächsten Fall unbedingt über diesen faszinierenden Außenseiter".
Liz Garbus ist eine sozialkritische Dokumentarfilmerin und hat für ihren engagierten
Film über Abu Graib einen Emmy Award bekommen. Ihr neuester Film heißt zwar
"Bobby Fischer against the world", aber er stellt keineswegs nur Fischers provozierenden
Verweigerungsstrategien oder andere negative Verhaltensmuster in den Mittelpunkt:
"Er konnte ja auch sympathisch, humorvoll und solidarisch sein, wie mir mehrere
ehemaligen Fischer-Weggefährten bestätigt haben", erklärte Garbus dem Kulturmagazin
"Paste".
Für ihren Film konnte sie auf hunderte seltener Photos des WM-Photographen
Harry
Benson zurückgreifen, der das gesamte WM-Match als Photograph begleitet
hatte und außerdem noch Dutzende komischer Episoden erlebt hatte. Den Wandel
des wonderboys vom Weltmeister zum verachteten Anti-Amerikaner und Holocaust-Leugner
will Garbus nicht auf den Aspekt "sympathisch" oder "nett" reduzieren: "Man
muß schließlich Mitleid mit ihm haben, weil er nie irgendeine Form der Therapie
bekam. Außerdem hat ihn sicher auch geprägt, dass die Beziehung zum Vater so
problematisch war und lange ungeklärt war, wer überhaupt der richtige biologische
Vater war". Auch den Aspekt einer selbstzerstörerischen Eigendynamik in Bobby
Fischers letzten Jahren verfolgt sie in ihrem Film, der ab Mitte Juli in England
in die Kinos kommt und am 5. Juli in einer Sondervorführung mit GM Nigel Short
im Rahmen einer Simultanvorstellung gezeigt wird.
Trailer zu Bobby
Fischer against the World...
"Ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube nur an gute Züge", hatte Fischer
ja einmal konstatiert. Über diese grotesk anmutende Behauptung kann man natürlich
lange grübeln, vor allem, wenn selbsternannte Experten sich jetzt daran machen,
eine Art finales Psychogramm des Ex-Weltmeisters zu liefern. Und das dann als
"psychologische Autopsie" bezeichnen, wie es der amerikanische Psychologe
Joseph
G. Pontoretto im Wissenschaftsmagazin Miller-McCune (vom 14. Dez. 2010)
macht. Pontoretto rechtfertigt sich damit, dass er diverse, bisher weniger bekannte
Unterlagen einsehen (die 750 Seiten umfassenden FBI-Akten über Regina und Bobby
Fischer) und Augenzeugenberichte zur Kenntnis nehmen und neue Aspekte analysieren
konnte und so eine gewisse kritische Objektivität gewährleitet sei. Doch Pontoretto
zitiert etwa aus einem Behördenbefund über Regina Fischer, der sich kritisch
über diese "querulante" Mutter äußert, die sich vehement gegen den Rauswurf
aus einem Heim für mittellose Mütter gewehrt hatte, um zu belegen, welch renitenter
Geist in der Familie Fischer dominierte. Immerhin sieht er aber Bobbys depressive
Phase Ende der 90er Jahre im Kontext familiärer Verluste: Regina Fischer war
1997 an Krebs gestorben, Bobbys Schwester Joan starb ein Jahr später an einem
Gehirntumor- was Bobby Fischer zweifellos in eine starke depressive Phase versetzte.
Doch außer Spekulationen und dem Recyclen von altbekannten Binsenweisheiten
("er war ein sehr unabhängiger Geist, war exzentrisch und besaß keine konventionellen
sozialen Fertigkeiten") kann Pontoretto nur mit dem Hinweis aufwarten, Fischers
Antisemitismus sei vielleicht von der Vorherrschaft russisch-jüdischer Spieler
im Großmeistersektor beeinflußt worden. So soll etwa Samuel Reshevsky zu Fischers
Intimfeinden gehört haben. Und während des Interzonenturniers in Palma de Mallorca
habe Bobby gegenüber Reshevsky einmal mit leuchtenden Augen von einem großartigen
Buch geschwärmt, das er gerade lese. Als Reshevsky fragte: "Ja und welches Buch
ist das?" habe Fischer geantwortet: "Mein Kampf!" Aus diesen bunt zusammengemixten
Puzzleteilchen will der Psychologe sich eine halbwegs wissenschaftliche Autopsie
basteln. Vielleicht hätte Pontoretto seine Kaffeesatzleserei lieber "posthume
Kalenderweisheiten" nennen sollen.

Kaum jemand wurde wohl so wüst und gnadenlos von Bobby Fischer beschimpft wie
Garry Kasparov, den Fischer nach seinen Kontroversen mit Karpov ja immer als
Karpovs heimtückischen Gesinnungsgenossen und "crook" -also Gauner- bezeichnet
hatte, als beide einer verwirrten Schachwelt ihren monatelangen Remis-Stellungskrieg
vorführten. Kasparov hat sich im Frühjahr in einer Rezension über Bradys Fischer-Biographie
geäußert und tat dies mit einer erstaunlichen Souveränität, hinter der großer
Respekt und immer noch eine gewisse Sympathie für den tragischen US-Helden erkennbar
ist.
Emotionslos und distanziert könne er unmöglich über Bobby Fischer schreiben,
erklärt Garry Kasparow in seiner Kritik, die er für die " New York Review of
Books" schrieb. Schließlich sei Bobby für ihn lange Zeit ein leuchtendes Vorbild
gewesen: 1963, als Kasparow geboren wurde, hatte der 14jährige Fischer die US-Meisterschaft
mit einem perfekten Score (elf Siege aus elf Partien) gewonnen und als der Amerikaner
1972 in Reykjavik die bis dahin für unbesiegbar geltende sowjetische Schachmaschine
bezwang und das Duell gegen Spasski nach abenteuerlichen Krisensituationen und
Disputen doch noch als neuer Weltmeister beendete, hatte der aufstrebende junge
Clubspieler Kasparow begeistert alle WM-Partien nachgespielt. "Ich träumte davon,
eines Tages gegen Fischer zu spielen", schreibt Kasparow, aber diese Herausforderung
gab es nur in den Debatten der Schach-Experten und Journalisten- weil es ja
zum Duell am Schachbrett nie kam. Und in diesem Kontext behandelt Kasparow auch
Fischers Ausweichmanöver gegenüber Karpow und kommentiert die rigide Entscheidung
des neuen Weltmeisters, alle Zugeständnisse der FIDE hinsichtlich neuer Regeln
abzulehnen und gegen Karpow nicht anzutreten.
Kasparov lobt Brady für seine unparteiische Erzählperspektive, die eine Vorverurteilung
des Amerikaners, wie sie jahrelang "von Millionen von Psycho-Amateuren" praktiziert
wurde, von vornherein ausschloß und es auch vermied, sich auf Debatten über
die Zurechnungsfähigkeit eines mental Gestörten einzulassen. Kasparov zitiert
Voltaire und dessen Verdikt über "kalkulierte Verrücktheit", die zielgerichtet
und daher auch erfolgreich sein könne. Er geht dann aber doch auf Fischers "stark
ausgeprägte Paranoia" ein und meint, Bobby hätte dringend therapeutische Hilfe
benötigt, denn nach seinem Rückzug vom Schach habe er den "dunklen Mächten"
freien, unkontrollierten Lauf gelassen. "Es gibt keine Moral am Ende dieser
tragischen Fabel", lautet Kasparovs Fazit: "Bobby Fischer war einzigartig, seine
Schwächen waren so banal wie sein Schachspiel brillant war".
Das Enigma des egomanischen Mimophanten, dieser rätselhafte Aufstieg und Fall
eines zum Heros stilisierten Kalten Kriegers, ist wohl nie plausibel zu dechiffrieren.
Selbst wenn man in Betracht zieht, dass sich schon in den 1950er Jahren die
Vorstandsmitglieder im Marshall Chess Club darüber den Kopf zerbrachen, ob man
den Teenager Bobby Fischer wegen seiner disziplinlosen Ausraster rausschmeißen
oder ihm einen Therapeuten besorgen sollte. Die Episode mit dem Therapeuten
und Großmeister Reuben Fine, den Regina Fischer ja schon als pädagogischen Helfer
in der Not kontaktiert hatte, zeigte auch, dass sich Bobby zwar gern zum Schachspiel
mit Fine traf, sich jedoch überrumpelt fühlte, als Fine ihn nach seinen Schulleistungen
befragte. Bobby Fischer wollte sich nicht helfen lassen; er fühlte sich permanent
von der überprotektiven Mutter (später dann von staatlichen Behörden und Bürokraten)
bevormundet und fand seinen inneren Frieden und seine eigentliche Bestimmung
wohl nur am Schachbrett. Damals hatte der Club daher auch alle Sanktionen und
Therapieversuche abgelehnt- wem wäre denn damit gedient, so lauteten damals
die Argumente, aus diesem Genie eine angepaßte graue Maus zu formen?
Frank Brady:
Endgame - Bobby Fischer´s Remarkable Rise and Fall - from America´s
Brightest Prodigy to the Edge of Madness. Crown Publishers New York, 2011,
402 S., 25.99 Dollar
Joseph
G. Ponteretto: "A psychological Autopsy of Bobby Fischer".
Miller-McCune Mag., Dezember 2010
Garry Kasparov: "The Bobby Fischer Defense". In:
The New York Review
of Books, 10. März 2011
"Bobby Fischer Against the World". Dokumentarfilm von Liz Garbus, ab 15. Juli
in engl. Kinos