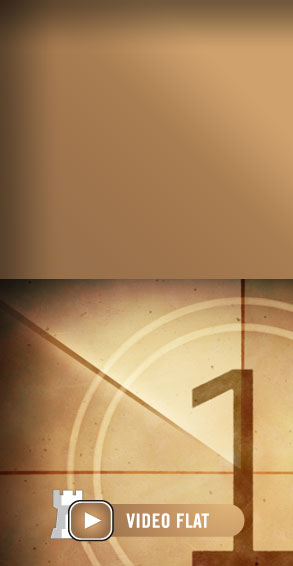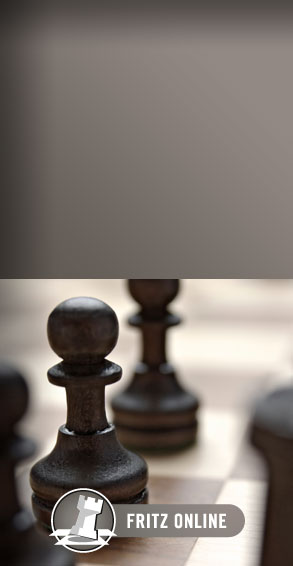Interview mit Robert von Weizsäcker

Wann haben Sie damit begonnen, sich für Schach zu interessieren und wer hat
es ihnen beigebracht?
Das wirkliche Interesse setzte 1972 anläßlich des legendären WM-Wettkampfs
zwischen Fischer und Spasskij ein. Relativ früh beigebracht hat mir das Spiel
mein Vater. Meine Begeisterung hielt sich allerdings in Grenzen, da ich gegen
ihn fast immer verlor.
Was ist am Schach so faszinierend, dass man sich damit als Kind und
Jugendlicher intensiv beschäftigt und Turniere spielt? Gibt es
Schlüsselerlebnisse?
Faszinierend für mich war der Wettkampf an sich, das strategische Element
und die ästhetische Seite des Spiels. Besonders gefesselt hat mich von Anfang an
das positionelle Schach, weniger das vielleicht spektakulärere kombinatorische
Schach - obwohl man natürlich auch als positionell ausgerichteter Spieler am
Ende stets in die Welt der Taktik gerät.
Schlüsselerlebnisse für mich waren die WM 1972, eine Simultanpartie gegen
Botwinnik 1973 (remis) und die Tatsache, daß ich bald wenigstens im Schach
innerhalb der Weizsäcker-Familie die Oberhand behalten konnte.
Aus der Distanz gesehen: Ist es sinnvoll Schach zu spielen und welchen
Nutzen kann man daraus für seine persönliche Entwicklung ziehen. Und konkret:
Gibt es eine Eigenschaft bei der Sie sagen, diese hat sich besonders mit meiner
Beschäftigung mit dem Schach in dieser Form heraus gebildet?
Ich bin häufig gefragt worden, warum ich eigentlich dermaßen viel Zeit auf
das Schach verwandt habe. Bis heute bin ich davon überzeugt, daß auch mit Blick
auf die Welt außerhalb des Schachs und jenseits der reinen Freude am Spiel nicht
ein Tag umsonst war. Denn diejenigen Fähigkeiten und Charaktermerkmale, die man
durch das Schach erwirbt oder vertieft, sind auch darüber hinaus äußerst
nützlich. Das gilt insbesondere für den von mir später gewählten
Wissenschaftsberuf. Beispiele sind: analytisches Denken, abstrakte Phantasie
(man muß sich ja bei der Entwicklung eines strategischen Konzepts auf
schöpferische Weise etwas vorstellen, was man nicht gegenständlich auf dem Brett
sieht) und das Vertrauen in die eigene Disziplin des Entscheidens. Eine
Eigenschaft, die sich besonders durch die Beschäftigung mit Schach
herausgebildet hat, knüpft an das Letztgenannte an. Es ist eine quasi-rationale
Kraft zur Entscheidung im Lichte des Ungewissen.
In welchen Vereinen haben Sie gespielt und welche Trainings -und
Entwicklungsmöglichkeiten gab es: Gab es Vorbilder, auch im Verein selbst oder
dem Umfeld?
Eher weniger. Für mich war die Schachliteratur von größter Bedeutung.
Geradezu verzehrt habe ich die Standardwerke von Nimzowitsch, Euwe, Aljechin,
Botwinnik und Kotow; zum Teil auch von Suetin. Heute bewundere und studiere ich
insbesondere die Bücher von Dworetskij.
Können Sie sich noch an Spieler aus jener Zeit erinnern, die heute noch
aktiv oder nicht mehr aktiv sind?
Nicht vereinsbezogen.
Was hat ihnen die Teilnahme an den Bundesligawettkämpfen bedeutet. Gibt es
da einen besonderen Kitzel oder Thrill, den das Wettkampfschach vermittelt?
Das war Psycho-Stress ohne Ende - jedenfalls für mich. Wettkampfschach
erfordert eine starke Physis und eine starke Psyche. In der 4. und 5. Stunde
kurz vor der Zeitkontrolle haben mich beide oft verlassen.
Manche Spieler werden vom Turnierschach völlig eingesogen, verlieren
vielleicht ihre eigentlichen Lebensziele aus den Augen und/oder wählen eine
Profi- oder Halbprofikarriere. Gab es bei Ihnen auch Gedanken an eine
Schachprofikarriere oder war es immer klar, dass Sie eine wissenschaftliche
Karriere anstreben?
Im stillen, verklärten Kämmerlein mag es solche Gedanken tatsächlich
gegeben haben. Eine wissenschaftliche Laufbahn war allerdings keineswegs klar.
Nach wie vor bin ich übrigens der Ansicht, daß sich die abstrakten und kreativen
Anforderungen in meinem heutigen Wissenschaftsberuf im Kern der Sache nicht so
sehr von denen im Schach unterscheiden. Aber ich habe eben den "vernünftigen"
Weg gewählt und überdies war die Frage, ob ich denn im Profischach überhaupt
wettbewerbsfähig gewesen wäre, realistischerweise zu verneinen.
Nach ihrem Rückzug aus dem Turnierschach und einer sehr erfolgreichen
Karriere als Wirtschaftswissenschaftler haben Sie nach langer Pause wieder den
Weg zum Schach zurück gefunden. Wie kam es dazu? Ist die Verbindung zum
Turnierschach, wenn man einmal daran teilgenommen hat, so intensiv, dass man
irgendwann einmal wieder dorthin zurückkehren muss?
Ein gewisses Suchtelement läßt sich nicht leugnen. Der Gedanke an einen
Wiedereinstieg ins aktive Schach entstand in einer beruflichen Phase der
Stagnation.
Wie kamen Sie zum Fernschach?
Ganz konkret über eine Anzeige in der Deutschen Schachzeitung 1973.
Darüber hinaus durch den zunehmenden Mangel an Zeit, zu Turnieren zu reisen.
Wichtige Motive waren aber auch mein Hang zum Gründlichen und der
Aufregungsstress des Nahschachs. Fernschach hat etwas zu tun mit der Suche nach
dem Absoluten - mag dieses Unterfangen auch noch so aussichtslos sein.
Wie ist es möglich, intensive berufliche Verpflichtungen und eine
erfolgreiche Fernschachkarriere unter einen Hut zu bringen?
Eigentlich gar nicht. Irgendetwas muß leiden. Ich hatte auch Glück.
Haben Sie sich auch in ihrer schachabstinenten Zeit weiter mit Schach
beschäftigt und Eröffnungstheorie studiert oder haben Sie sich neu
eingearbeitet?
Der Kontakt zum Schach ist nie abgebrochen. Ich habe z.B. über viele Jahre
Schachkolumnen geschrieben. Darüber hinaus habe ich kontinuierlich den
Schachinformator studiert, die Zeitschrift New in Chess gelesen und TWIC
angeklickt.
Manche sagen, Fernschach sei durch den möglichen Einsatz von Datenbanken
und Computern in der Krise. Wie sehen Sie das?
Gott sei Dank gilt das (noch) nicht für das Fernschach auf hohem Niveau.
Die Datenbanken bilden einen modernen Teil der Vorbereitung im Fernschach wie im
Nahschach. Darauf muß man sich einstellen und das muß man auch möglichst
effizient beherrschen. Die Engines sind in positionell angelegten Partien
dagegen häufig weniger hilfreich, da sie den roten Faden einer solchen Partie
nicht wirklich identifizieren können. Die immer wieder neu ansetzenden
brute-force Algorithmen lassen die Engines eben immer noch eher rechnen als
denken. Für die Entwicklung der eigenen Spielstärke ist es übrigens sehr
wichtig, Engines immer erst dann zu konsultieren, wenn man sich seine eigenen
gründlichen Gedanken zu einer gegebenen Stellung gemacht hat.
Würden Sie Schachfreunden in ähnlicher Situation einen Weg ins Fernschach
empfehlen?
Unbedingt. Aber passen Sie auf, daß das nicht zu einer selbst gewählten
Form der Versklavung führt.
Verfolgen Sie auch das Geschehen im Nahschach oder konzentrieren Sie sich
nur auf die Fernschachszene und nehmen von dort Anregungen auf?
Ich verfolge fast nur das Nahschach.
Mit Weiß bevorzugen Sie 1.d4 mit Schwarz gegen 1.e4 Caro-Kann. Soll man im
Fernschach scharfe Stellungen spielen, wo man den Computer besser einsetzen kann
oder lieber ruhige Eröffnungen spielen und auf langfristige Pläne setzten?
Ich habe mich für das Letztere entschieden. Fragen des eigenen Schachstils
liegen freilich in der Regel früh fest und sind meiner Meinung nach auch
unabhängig von Computer-Überlegungen zu klären.
In den letzen Jahren haben Sie jedes Fernschachturnier, an dem Sie teilnahmen
als Sieger oder zumindest geteilter Erster beendet. Vor zwei Jahren wurden Sie
Internationaler Fernschachmeister, im letzten Jahr Fernschachgroßmeister.
Insgesamt haben Sie bisher überhaupt nur zwei Partien verloren. Das ist eine
beeindruckende Bilanz. Was sind ihre weiteren Ziele?
Zur Zeit vertrete ich die deutschen Farben in der Endrunde der
Schach-Olympiade an Brett 4 (von 6 Brettern). Drücken Sie uns die Daumen, daß
wir der Konkurrenz standhalten können. Vor drei Jahren konnte ich ein Semifinale
der 24. FS-WM gewinnen. Das berechtigt zur Teilnahme am Kandidatenturnier.
Vielleicht werde ich eine Meldung zu diesem Turnier wagen.
Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg bei der Fernschacholympiade und
allen weiteren Turnieren.
Interview: André Schulz

Fernschachpartien von Robert von Weizsäcker...
Teilnahme an insgesamt 10 FS-Turnieren
(in 30 Jahren - mit einer berufsbedingten Unterbrechung von 20 Jahren (!)):
I/1770 (1973): Platz 1 (11,5 aus 12)
EU/I/680 (1974): Platz 1 (4,5 aus 5)
H/770 (1974): Platz 1 (11 aus 12)
M/464 (1975): Platz 1-2 (5,5 aus 6)
EU/M/384 (1976): Platz 1-2 (4,5 aus 6)
WT/M/761 (1997): Platz 1 (6 aus 6)
WT/M/790 (1999): Platz 1 (5,5 aus 6)
WT/M/798 (1999): Platz 1 (6 aus 6)
WC XXIV, SF 5 (2000): Platz 1 (8 aus 10)
Christoffel Memorial, Section Gold (2002): Platz 1-3 (9 aus 14)
"M" = Meisterklasse,
EU = Europaturnier,
WT = Weltturnier, WC = Weltmeisterschaft
(SF = Semifinale)
2002: Internationaler Meister
2004: Internationaler Großmeister
Technische
Universität München
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre
Prof. Dr. Robert K. Frhr. von Weizsäcker
CV
Geboren: 1954.
Diplom-Volkswirt, Universität Bonn, 1980.
Promotion, London School of Economics / Universität Bonn, 1985.
Habilitation, Universität Bonn, 1990.
Privatdozent,
Universität Bonn, 1990-1992.
Heisenberg-Stipendiat, Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1991-1992.
European Scholar, London School of Economics, 1991.
Lehrauftrag, Humboldt-Universität zu Berlin, 1991-1992.
Ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre, Universität Halle-Wittenberg,
1992-1995.
Research Fellow, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, 1994-2004.
Ordinarius für Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim, 1995-2003.
Mitglied des Wissenschaftsrats, 1997-1999.
Research Fellow, Institut für Wirtschaftsforschung (CESifo), München, 1999-.
Research Fellow, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, 2000-.
Mitglied des Vorstands, Institut für Mittelstandsforschung (ifm), Mannheim,
2001-2004.
Ordinarius für Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Industrieökonomik,
TU München, 2003-.
Faculty Member,
Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC), Max-Planck-Institut für
Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München, 2003-
Mitglied des
Federal Taxation and Finance Committee, National Tax Association (USA),
1987-1990.
Mitglied des Vorstandsrats, Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH),
1992-1996.
Council-Mitglied der European Society for Population Economics, 1992-1997.
Vorsitzender des Bildungsökonomischen Ausschusses, Gesellschaft für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften, 1994-1999; stv. Vorsitzender 1999-.
Mitglied der Ständigen Kommission für Lehre und Studium,
Hochschulrektorenkonferenz, 1994-2000.
Mitglied des Erweiterten Vorstands, Gesellschaft für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, 1994-1999.
Mitglied des Scientific Committee, Jahrestagung, International Institute of
Public Finance (Lissabon 1995, Tel Aviv 1996 und Kyoto 1997).
Mitglied des Direktoriums, Institut für Volkswirtschaftslehre und Statistik,
Universität Mannheim. 1995-2003.
Mitglied des Senatsausschusses und des Bewilligungsausschusses,
Graduiertenkollegs, Deutsche For-schungsgemeinschaft, 1996-1999.
Prodekan der Volkswirtschaftlichen Fakultät, Universität Mannheim, 1996-1998.
Mitglied des Vorstands, Carl von Linde-Akademie, TU München, 2003-.
Forschungsaufenthalte:
Cambridge University, Université Catholique de Louvain, London School of
Economics, Stanford University, International Monetary Fund (Washington, DC).
Forschung: Finanztheorie
und -politik, Unternehmensfinanzierung, Bildungsökonomik, Bevölkerungsökonomik,
Industrieökonomik.
Co-Editor,
Public Finance, 1989-1997; Advisory Editor, 1997-.
Associate Editor, Journal of Population Economics, 1994-2001.
Panel Member, Economic Policy, 1995.
Veröffentlichungen: 8 Bücher, 50 Aufsätze.
Consulting:
|
Finanztheorie und
-politik: |
Staatsverschuldung,
Steuerreform, Finanzierung der sozialen Sicherung |
|
Unternehmensfinanzierung: |
Mergers & Acquisitions,
Unternehmensbewertung, Risikomanagement, Ökonometrie der Finanzmärkte |
Industrieökonomik:
|
Industrieanalysen |
Sonstiges:
Internationaler Fernschach-Großmeister