Das
Internationale Schachturnier Baden-Baden 1870
Von Johannes
Fischer
Vorgeschichte
Nach den großen Turnieren in London 1851 und 1862,
sowie Paris 1867, die dem englischen und französischen Schach zu Ansehen
verholfen hatten, mochten die deutschen Schachspieler nicht länger zurückstehen:
Sie hielten die Zeit für gekommen, ebenfalls ein großes internationales Turnier
auszurichten. Nachdem sich die Kurstadt Baden-Baden bereit erklärt hatte, 1870
ein solches Turnier zu organisieren, nahm man sich Großes vor: "1. Revision und
Feststellung der Schachspielregeln; 2. Großes internationales Schachturnier
zwischen den stärksten Spielern der Gegenwart; 3. Handicapturnier zwischen
Schachspielern von verschiedener Stärke; 4. Beratungspartien; 5. Bankett zu
Ehren der Sieger" (Hermann von Gottschall, Adolf Anderssen, Der Altmeister
deutscher Schachspielkunst, Zürich: Edition Olms, Nachdruck der Ausgabe
Leipzig 1912, S.348).
 Treibende
Kraft der Organisation war Ignaz Kolisch, selbst ein starker Schachspieler, der
durch Rothschild gefördert als Bankier reich wurde und später als Mäzen
zahlreicher Schachturniere auftrat. Hermann von Gottschall bezeichnet ihn in
seiner Anderssen-Biographie als "die Seele des ganzen Unternehmens ..., dessen
rastlosen Bemühungen das Zustandekommen des Turniers zu danken war" (Gottschall,
Anderssen, S.351.).
Treibende
Kraft der Organisation war Ignaz Kolisch, selbst ein starker Schachspieler, der
durch Rothschild gefördert als Bankier reich wurde und später als Mäzen
zahlreicher Schachturniere auftrat. Hermann von Gottschall bezeichnet ihn in
seiner Anderssen-Biographie als "die Seele des ganzen Unternehmens ..., dessen
rastlosen Bemühungen das Zustandekommen des Turniers zu danken war" (Gottschall,
Anderssen, S.351.).
 Ignaz
Kolisch fungierte als Sekretär des Organisationskomitees, dessen Präsident
Prinz Stourdza und dessen Vizepräsident der russische Schriftsteller Iwan
Turgenjew waren. Die Berufung von Turgenjew war mehr als nur ein Publicity-Gag,
denn der 1813 geborene Schriftsteller spielte leidenschaftlich und gut Schach:
"Während seines Aufenthaltes in Paris war er Stammgast im berühmten Café de la
Régence. 1862 erreichte er zusammen mit dem französischen Champion Jules Arnous
de Rivière den zweiten Platz in einem Turnier, das der Inhaber des Cafés für die
sechzig stärksten Spieler unter den Stammgästen des Lokals veranstaltete. In
seiner Bibliothek [...] befinden sich viele Schachbücher und
Schachzeitschriften, die mit seinen Randbemerkungen, Varianten und Zügen
versehen sind. [...] Er war mit Schachgrössen wie Paul Charles Morphy, Adolf
Anderssen, Johann Jacob Löwenthal, Wilhelm Steinitz, Daniel Harrwitz, Ignatz
Kolisch und Joseph Henry Blackburne persönlich bekannt." (Beat Rüegsegger,
Persönlichkeiten und das Schachspiel, 2000, S.105).
Ignaz
Kolisch fungierte als Sekretär des Organisationskomitees, dessen Präsident
Prinz Stourdza und dessen Vizepräsident der russische Schriftsteller Iwan
Turgenjew waren. Die Berufung von Turgenjew war mehr als nur ein Publicity-Gag,
denn der 1813 geborene Schriftsteller spielte leidenschaftlich und gut Schach:
"Während seines Aufenthaltes in Paris war er Stammgast im berühmten Café de la
Régence. 1862 erreichte er zusammen mit dem französischen Champion Jules Arnous
de Rivière den zweiten Platz in einem Turnier, das der Inhaber des Cafés für die
sechzig stärksten Spieler unter den Stammgästen des Lokals veranstaltete. In
seiner Bibliothek [...] befinden sich viele Schachbücher und
Schachzeitschriften, die mit seinen Randbemerkungen, Varianten und Zügen
versehen sind. [...] Er war mit Schachgrössen wie Paul Charles Morphy, Adolf
Anderssen, Johann Jacob Löwenthal, Wilhelm Steinitz, Daniel Harrwitz, Ignatz
Kolisch und Joseph Henry Blackburne persönlich bekannt." (Beat Rüegsegger,
Persönlichkeiten und das Schachspiel, 2000, S.105).
Die Organisatoren leisteten hervorragende Arbeit,
und es gelang ihnen, das damals bislang stärkste Turnier aller Zeiten auf die
Beine zu stellen. Mit Adolf Anderssen, Wilhelm Steinitz, Joseph Henry Blackburne,
Gustav Neumann, Louis Paulsen, Cecil de Vere, Johannes von Minckwitz, Samuel
Rosenthal und Simon Winawer starteten ausnahmslos Spieler der damaligen
Weltspitze. Lediglich der deutsche Teilnehmer Adolf Stern fiel gegen diesen
Kreis etwas ab.
Krieg
Aber trotz des illustren Teilnehmerfeldes konnten
die ehrgeizigen Pläne des Komitees nicht verwirklicht werden. Denn am 14. Juli
1870, kurz vor dem Beginn des Turniers, das vom 18. Juli bis zum 4. August
stattfand, verfügte Frankreich die allgemeine Mobilmachung, der am 19. Juli eine
formelle Kriegserklärung Frankreichs an Preußen folgte. Damit begann der
Preußisch-Französische Krieg, der mit einer Niederlage Frankreichs endete, zur
Abdankung Napoleons III führte und Frankreich wieder in eine Republik
verwandelte, während die nationale Begeisterung, die der Krieg in den
verschiedenen deutschen Staaten auslöste, schließlich den Zusammenschluss der
einzelnen deutschen Staaten zu einem einheitlichen Nationalstaat möglich machte.
Angesichts solch historischer Ereignisse verlor das Schachturnier an Bedeutung.
Und da Baden-Baden nicht weit von der Front entfernt war, überlegten die
Teilnehmer und das Komitee sogar, ob das Turnier nicht abgebrochen werden
sollte:
"So stellte J. Minckwitz ernstlich den Antrag, den
Kongreß aufzulösen und an die anwesenden Konkurrenten einen Teil der Preise als
Entschädigung für die vergeblichen Reisen und aufgewandten Kosten zu verteilen,
das Komitee lehnte aber diesen Antrag ab. Zur Begründung seines Antrags hatte J.
Minckwitz unter anderem hervorgehoben, daß es von manchen Seiten wahrscheinlich
geradezu als Frevel betrachtet werden würde, in solchen Zeiten mitten im Kriege
und so nahe der Grenze unbekümmert Schach zu spielen. Anderssen äußerte
daraufhin zu Minckwitz: 'Sie hätten in Ihrem Antrage von Rechts wegen das nicht
sagen sollen – im Gegenteil, Sie hätten auf Deutschlands starke Heereskraft, auf
die ausgezeichnete deutsche Führerschaft pochend, Ihren Antrag gar nicht stellen
sollen. Sie hätten sagen sollen: Wir wollen doch einmal sehen, wer uns 'was tut.
Wir spielen hier ruhig unser friedliches Spiel, unbekümmert um die nahen
feindlichen Truppen, die von unsern braven deutschen Brüdern schon in Schach
gehalten werden. Wir wissen uns sicher.' Zu dieser Äußerung Anderssens macht die
[von Minckwitz redigierte; jf] Schachzeitung eine etwas boshafte kritische
Glosse: 'Nicht unerwähnt darf aber dabei bleiben, daß Anderssen aus Furcht vor
den Turkos jeden Augenblick bereit war, Reißaus zu nehmen, eine kleine
Reisetasche mit dem Notwendigsten stets fertig gepackt hatte, indes er seinen
großen Koffer den Händen der plündernden Feindeshorden als bonne prise zu
überlassen gedachte'" (Gottschall, Anderssen, S.348).
Adolf Stern war jedoch als einziger Teilnehmer
direkt vom Krieg betroffen, "da er als Königl. Bayerischer Reservist zu den
Fahnen einberufen worden" (Schachzeitung, S.254). Alle seine Partien
wurden deshalb als kampflose Siege für seine Gegner gewertet, was Minckwitz in
der Schachzeitung mit folgendem Kalauer kommentierte: "Stern figuriert daher im
Turnier nur noch nominell und ist in Folge dessen ein von allen Concurrenten
sehr gesuchter und sehr beliebter Gegner" (Schachzeitung, S.254).
Modus
Schließlich entschieden sich Komitee und Spieler,
das Turnier durchzuführen, allerdings nur mit zwei statt der ursprünglichen
geplanten drei Runden. Auch auf die Handicap-Partien, das Bankett und die
Festlegung der Regeln verzichtete man. Jeder Teilnehmer spielte also gegen jeden
zwei Partien, aber nicht wie heute üblich in zwei Doppelrunden, sondern in Form
von kurzen Wettkämpfen von zwei hintereinander ausgetragenen Partien.


Begonnen wurde früh. So legten die Turnierregeln
folgendes fest:
"Das Spiel beginnt ... jeden Morgen im
Congresslokale um 9 Uhr. Jede Partie wird ohne Unterbrechung so lange
fortgesetzt, bis sie zu Ende geführt ist. ... Dauert eine Partie weniger als
drei Stunden, so sind die Spieler verpflichtet, Nachmittags um 4 Uhr eine zweite
zu beginnen und ebenfalls ohne Unterbrechung auszuspielen. Nach Verlauf von 3
Stunden einer Partie hat jeder Spieler das Recht, eine Viertelstunde
Erholungsfrist zu beanspruchen" (Turnierregeln Punkt III, zitiert in Neue
Berliner Schachzeitung, Juli/August 1870, S.243). War ein Spieler anderthalb
Stunden nach Beginn der Partie nicht erschienen, verlor er kampflos.
Möglicherweise war dies der Grund, warum etliche Partien kampflos verloren
gingen. Minckwitz' Bericht in der Schachzeitung über diese Partien geht leider
über eine Ergebnismeldung nicht hinaus, wenngleich er die Gelegenheit zu einer
Entschuldigung in eigener Sache nutzt – ohne hier allerdings deutlicher zu
werden: "Zu bemerken ist noch, dass Rosenthal beide Male gegen Minckwitz und De
Vere, Minckwitz einmal gegen Paulsen freiwillig verzichtet hat, dass Minckwitz
übrigens, ohne ihn weissbrennen zu wollen, seinen wenig günstigen Erfolg theils
den aufregenden Zeit-, theils gewissen anderen Umständen verdankt" (Schachzeitung,
S.258).
Die Bedenkzeit der Spieler in Baden-Baden wurde mit
Uhren gemessen, obwohl die Spieler auf Wunsch auch die bis dahin üblichen
Sanduhren verlangen konnten. Allerdings ging man mit Zeitüberschreitung weniger
rigoros um als heute. So überschritt Paulsen in seiner Partie gegen De Vere in
gewonnener Stellung die Zeit, aber De Vere lehnte es ab, die Partie auf diese
Weise zu gewinnen. Schließlich einigte man sich darauf, die Partie zu
wiederholen. Ein Grund für diese Toleranz bei Zeitüberschreitung mag gewesen
sein, dass die Uhren damals noch über keine Fallblättchen verfügten, die die
Zeitüberschreitung eindeutig markierten. Der Vorschlag, in Schachuhren
Fallblättchen einzubauen, wurde erst 1899 von H.D.B. Mejer, dem Sekretär der
Niederländischen Schachvereinigung gemacht. Allerdings dauerte es noch etwa
zwanzig weitere Jahre, bis sich Fallblättchen in Schachuhren allgemein
durchsetzten.
Dafür waren die Spieler verpflichtet, lesbare
Abschriften der Partien abzuliefern: "Der Gewinner jeder Partie muss vor Beginn
des nächsttägigen Spieles dem Secretär eine leserliche Abschrift derselben
übergeben, widrigenfalls ihm die Partie als remis angerechnet wird. Ist die
Partie remis geworden, so ist der Anziehende verpflichtet, die Ablieferung der
Copie zu besorgen, da ihm die Partie sonst als verloren angerechnet wird".
Trotzdem gingen die Aufzeichnungen einer Reihe von Partien verloren. Auch hier
verfuhr man anscheinend weniger rigoros, als die Turnierregeln suggerieren.
Vielleicht scheute sich die Turnierleitung aber auch, gegenüber renommierten
Spielern energisch aufzutreten, denn "wie die Deutsche Schachzeitung zu
berichten weiß, schrieb Anderssen überhaupt seine Partien nur unregelmäßig auf,
und überließ dies den Zuschauern" (Hermann von Gottschall, Adolf Anderssen,
S.351).
Turnierverlauf
Partien zum Nachspielen...
Souveräner Sieger des Turniers war Adolf Anderssen.
Bereits in der vierten Runde setzte er sich an die Spitze und siegte am Ende mit
11 Punkten aus 16 Partien. Auch eine kleine Schwächephase in Runde 7 und 8, als
er beide Partien gegen Gustav Neumann verlor, kostete ihn nicht die
Tabellenführung. Zwar konnte Blackburne kurzzeitig mit ihm gleichziehen, aber
als der Engländer die Runden 10 und 11 verlor, war Anderssen wieder
unangefochten Erster. Dennoch musste er in der letzten Runde noch einmal um den
alleinigen Turniersieg fürchten, denn Steinitz war mit einem beeindruckenden
Schlussspurt bis auf einen halben Punkt an Anderssen herangekommen, und so
brauchte Anderssen in der letzten Runde einen Sieg gegen Paulsen, um sich den
alleinigen ersten Platz zu sichern. Aber mit einem spekulativen Qualitätsopfer
in gegnerischer Zeitnot zwang er das Turnierglück auf seine Seite.
Das starke Finish von Steinitz kompensierte einen
schwachen Beginn. Er begann das Turnier mit 0,5 aus 4, wobei er mit Blackburne
und Anderssen gegen zwei der stärksten Gegner gleich zu Beginn spielen musste.
Dramatisch verlief das Minimatch gegen Anderssen. In beiden Partien opferte
Anderssen Material, um anzugreifen, in beiden Fällen verteidigte sich Steinitz
ungenau und in beiden Partien ging Anderssens Konzept auf. Nach ihrem Wettkampf
aus dem Jahre 1866, den Steinitz mit 8:6 gewann, unterstrich Anderssen so, dass
er Steinitz noch ebenbürtig war.
Blackburne und Neumann spielten nicht konstant
genug, um Chancen auf den Turniersieg zu haben. Blackburnes Schwächeperiode kam
in der Mitte des Turniers. Nach 9 Runden lag er gleichauf mit Anderssen an der
Spitze, verlor dann aber gegen Paulsen und Anderssen und büsste alle Chancen auf
den Turniersieg ein. Neumann hingegen gelang das Kunststück, beide Partien gegen
Anderssen zu gewinnen, verdarb direkt danach jedoch seine Chancen, indem er aus
den Wettkämpfen gegen Steinitz und Rosenthal nur einen halben Punkt holte. Er
verlor 0:2 gegen Steinitz und 0,5:1,5 gegen Rosenthal.
Anderssen spielte in etlichen Partien das aggressive
Angriffsschach, für das er bekannt ist, in anderen griff er zu ruhigeren
Mitteln. So wählte er in seiner Schwarzpartie gegen Neumann zu Manövern, die
später durch den Nimzo-Inder allgemein bekannt wurden. Steinitz hatte seine
Theorien über die Grundlagen des Positionsspiels noch nicht entwickelt, und
spielte waghalsiges Angriffsschach, womit ihm in seinen Weißpartien gegen
Neumann und Paulsen zwei Glanzpartien gelangen. Generell scheute er kein Risiko
und griff mit Weiß mehrfach zum provokanten Steinitz-Gambit, meist mit Erfolg.
Atmosphäre
 Ungeachtet
des Krieges, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft abspielte, und der viele
Besucher des Kurorts aus Baden-Baden vertrieben hatte, war die Stimmung während
des Turniers, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, ausgesprochen gut.
So fasst Hermann von Gottschall in seiner Anderssen-Biographie Minckwitz'
Darstellung in der Schachzeitung wie folgt zusammen: "Um 9 Uhr begann das
Spiel, um 1 Uhr wurde meist gemeinschaftlich das Diner in dem Kursaal
eingenommen ... Wer frei hatte, vergnügte sich durch Ausflüge. Abends lauschte
man im Kursaal den Klängen der vorzüglichen Badekapelle. Beim Eintreffen guter
Kriegsnachrichten fanden große patriotische Demonstrationen statt. Zum Abschluß
wurde nach dem Konzert noch in einer Weinkneipe dem Gott Bacchus gehuldigt. Das
ganze Turnier war durch Kolischs unermüdliche Tätigkeit vortrefflich organisiert
und wurde den Teilnehmern ein bis dahin noch nicht dagewesener Komfort geboten.
Der Kampf fand in einem geräumigen Spielzimmer an zweckmäßigen, mit grünem Tuche
ausgeschlagenen Tischen statt, allerliebste Schwarzwälder Uhren dienten zur
Kontrolle der Zeit. Auch das verwendete Spielmaterial war praktisch Ein
Schreibtisch, mit gedruckten Partieformularen, mit Bleistiften, Papier und allen
anderen Utensilien reichlich versehen, stand zur Verfügung der Spieler. (v.
Gottschall, Anderssen, S. 351, vgl. auch Schachzeitung, S.
258-262).
Ungeachtet
des Krieges, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft abspielte, und der viele
Besucher des Kurorts aus Baden-Baden vertrieben hatte, war die Stimmung während
des Turniers, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, ausgesprochen gut.
So fasst Hermann von Gottschall in seiner Anderssen-Biographie Minckwitz'
Darstellung in der Schachzeitung wie folgt zusammen: "Um 9 Uhr begann das
Spiel, um 1 Uhr wurde meist gemeinschaftlich das Diner in dem Kursaal
eingenommen ... Wer frei hatte, vergnügte sich durch Ausflüge. Abends lauschte
man im Kursaal den Klängen der vorzüglichen Badekapelle. Beim Eintreffen guter
Kriegsnachrichten fanden große patriotische Demonstrationen statt. Zum Abschluß
wurde nach dem Konzert noch in einer Weinkneipe dem Gott Bacchus gehuldigt. Das
ganze Turnier war durch Kolischs unermüdliche Tätigkeit vortrefflich organisiert
und wurde den Teilnehmern ein bis dahin noch nicht dagewesener Komfort geboten.
Der Kampf fand in einem geräumigen Spielzimmer an zweckmäßigen, mit grünem Tuche
ausgeschlagenen Tischen statt, allerliebste Schwarzwälder Uhren dienten zur
Kontrolle der Zeit. Auch das verwendete Spielmaterial war praktisch Ein
Schreibtisch, mit gedruckten Partieformularen, mit Bleistiften, Papier und allen
anderen Utensilien reichlich versehen, stand zur Verfügung der Spieler. (v.
Gottschall, Anderssen, S. 351, vgl. auch Schachzeitung, S.
258-262).
Resümee
Trotz der ausgezeichneten Organisation, dem
hervorragenden Teilnehmerfeld und dem Erfolg des deutschen Schachidols Adolf
Anderssen zieht Minckwitz in der Schachzeitung eine zwiespältige Bilanz:
"Obgleich ein so grossartiges, von so vielen der allerstärksten Spieler
besuchtes Turnier noch nie stattgehabt hat, und ohne Widerrede das Resultat in
jeder Beziehung ein glänzendes zu nennen ist, müssen wir doch leider die
Bemerkung hinzufügen, dass dieser internationale Congress seinen Zweck nur zum
Theil erfüllen konnte. Der Krieg, der Krieg hat einen unerwarteten, grossen
Strich durch die Rechnung gemacht!!" (Schachzeitung, S.262).
Damit hat er nicht Unrecht. Der Krieg zwang die
Organisatoren ihre ambitionierten Pläne einzuschränken und bescherte dem Turnier
weniger Aufmerksamkeit, als es verdiente. Schachhistorisch bedeutete der Sieg
des Veteranen Anderssen noch einmal einen Triumph der romantischen Schule, der
auch Steinitz damals noch anhing. Aber Steinitz lernte aus seinem Misserfolg.
Nur drei Jahre später hatte er beim Turnier in Wien 1873 seinen Stil radikal
umgestellt, gewann dort überlegen, und etablierte sich als bester Spieler der
Welt.
Quellen:
Hermann von Gottschall, Adolf Anderssen, Der
Altmeister deutscher Schachspielkunst, Zürich: Edition Olms, Nachdruck der
Ausgabe Leipzig 1912.
A.J. Gillam, (Hrsg.), Baden-Baden 1870,
Nottingham 1999.
Beat Rüegsegger, Persönlichkeiten und das
Schachspiel, 2000.
Thorsten Heedt, William Steinitz: Der erste
Schachweltmeister, ChessBase Monographie, 2003.
David Hooper & Kenneth Whyld, The Oxford
Companion to Chess, Oxford, New York, Oxford University Press, 1996.
Neue Berliner Schachzeitung
Schachzeitung
Jan van Reek, Supertournaments unter
www.endgame.nl/bad1870.htm














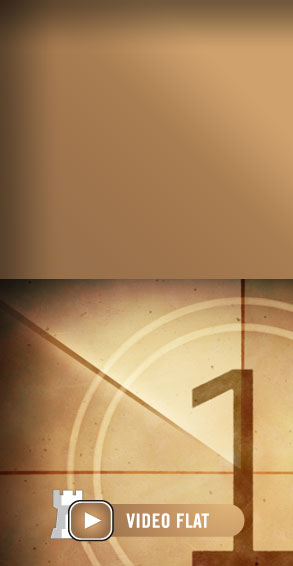
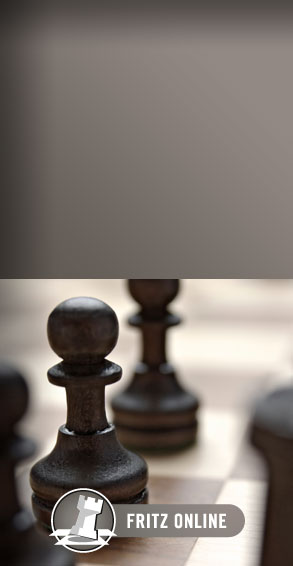


 Treibende
Kraft der Organisation war Ignaz Kolisch, selbst ein starker Schachspieler, der
durch Rothschild gefördert als Bankier reich wurde und später als Mäzen
zahlreicher Schachturniere auftrat. Hermann von Gottschall bezeichnet ihn in
seiner Anderssen-Biographie als "die Seele des ganzen Unternehmens ..., dessen
rastlosen Bemühungen das Zustandekommen des Turniers zu danken war" (Gottschall,
Anderssen, S.351.).
Treibende
Kraft der Organisation war Ignaz Kolisch, selbst ein starker Schachspieler, der
durch Rothschild gefördert als Bankier reich wurde und später als Mäzen
zahlreicher Schachturniere auftrat. Hermann von Gottschall bezeichnet ihn in
seiner Anderssen-Biographie als "die Seele des ganzen Unternehmens ..., dessen
rastlosen Bemühungen das Zustandekommen des Turniers zu danken war" (Gottschall,
Anderssen, S.351.).




