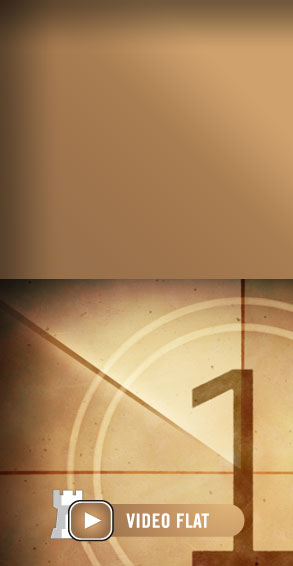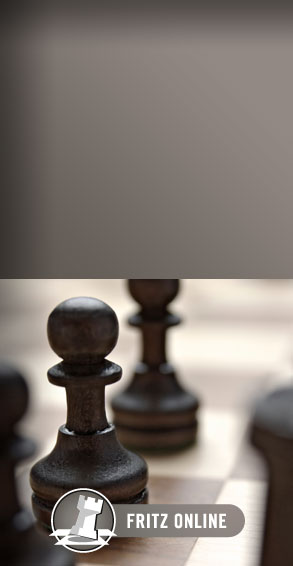Von Martin Hahn
Das Interview erschien zuerst auf Conrad Schormanns Blog "Perlen vom Bodensee" in zwei Teilen. Nachdruck beider Teile mit freundlicher Genehmigung.
Stefan Kindermann: „Ich wollte damals nichts anderes machen, als professionell Schach zu spielen“
Als Stefan Kindermann 1997 zur K.o.-Weltmeisterschaft in Groningen antrat, war er kein Vollprofi mehr. Und doch gelang es ihm, einen der Mitfavoriten aus dem Turnier zu kegeln – ein Karrierehöhepunkt in einer Phase, in der sich der Münchner Großmeister, vielfache deutsche Nationalspieler und gebürtige Österreicher schon neu orientierte.
Heute ist Stefan Kindermann Geschäftsführer der Münchener Schachakademie. Wir haben mit dem 61-Jährigen seine Karriere Revue passieren lassen, nicht nur die schachliche, und ihn zu aktuellen Entwicklungen befragt.
Hier der erste Teil des großen Kindermann-Interviews:

Stefan Kindermann beim Dortmunder Schachturnier 1985. | Foto: privat
Herr Kindermann, im Zusammenhang mit Kasparow-Bezwinger Markus Kappe war unlängst von der Deutschen Jugendmeisterschaft 1977 in Wallrabenstein die Rede. Dort haben mehrere angehende Großmeister mitgespielt, unter anderem Sie.
Ein besonderer Jahrgang. Vier der Teilnehmer wurden später Profis: Eric Lobron, Klaus Bischoff, Ralf Lau und ich. Mir ist das übrigens erst durch die Markus-Kappe-Artikel aufgefallen.
Wie weit nach oben hätte es für Markus Kappe gehen können?
Schwer zu sagen. Von Markus Kappes Partie gegen Kasparow war ich schon sehr beeindruckt. Da hat er in allen Bereichen sehr gut gespielt. Ich wäre damals bei weitem noch nicht in der Lage gewesen, so eine Partie zu spielen. Allerdings ist es grundsätzlich bei jungen Talenten sehr schwierig abzusehen, wie sie sich entwickeln. Das hängt nicht nur vom Talent ab, was immer das sein mag, sondern auch von der Intensität, mit der sie Schach weiterverfolgen, auch wie sie gefördert werden. Ein bisschen Glück gehört ebenfalls dazu. Potenzial hätte Markus Kappe mit Sicherheit gehabt. Mit guter Förderung und wenn er selbst gewollt hätte, hätte er ein starker Großmeister werden können. Mehr als das? Schwer zu sagen.
Wie verlief ihre schachliche Entwicklung?
Ich wollte schon mit 14 Jahren Schachprofi werden. Meine Eltern waren davon nicht so begeistert. Ich stamme von beiden Linien aus einer reinen Akademiker-Familie – Professoren und Ärzte. Nur ich wollte nichts anderes machen, als professionell Schach zu spielen.
Mit 14? Gab es ein Schlüsselerlebnis, ein Vorbild?
Als meine Schachleidenschaft ausbrach, war das genau zur Zeit des WM-Matches Fischer gegen Spasski. Das habe ich damals verfolgt, Bobby Fischer spielte also sicher eine Rolle. Und vielleicht war der Fischer-Boom ja auch ein Grund, warum aus der Generation der U-17-Meisterschaft in Wallrabenstein 1977 so viele starke Spieler hervorgingen. Zur Zeit des Fischer-Spasski-Matches kam ich in einen Schachklub – mit zwölf Jahren leider sehr spät.
1995 haben Sie das Zonenturnier in Ptuj gewonnen, Sie waren für das Interzonenturnier qualifiziert, die Kandidatenturnier-Vorstufe. Leider fand das Interzonenturnier nie statt.
Das wäre mein erstes Interzonenturnier gewesen – ich habe mich so darauf gefreut. Es wäre außerdem das erste Mal gewesen, dass der Deutsche Schachbund einen persönlichen Sekundanten für mich finanziert hätte. Leider kam es zu diesem Turnier nicht mehr, weil durch die Spaltung der Verbände damals die Strukturen im Weltschach auseinandergeflogen sind. Ich habe zwei Jahre vergeblich auf das Turnier gehofft. Man wusste gar nicht, ob es mit dem Qualifikationszyklus überhaupt weitergeht, bis sich herausstellte, dass ich stattdessen an der K.o.-WM in Groningen teilnehmen darf. Diese Phase der Unsicherheit war ein Faktor, der mich veranlasst hat, das Fortführen meiner Schachkarriere zu überdenken.
Die WM in Groningen 1997 haben Sie mit einem Paukenschlag begonnen.

1997 in Groningen. | via „Schach“ 2/1998
Die WM war das erste Turnier, das live im Internet übertragen wurde. Das war neu, aufregend: Jeder Fehler wurde sofort auf der ganzen Welt gesehen und kommentiert. Ich war damals kein Vollprofi mehr, hatte ja schon angefangen, eine NLP-Ausbildung zu machen und eine Coaching-Praxis aufzubauen. Schach habe ich allenfalls noch mit halber Kraft gespielt.
In der ersten Runde wurde ich gegen Alexander Yermolinsky gelost. Der war im Höhenflug, ich glaube unter den Top 20 der Welt. In den USA war er bekannt als „Yerminator“, weil er die ganzen Open-Turniere abräumte. Yermolinsky hatte vorab ein vollmundiges Interview gegeben. Er sagte, die europäischen Großmeister seien den K.o.-Modus nicht gewohnt – anders als die amerikanischen, bei deren Open nach dem Motto „The Winner takes it all“ gespielt wird. Aus diesem Grund hätten die europäischen Spieler gegen ihn keine Chance. Dieses Statement hat mir mentalen Treibstoff gegeben.
Das Match verlief dramatisch. Zum Auftakt habe ich überraschend eine Partie ganz gut gespielt und gewonnen. Vielleicht hatte er mich unterschätzt. In der nächsten Partie hat er allerdings seine Klasse gezeigt und zurückgeschlagen, und es kam zum Schnellschachmatch. Die erste Partie habe ich chancenlos verloren, musste die zweite also unbedingt gewinnen. Es ergab sich ein schwieriges Endspiel mit drei Bauern gegen Springer. Ich gewann und es stand wieder 1:1.
Inzwischen war es elf Uhr abends, und es stand eine Blitzpartie auf dem Programm, in der es um alles oder nichts ging. Ich wusste, es wird in alle Welt übertragen. Vor dieser Partie war ich völlig fertig, ich erzähle das bei meinen Königsplan-Seminaren auch immer: Ich habe zum ersten Mal erlebt, was in so einer Situation den Unterschied ausmacht. Es hat plötzlich bei mir so einen Schalter umgelegt. Ich dachte zuerst, ich wäre völlig daneben und total fertig und kann keinen klaren Gedanken mehr fassen – und plötzlich machte es Klick! Auf einmal hatte ich das Gefühl, ich kann das Brett mit kristallener Klarheit sehen, als ob jede Figur mir zuflüstert, wohin sie möchte. Ich war im Flow, oder wie die Amerikaner sagen: „Being in the zone“.
Auf der anderen Seite ist Yermolinsky zusammengeklappt, ich hatte bereits nach zwölf Zügen eine Mehrfigur. So leicht habe ich selten gewonnen. Das hat mir dann auch Impulse gegeben für die erste Stufe vom Königsplan. Darin geht es ja genau darum, was man tun kann, um eine Partie in Bestform zu beginnen. Dafür hat mich diese Erfahrung sehr beeinflusst.
Allerdings war ich gar nicht darauf eingestellt, die zweite Runde zu spielen. Yermolinsky war mir ja nominell weit überlegen gewesen, ich war kein richtiger Profi mehr und obendrein mangelhaft vorbereitet. Nachdem der Wettkampf so lange gedauert hatte, habe ich anschließend um Mitternacht in einer Kneipe noch gefeiert. Das war natürlich total unprofessionell. Am nächsten Tag saß mir ein ausgeruhter Gegner gegenüber. Der Brasilianer Gilberto Milos war am Tag zuvor viel schneller als ich fertig geworden und hatte sich sogar noch auf mich vorbereitet. Nominell waren wir etwa gleich gut, aber ich habe chancenlos 0:2 verloren und war raus.
Sie sagten, die Unsicherheit rund ums Interzonenturnier sei ein Faktor gewesen, die Profikarriere zu beenden. Was waren die anderen?
Ein zweiter war folgender: Wir hatten damals ja die Supermannschaft mit Bayern München. In 14 Jahren Bundesliga waren wir neun Mal Deutscher Meister. Ende 1994 ist der damalige Sponsor Heinrich Jellissen gestorben, und es stellte sich heraus, dass Jellissen in Wirklichkeit ein Betrüger war, der das Geld aller Leute, die ihm vertrauten, mit sich genommen hatte. Bei mir waren sämtliche Ersparnisse aus meiner gesamten Profizeit weg.
Oje.
Was war ich damals wütend! Ich war ja noch relativ jung, als ich zu Bayern München, anfangs Bavaria München, gekommen bin. Jellissen war für mich eine Vaterfigur gewesen. Ich hatte ihm vertraut – und dieses Vertrauens wurde missbraucht.

„Eine Supermannschaft“: Der FC Bayern München Mitte der 80er-Jahre mit (stehend v.l.) Klaus Klundt, Mäzen Heinrich Jellissen (†), Hans-Joachim Hecht, Helmut Stadler (Leiter der Schachabteilung von Bayern München) , Klaus Bischoff, (sitzend v.l.) Stefan Kindermann, Jörg Hickl, Georg Siegel (†), Helmut Pfleger. | Foto: privat
Und Sie haben das Schachbrett an den Nagel gehängt.
Die Entwicklung hat noch weitere Aspekte. Ein drittes Argument für das Ende meiner Profi-Laufbahn war, dass sich die ökonomische Situation der Schachspieler verschlechtert hatte. Durch die Öffnung des Ostens sind wesentlich besser ausgebildeten Spieler zu den West-Turnieren gekommen. Das System mit den Antrittsgeldern ist dadurch zusammengebrochen. Das waren also gleich drei Ereignisse, die zeitlich ziemlich nah beisammen lagen. Aber letztlich ausschlaggebend für eine Veränderung war für mich, dass ich gemerkt habe, dass ich mich mit rein schachlichen Mitteln nicht mehr weiter verbessern kann. Ich musste auf psychologischer Ebene etwas machen. Dadurch bin ich auf das NLP gekommen, wo ich dann intensiver eingestiegen bin. Ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht, danach den Master. Einige Zeit habe ich selbstständig mit Klienten zu verschiedensten Themen gearbeitet – und merkte, ich habe Talent, mit Menschen zu arbeiten. Schach habe ich zu dieser Zeit nur noch nebenbei ein bisschen gespielt. Ich wollte mir eine eigene Praxis mit einem Klientenstamm aufbauen.
Und dann holte Sie das Schach doch wieder ein.
Ich bekam das Angebot, eine Schach-Internet-AG mitzugründen, die Chessgate AG. Das fand ich spannend, darum habe ich mitgemacht. Ich war dafür verantwortlich, Investorengelder aufzutreiben, und habe die Homepage inhaltlich betreut, das Gesicht von Chessgate sozusagen. Es waren auch andere mit im Boot, Christian Gabriel, Artur Jussupow, Christopher Lutz. Wir hatten auch einen Verlag und haben eigene Bücher gemacht. Aber leider gab es Probleme. Die Vorstellungen der Beteiligten unterschieden sich stark. So wie ich es verstanden hatte, wollten die Investoren es richtig groß aufziehen. Ich meinte schon damals, damit das richtig groß wird, müsste man Hobbyspieler erreichen. Die organisierten Schachspieler sind keine sehr gute Klientel, wenn man wachsen möchte.
Warum?
In Deutschland gab es zumindest damals eine starke Abneigung, für das Hobby Schach als Vereinsspieler Geld zu investieren. Anderswo, beim Tennis oder Golf, ist es normal, dass man im Laufe eines Jahres tausende Euro in sein Hobby steckt. Bei Schachspielern war es zumindest damals so, wenn mehr als 100 Mark bezahlt werden sollten, sei es für Training oder Ausrüstung oder irgendetwas anderes, war das zu viel. Das ist aus Firmensicht natürlich ungünstig. Nach meiner Theorie hat deswegen Schach in Deutschland auch in den Medien keinen höheren Stellenwert. Ich kenne auch fast keinen Vereinsspieler, der sein Hobby nach außen stolz vertritt, der sagt „Hey, ich spiel Schach, das ist eine tolle und spannende Sache!“ Momentan scheint sich aber etwas zu verändern, Schach wird jetzt anders wahrgenommen.
Jedenfalls gab es bei Chessgate verschiedene Vorstellungen und intern unschöne Entwicklungen. Es fiel mir aber schwer auszusteigen, weil das ja auch mit mein Baby war, in das ich zwei, drei Jahre reingepowert hatte. Währenddessen war auch der Aufbau meiner NLP-Praxis wieder in den Hintergrund gerückt. Nach dem Ausscheiden bei Chessgate war ich in den frühen 2000er-Jahren eine Zeit lang etwas am Schwimmen. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen als Profi zu spielen, aber eher halbherzig. Dazu das eine oder andere Buchprojekt.
Dann die Münchner Akademie.
Die Idee entstand gemeinsam mit Gerald Hertneck. Ich habe Roman Krulich gefragt, ob er als Investor mitmachen würde. Dankenswerterweise hielt er es für eine gute Idee und ist eingestiegen. Außerdem gab es noch Dijana Dengler und Ulrich Dirr im Gründerteam, eine tolle Kombination, die super funktioniert hat. Anfangs, in den ersten zwei Jahren nach 2006, haben wir Schachtraining für Erwachsene angeboten. Nach und nach sind dann Ferienkurse für Kinder und Jugendliche dazugekommen, später diese ganzen Schulprojekte. Heute haben wir 15 Trainer, teils freie Mitarbeiter, teils Angestellte. Die Arbeit der Akademie fußt auf drei Säulen: zum einen das traditionelle Schachtraining. Dazu die sozialen Projekte, mittlerweile der größte Bereich, für beispielsweise kranke Kinder, Menschen mit Behinderungen oder bedürftige Senioren. Die dritte Säule ist der „Königsplan“. Dieses Projekt habe ich mit Professor Robert von Weizsäcker entwickelt, es geht darum, wie sich Schach-Strategien fürs Leben nutzen lassen. Ursprünglich war der „Königsplan“ für Führungskräfte ausgelegt. Inzwischen haben wir ihn auf Kinder übertragen. Bei uns ist eben nicht in erster Linie das Ziel, dass Kinder super Schachspieler werden, sondern dass sie fürs Leben etwas mitnehmen. Wobei wir natürlich auch nichts dagegen hätten, wenn eines Weltmeister wird.

Roman Krulich (M.), eingerahmt von Dijana Dengler und Helmut Pfleger. | Foto: David Llada, Schachakademie München.
Aus der Akademie erwuchs die Schachstiftung.
Die hat 2008 Roman Krulich gegründet. Roman hatte uns schon das Risiko-Kapital für die Gründung der Schachakademie gegeben. Von einer Bank hätten wir das sicher nicht bekommen, auch alle Leute aus der Schachszene hatten die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Roman Krulich war der Einzige, der daran geglaubt hat. Er ist bis heute Gesellschafter der Akademie. Er wollte sich schon immer für Kinder und Jugendliche engagieren, trägt bis heute die Verwaltungskosten. Ohne Roman Krulich wäre das alles gar nicht möglich gewesen.
Sehen Sie sich auch als Schach-Promoter?
Durchaus. Unsere Projekte wie der „Königsplan“ sind Mittel, Schachideen über das rein Sportliche hinaus zu verbreiten, ein PR-Werkzeug für Schach, wenn Sie so wollen. Aufzuzeigen, dass Schach etwas für das eigene Planen und Entscheiden bringt, gibt dem Schach ein ganz anderes Standing. Unabhängig davon, dass das in meinem eigenen Interesse ist, sollte dieser Komplex viel stärker in die Öffentlichkeit. Die Vorträge, die ich halte, zeigen, was für ein unglaubliches Potenzial im Schach steckt, dass man Schach im Beruf und generell im Leben brauchen kann. Wenn ich das bei Topmanagern vorstelle, höre ich hinterher oft, dass sie nie gedacht hätten, was im Schach alles drinsteckt und was sich da rausziehen lässt.
Ich fand es immer schade, dass der Schachbund oder die FIDE solche Vorträge nicht intensiver nutzen, um Entscheider zu überzeugen. Eine solche Veranstaltung gab es, 2018 beim Kandidatenturnier in Berlin, über diese Einladung habe ich mich sehr gefreut. Da war dann zum Beispiel Richard Lutz von der Deutschen Bahn, der ein starker Schachspieler ist, sowie Peter Gerber, dem Vorstand von Lufthansa Cargo – auch ein starker und begeisterter Schachspieler. Bei diesen beiden habe ich natürlich offene Türen eingerannt. Es müsste mehr solche Veranstaltungen geben. Die Möglichkeiten, Politiker, Topmanager, potenzielle Sponsoren für Schach zu begeistern, werden meines Erachtens nicht konsequent genutzt. Und das finde ich schade.
Stefan Kindermann: „In Österreich halten sie mich für einen Piefke“

Schacholympiade Dubai 1986, links Stefan Kindermann am ersten Brett für Deutschland, wo er 7,5 Punkte aus 13 Partien erzielte. Außerdem (v.l.) Klaus Bischoff, Hans-Joachim Hecht (stehend), Jörg Hickl (verdeckt) und Detlef Heinbuch. | via Wikipedia
Herr Kindermann, warum spielen Sie unter österreichischer Flagge?
Ich bin gebürtiger Österreicher, kam allerdings schon als Einjähriger mit meinen Eltern nach Deutschland. Wenn ich jetzt in Österreich bin, halten sie mich für einen Piefke. Ich kann leider gar kein Wienerisch. Meine Schachjugend, meine Schach-Ausbildung waren deutsch. Trotzdem hätte ich früher schon für Österreich gespielt, aber damals, als ich die Verhandlungen mit dem Österreichischen Schachbund führte, wurde Schach dort absolut nicht professionell gesehen. Selbst für Teilnahmen an Schacholympiaden hätte es keinerlei Honorar gegeben. Als Profi konnte ich das ja schlecht mitmachen. Im Lauf der Jahre habe ich sechs Schacholympiaden für Deutschland gespielt.
Als ich später nicht mehr richtig Profi war und auch nicht mehr stark genug für die deutsche Nationalmannschaft, hatte sich das Schach in Österreich stark professionalisiert. Also habe ich wieder den Kontakt gesucht. Der Wechsel verlief unproblematisch, ich bin ja österreichischer Staatsbürger. Dann habe ich noch zwei Schacholympiaden und einige europäische Mannschaftswettbewerbe für Österreich gespielt. Kürzlich erst bin ich im Online-Schach österreichischer Vizemeister geworden. Darauf bin ich stolz. Die gesamte österreichische Olympiamannschaft war am Start – inklusive Markus Ragger. Dass ich nur Vizemeister wurde, war sogar Pech. In der letzten Runde hätte mir ein Remis gereicht. Ich stand minimal besser und lag auch gut in der Zeit. Dann ist mir ein klassischer Mouse-Slip unterlaufen: Er schlug eine Figur von mir, ich wollte zurückschlagen, aber meine Dame ist leider ein Feld vorher stehengeblieben. (lacht)
Das ist selbst Magnus Carlsen neulich passiert …
Ja, Carlsen sagte ganz entspannt, das gehöre dazu beim Online-Schach.
Aktuell ist Arkadij Naiditsch in den Schlagzeilen. Er will von der aserbaidschanischen Föderation zurück zur deutschen wechseln und wieder unter deutscher Flagge spielen, was bisher abgelehnt wurde. Haben Sie dazu eine Meinung?
Bei Naiditsch war das Problem, dass er eine recht kontroverse Persönlichkeit war, dass es da offenbar sehr starke Spannungen gab, zumindest mit den Funktionären. Ich kann nicht sagen, wie ich mich dazu positionieren würde. Grundsätzlich ist es sehr gut, wenn das Team gestärkt wird. Die Frage ist dann halt, wie die Verträglichkeit im Team ist. Wenn jetzt die anderen Nationalspieler zum Beispiel sagen würden, sie fänden es auch gut, wenn Naiditsch wieder ins Team kommt – warum nicht.
Wie sehen Sie unabhängig von dieser Personalie die Perspektiven der deutschen Nationalmannschaft, vor allem von der jüngeren Spielergeneration?
Matthias Blübaum und Alexander Donchenko sind offenbar sehr stark geworden. Mit Vincent Keymer wartet natürlich noch im Hintergrund ein großes Talent, wobei die einzelnen Spieler natürlich schon weiter sind in ihrer Entwicklung. Aber wie weit es noch nach oben geht, das wäre wirklich ein Blick in die Kristallkugel. Allerdings: Um absolute Super-Großmeister zu werden, sind Blübaum und Donchenko aus meiner Sicht fast schon zu alt. Trotzdem, möglich ist alles.

Auf Aruba hatte der Schachmäzen Joop van Oosterom 1992 ein Trainingsturnier für die Polgar-Schwestern organisiert. Mit von der Partie: Stefan Kindermann. Den verband eine Freundschaft mit den Polgars, nachdem er in Budapest gemeinsam mit Judit trainiert hatte. „Superkonditionen für die Teilnehmer, alles sehr luxuriös. Ich wurde beim Turnier Vierter, damit war ich zufrieden. In diesem traumhaften Ambiente habe ich über meine Verhältnisse gespielt“, sagt Kindermann. | Foto: privat

Gentleman Kindermann | Foto: privat
Ihre Schachakademie befindet sich in München – wo die Schach-WM 2023 ausgetragen werden könnte. Was haben Sie davon gehört?
Soweit ich weiß, gab es im Stadtrat vor einigen Jahren einen Antrag, eine Schach-WM nach München zu holen. Wer dahinter stand, war sehr unklar, und das wurde damals abgelehnt, soweit ich weiß. Darüber hinaus kann ich auch nichts sagen. Der Münchner Oberbürgermeister ist der Schirmherr unserer Schachstiftung, ich habe aber trotzdem nichts Neues gehört. Wir würden uns über eine WM in München natürlich freuen.
Wenn Sie hier eine Ihrer Partien zeigen könnten, welche wäre das?
Meine Lieblingspartie habe ich sogar erst vor relativ kurzer Zeit gespielt, aus meiner Sicht die beste Partie, die ich je gespielt habe. Mir gelang es, 16 Züge vorauszurechnen.
Kindermann, Stefan2506 - Sarkar, Justin2297, 4th Int. Chess Festival ad Gredine Open (6.8)
21. Juni 2018 Ortisei - St. Ulrich, Kommentiert durch Stefan Kindermann
Nach 1.d4 Sf6 erscheint der Zug 2.Lg5 ebenso kühn wie exotisch. Kein anderes modernes Eröffnungssystem führt so schnell zu spannenden Positionen, verlässt so bald theoretische Pfade und setzt den Schwarzen dennoch unter massiven Druck.
Sie machen auch Eröffnungsvideos. Woher nehmen Sie die Themen?
Das sind meine. Ich diskutiere natürlich mit den verantwortlichen Leuten bei ChessBase, denn die müssen ja beurteilen, ob mein Vorschlag ein Thema fürs Publikum ist. Nachdem ich ja selbst nicht mehr so im Schach drin bin, muss es ein Thema sein, von dem ich etwas verstehe. Ich hätte gar nicht die Zeit, mich zum Beispiel in eine Najdorf-Variante einzuarbeiten, das wäre nicht seriös, da bin ich kein Top-Experte. Es aber gibt ein paar Eröffnungen, in denen ich mich noch ganz gut auskenne.
Georg Meier sagte neulich über die Französische Verteidigung:
„Würde ich heute nochmal mit Schach anfangen, würde ich nicht e4 e6 spielen, sondern e4 e5, klassische Eröffnungen. Ums Zentrum kämpfen und so weiter. Die klassischen Kasparow-Karpow-Partien im Spanier würde ich nicht nur studieren, sondern mich auf diesem Gebiet selbst entwickeln wollen. Natürlich kannst du mit Französisch ein Level von 2650 oder 2700 erreichen, aber wenn du gegen die Besten der Welt spielst, ist Französisch ein Handicap. Sobald sie sich auf dich eingeschossen haben, zeigen sie dir, deine Eröffnung ist minderwertig. So war das auch mit meinem Franzosen. Der funktionierte wunderbar, bis ich anfing, regelmäßig gegen 2700+-Leute zu spielen.“
Was sagen Sie als Französisch-Anhänger dazu?
Französisch ist ja meine große Liebe seit vielen Jahren, ich bin einer von vielen Französisch-Fans. Mein Wissensstand ist, wenn man Französisch mit den modernen Supercomputern analysiert, dann wird es sicher etwas schlechter bewertet als zum Beispiel Berliner Mauer oder Najdorf. Und tatsächlich wird Französisch in der Weltspitze ja sehr selten eingesetzt, es gibt ja im Prinzip zurzeit niemanden, der Französisch als Hauptwaffe einsetzt. Es kann also sein, dass es etwas schwächer ist als Najdorf oder Berliner Mauer.

Mit Uschi Glas 2015. | Foto: privat
Meier sagt, dass es gegen 2700er schwer zu spielen ist. Der Punkt ist, dass man mit Schwarz gegen Top-Elite-Spieler mit jeder Eröffnung Probleme hat (lacht). Ich bin überzeugt, dass auch Georg Meier, wenn er frühzeitig zum Beispiel Spanisch oder was auch immer mit Schwarz gelernt hätte, trotzdem Probleme hätte gegen Top-Elite-Spieler. Vor allem ist es heutzutage problematisch, wenn man berechenbar ist, also wenn man praktisch nur eine Eröffnung im Repertoire hat. Das scheint mir auch Meiers Hauptpunkt in dem Interview gewesen zu sein. Ich kenne das Problem sehr gut, bin natürlich nicht auf dem Level wie Meier, aber in der Bundesliga habe auch ein paar Jahre gegen Leute um 2650 Elo gespielt – mit eben diesem Handicap.
Komischerweise ist Französisch in gewisser Weise eine deutsche Verteidigung. Wolfgang Uhlmann war mit der berühmteste Französisch-Spieler, dann Gerald Hertneck und ich selbst, jetzt die jüngere Generation, Georg Meier, Matthias Blübaum, Rasmus Svane, alle haben intensiv Französisch gespielt. Rainer Knaak darf man nicht vergessen, er ist auch ein großer Franzose. Der legendärste Franzose war natürlich Viktor Kortschnoi. Aber der hatte eben als absoluter Weltklassespieler ein viel breiteres Repertoire. Französisch war nur ein Teil davon.
Wie kam es zu Ihrer Vorliebe für Eröffnungen wie Holländisch oder Französisch, die ja beide nicht zu den superseriösen zählen?
An meine Holländisch-Anfänge erinnere ich mich nicht mehr genau. Aber bei Französisch weiß ich es noch. Das war so Mitte/Ende der 80er-Jahre. Ich war ja e4-Spieler und hatte gegen Französisch immer Probleme. Das hat mich dann so genervt, dass ich dachte, es wäre doch eine Idee, das jetzt auch mal selbst mit Schwarz zu spielen und mir von meinen Gegnern zeigen zu lassen, was man dagegen macht. Meine Gegner haben mich allerdings niemals überzeugt, deshalb bin ich bei Französisch geblieben.
Genau so ging es mir auch mit meinen Französisch-Anfängen, wenngleich natürlich ungefähr tausend DWZ-Punkte unterhalb von Ihnen...
Und, zufrieden mit Französisch?
Ja, mit vereinzelten Ausnahmen bin ich sehr zufrieden damit. Ich spiele es vor allem gegen Leute, von denen ich weiß, dass sie mit Weiß von Französisch genervt sind.
Bei mir ist natürlich ein Schwachpunkt, dass ich aktuell gar keine Zeit mehr habe, mich mit Theorie zu beschäftigen und dadurch sehr unflexibel bin. Das ist in der 2. Bundesliga schon ein Nachteil, wenn man nichts anderes spielen kann als zum Beispiel Französisch. Die Gegner können sich drauf einschießen. So eine Eröffnung hat mehr Effekt, wenn sie überraschend kommt. Bei Holländisch war es früher teilweise so, dass die Weiß-Spieler regelrecht entnervt waren. Jeder hat irgendeinen Eigenbau gespielt, der nicht gut war. Inzwischen ist das für die Schwarzen ein bisschen schwieriger geworden. Lustig finde ich, dass Holländisch sehr starke Emotionen auslöst. Es gab oder gibt viele Topspieler, die eine richtige Verachtung oder einen Hass auf Holländisch empfinden, das berühmteste Beispiel war Viktor Kortschnoi. Aber auch mein Mannschaftskollege Nigel Short hat mir zum Beispiel schon Vorträge gehalten, wenn er gesehen hat, dass ich Holländisch gespielt habe. Vor allem über die Leningrader Variante sagt er, das könne man nicht spielen.
Aber er spielte doch selber mal Holländisch, zum Beispiel im Kandidaten-Wettkampf 1991 gegen Jonathan Speelman?
Ja, eine Zeit lange spielte Nigel Holländisch, aber nur Stonewall. Heutzutage glaube ich auch, dass Stonewall solider ist als Leningrader. Leningrader ist trotzdem spielbar, aber schwierig, man kann es kaum standardisieren.
Auf dieser DVD werden wir in Form von sieben klaren Kriterien die entscheidenden Voraussetzungen für jeden erfolgreichen Königsangriff genau betrachten und daraus die optimalen Angriffs-Strategien ableiten.
Wie Stefan Kindermann die Kunst des Königsangriffs beherrscht, lässt sich anhand der oben kommentierten Partie nachvollziehen.
2010 veröffentlichten Stefan Kindermann und Robert von Weizsäcker den „Königsplan„, der den Lesern ermöglichen soll, Denkstrategien aus dem Spitzenschach in Beruf und Privatleben zu nutzen. Später erschien das Thema auch als DVD:
Stefan Kindermann erklärt, wie man allgemeine Regeln im Leben wie im Schach gleichermaßen mit Erfolg anwenden kann.
Unter seinem Pseudonym „Nathan Rihm“ hat der Autor Martin Hahn bereits zwei Gedichtbände veröffentlicht. Mehr über ihn auf der Nathan-Rihm-Fanpage bei Facebook. Kontakt: nathanrihm@gmx.de