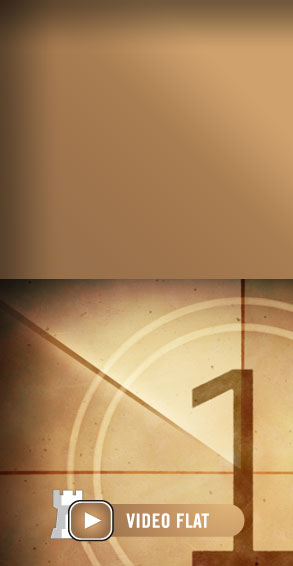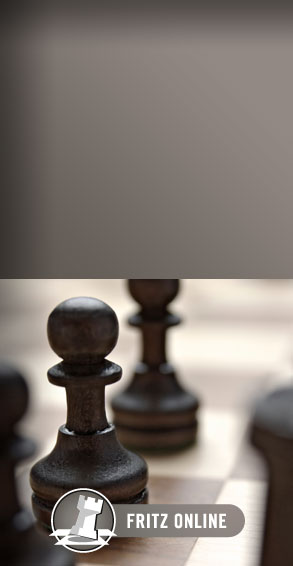Aufschlussreiches Gespräch mit 75jährigen
Schachpädagogen Dr. Ernst Bönsch
Von Dagobert Kohlmeyer
Ernst Bönsch ist ein
Mann mit vielen Facetten. Der Schachtrainer, Buchautor, Wissenschaftler und
Internationale Schiedsrichter feiert am 19. Juni seinen 75. Geburtstag. Er
lehrte Schach in der DDR, zuerst in Halle/Saale, wo er lebte, dann im
Landesmaßstab. Nach der Wende unterrichtete Bönsch senior sozusagen weltweit,
auch Kids an der High School in New York sowie Lehrerinnen und Lehrern an
Kreativitätsschulen. Mit seiner 1977 verfassten Dissertation „Untersuchungen
über die didaktisch-methodische Gestaltung der Schachausbildung unter
besonderer Berücksichtigung der spieltheoretischen Entwicklung des
Schachsports“ begründete der Vater von Bundestrainer Uwe Bönsch eine neue
trainingsmethodische Grundkonzeption. Ernst Bönsch ist auch Koordinator an
der internationalen Berliner FIDE-Trainerakademie. Genug Gründe, um mit dem
Jubilar ein ausführliches Interview zu führen.

Ernst, du bist 75
Jahre und kein bisschen leise. Wie verbringst du deinen Ehrentag?
Es geht weit weg, nach
Asien. Zuerst nach Hongkong. Dort gibt es eine Schachschule, die ich besuchen
werde. Anschließend nach Singapur. Auch dort ist eine relativ neue asiatische
Schachschule. Und ich will einmal sehen, inwieweit es Prallelen zu unserer
Trainerakademie in Berlin gibt.
Was hat dir das
Schach in all den Jahren gegeben?
Ich hatte das Glück,
mein Hobby zum Beruf machen zu können. Darum war ich tatsächlich ein Leben
lang mit dem Schach verbunden. Ich glaube, ich würde noch mal Schachtrainer
werden, denn mir hat es ja unheimlich viel gegeben. Vorteile sind, dass man
sich vor allem ganz stark diszipliniert, wenn man Schach spielt. Nicht nur,
dass man sich konzentriert, sondern dass auch viele Fähigkeiten entwickelt
werden, die man im Leben verwenden kann.
Welche
Freundschaften haben sich in Jahrzehnten entwickelt?
Stolz bin ich zum
Beispiel auf die langjährige Freundschaft mit Michail Tal, den ich als
Weltmeister und phantastischen Spieler sehr verehre. Er ist ein großartiger
Mensch gewesen. Wir trafen uns in der DDR, in Moskau und auch in Riga
gemeinsam mit seinem Trainer Koblenz, der ja als Schachautor ebenfalls sehr
aktiv war.
Wir kennen uns 25
Jahre. Trotzdem bin ich verblüfft, wie vielseitig dein Leben verlief und wie
viele neue Informationen zur Zeitgeschichte des Schachs Gespräche mit dir
hervorbringen. Wenn ich es richtig verstehe, dann verging dein Berufsleben
wie im Fluge, denn die letzten fünfzig Jahre konntest du dich durch die
Tätigkeit als Klub- und Verbandstrainer in der DDR und jetzt ehrenamtlich als
A-Lizenztrainer täglich mit Schach beschäftigen.
So ist es. Darüber
hinaus gelang es mir, 1982 an der Deutschen Hochschule für Sport in Leipzig,
erstmals eine Spezialausbildung im Fach Schach einzuführen. Prominente
Absolventen FM Jörg Pachow und WIM Martina Beltz (Keller) sind heute
erfolgreich als Trainer tätig. Seit 1997 Mitglied der zentralen
Lehrkommission des DSB, war ich besonders für die Erarbeitung der
Grundsatzmaterialien wie den Rahmentrainingsplan (RTP) und die
Rahmenrichtlinien zur Trainerausbildung des DSB verantwortlich. Im Jahr 2000 erschien das Buch
„Schachlehre-Schachtraining“ in gemeinsamer Arbeit mit meinem Sohn Uwe. Ich
bin in der A-, B- und C-Trainer Aus- und Weiterbildung im Deutschen
Schachbund tätig.

Uwe Bönsch
Glückwunsch zum
neuesten Erfolg im Wettbewerb der DSB-Ausbildungs-Offensive, den dein
Landesverband Brandenburg 2005 dank deiner hohen Anzahl von 46 Lehrstunden
gewann! Aber beginnen wir von vorn. Wann begann Deine Schachlaufbahn?
Das war kurz nach Ende
des Zweiten Weltkrieges in der bittersten Zeit meines Lebens im damaligen
Sudetenland, dem heutigen Nordböhmen.
Wäre es dir
möglich, darüber zu sprechen?
Das ist nicht so leicht.
Als Vierzehnjähriger musste ich als Deutscher, gekennzeichnet mit einer
weißen Armbinde, täglich früh bis spätabends auf dem Feld zwangsweise hart
arbeiten. Der Vater war interniert in einem tschechischen KZ in der
Kreisstadt Chomutov, die Mutter ohne Arbeit und Geld. Mühle und Haus meiner
Eltern wurden enteignet, und jeden Tag hatten wir Lebensangst. Und das alles
nur, weil wir Deutsche in einem Land waren, das, seit ich denken konnte,
unsere Heimat war. 1946 wurden wir in Strupcice evakuiert und in offenen
Waggons ins „Deutsche Reich“ transportiert. Abwechselnd ging ein Zug nach
Bayern und einer nach Sachsen. Wir wurden ins Quarantänelager Torgau in
Sachsen gebracht. Während der langen Fahrt mit vielen Zwischenhalten auf
Abstellgleisen zeigte mir ein ehemaliger Schulkamerad auf seinem winzigen
Reiseschach, wie man Schach spielt. Wir hatten ausgiebig Zeit, und mir gefiel
das Spiel immer mehr, schließlich tauchten wir dabei in eine andere, weniger
grausame Welt.
Wie verlief der
Start in deinem neuen Leben?
In meinem späteren
Zielort, der Stadt Halle/Saale, schloss ich mich der dortigen
Schachgemeinschaft „Stahl Halle“ an. In der Folge wurde ich mehrfacher
Hallescher Jugendmeister. Meine stärksten Widerparte waren Günther Rubant
(später Prokurist bei Rubber Maid in Dreieich), Dr. Hartmut Badestein
(Jura-Professor in Berlin) und Dr. Hans Werchan (Vizepräsident von
Sachsen-Anhalt). Als damals jüngster Spieler erhielt ich einen festen Platz
in der Männer-Oberliga. Meine Mannschaftskameraden im Verein baten mich, am
Demobrett unsere Partien auszuwerten und bald wurde ich im Verein
verantwortlich für das Jugendtraining gemacht. Wir begannen, unsere
Partiezettel aufzuheben, um die Spiele analysieren zu können. Die Grundlagen
für ein gemeinschaftliches Training und der Start für eine Trainertätigkeit
waren gegeben. Mein erstes Lehrbuch war übrigens die siebzehnte Auflage des
kleinformatigen „Dufresne“. Als 18jährigen Jugendleiter wurde mir die
Nachwuchsarbeit für alle Vereine der Stadt Halle übertragen. Weil ich
allgemein sportlich interessiert war, nebenbei aktiv Handball spielte und
boxte, delegierte mich der Kreisfachausschuss Schach an die Leipziger
Hochschule für Körperkultur und Sport: als ersten Schachspieler!
Wurde an der
Hochschule Schachspielen als Sportart akzeptiert?
Zu dieser Zeit musste
man nicht nur an einer Sporthochschule gegen solche Vorurteile kämpfen. Sport
wurde mit dem Begriff der körperlichen Bewegung gleichgesetzt. Zutreffender
definierte ich den Sport in Artikeln und Seminaren vom Gedanken des
Wettkampfes her. Außerdem gründete ich eine Sektion Schach, organisierte
Blitzturniere und Vergleichskämpfe zwischen Lehrkräften und Studenten,
spielte Nah- und Fernschachkämpfe u.a. gegen die Sporthochschule/Universität
Köln. Man nannte mich „den Schachspieler“ und das hieß, auch in anderen
Sportarten meinen Mann zu stehen. Aktiv spielte ich Rugby, war im Sturm beim
„angeordneten Gedränge“ Hakler, und wurde mit meiner Mannschaft Deutscher
Meister. In fünfzehn verschiedenen Sportarten vom Fußball, Boxen, Schwimmen …
bis zum Wintersport sowie acht theoretischen Fächern wie Pädagogik,
Sportmedizin etc. musste das Staatsexamen ablegt werden. Diese umfassende
Ausbildung befähigte mich, Grundzüge der Theorie von Strategie und Taktik in
mehreren Sportarten zu verstehen, was ich später gut für meine
trainingsmethodische Grundkonzeption im Schach verwerten konnte. Mit dem
Thema “Zur Methodik des Schachspiels – Ein Beitrag für den außerschulischen
Kindersport“ (1955) gelang es mir, erstmals eine Diplomarbeit auf dem Gebiet
des Schachs zu schreiben (Prädikat „Sehr gut“).
Wie ging es nach
dem Studium weiter?
Obwohl ich gern Trainer
in Halle geworden wäre, verpflichtete mich die staatliche Absolventenlenkung
an die Verwaltungshochschule/Universität Potsdam. Dort arbeitete ich als
Diplomsportlehrer im Studentensport und gründete einen Schachverein. 1956
wurde ich Bezirksmeister von Potsdam. Die damaligen Verantwortlichen im
Präsidium des Deutschen Schachverbandes der DDR, Horst Rittner
(Geschäftsführer und Fernschachweltmeister) und Hans Platz (Nationaltrainer),
wurden auf mich aufmerksam. Aufgrund meiner schachlichen und
allgemeinsportlichen Kenntnisse sollte ich als Geschäftsführer/Referent im
Präsidium des Deutschen Schachverbandes in Berlin arbeiten. Da die
Schreibtischarbeit nicht meinen Intentionen entsprach, nutzte ich nach einem
Jahr, also 1957, die Chance als Clubtrainer in meiner Heimatstadt Halle einen
Leistungsschwerpunkt im Schach aufzubauen. Diese Tätigkeit übte ich mit
großem Einsatzwillen zwanzig Jahre lang aus.

Ernst Bönsch als junger Trainer mit Hallensern Spielern
Was war dein
Aufgabenfeld in Halle?
Ich hatte das große
Glück, mich mit Unterstützung des Sportclubs Wissenschaft/Chemie auf
leistungssportliche Arbeiten konzentrieren zu können. Zur damaligen Zeit gab
es mit SC Einheit Dresden, AdW Berlin, SG Leipzig und Wissenschaft/Chemie
Halle vier Leistungszentren, die spezielle staatliche Förderungen erhielten
und das Grundgerüst für die Nationalmannschaften Männer und Frauen bildeten.
Mein Aufgabengebiet im Sportclub (später Chemie Buna) Halle war vielseitig
und reichte von der Betreuung der Männer- Frauen- und Jugendmannschaften bis
zur Organisation von Turnieren und internationalen Clubkämpfen. Mit meinen
Mannschaften errang ich zahlreiche Deutsche Meistertitel bei den Erwachsenen
und Jugendlichen. Im Frauenschach waren wir Abonnement-Mannschaftsmeister.
Was waren deine
größten Trainererfolge?
Bei den sieben Einsätzen
zu Schacholympiaden der Frauen und Männer erkämpfte die Nationalmannschaft
Damen dreimal die Bronzemedaille 1957 in Emmen, 1963 in Split und 1966 in
Oberhausen. Das Frauenteam zählte dadurch zur Weltspitze. Nach dem fatalen
Leistungssportbeschluss 1972 ermutigten mich als nunmehr verantwortlichen
Verbandstrainer und Kapitän der NM-Mannschaft die 13 Siege in offiziellen
Länderkämpfen gegen Polen, ČSSR, Ungarn, Bulgarien und Frauen Rumänien sowie
die Bundesrepublik Deutschland in Potsdam 1988. Heute bin ich stolz auf die
Rüdersdorfer Mädchen, die ich von Beginn an, seit ihrem zehnten Lebensjahr,
von 1996 bis 2002, betreute. Sechs Jahre lang trainierten sie diszipliniert,
legten Wettkampfbuch und Eröffnungskartei an und wurden später Deutscher
Mannschaftsmeister.
Wie gelangen diese
Erfolge?
Vielleicht versuche ich
die Antwort erst einmal für das Frauenschach, zumal die drei Bronzemedaillen
ein beachtlicher Fakt waren. Über Jahre hinweg galt es zuvor, dem
Frauenschach innerhalb des eigenen Verbandes Achtung zu verschaffen, denn die
Männer blickten immer ein bisschen auf Frauen herab. Es gelang mir
durchzusetzen, dass Frauen bei Top-Events mitspielen konnten. Zunehmend
wurden sie auch in ersten Männermannschaften aufgestellt. Ihre erforderliche
Partienanzahl gegen starke Gegner erhöhte sich. Ein Paradebeispiel war Edith
Keller-Hermann, die bald als stärkste deutsche Frau den Schachsport in der
Welt zu repräsentieren begann.

Zu Besuch bei Edith Keller-Herrman
Außerdem bemühte ich
mich methodisch um einen langfristigen Leistungsaufbau. Ich nahm die Mühe in
Kauf, mit jeder Spitzenspielerin einen Individuellen Trainingsplan (ITP)
aufzustellen und im persönlichen Gespräch die unterschiedlichen
Trainingsanforderungen und Wettkampfeinsätze zu beraten. Rechtzeitig vor den
Hauptwettkämpfen (Olympiaden) suchte ich die potentiellen Gegnerinnen aus
Zeitschriften und Bulletins heraus und fertigte Spielerdateien an, manuell.
Elektronische Datenbanken gab es zu jener Zeit noch nicht. Lehrgänge waren zu
organisieren und Freistellungen durchzusetzen. In den 60er Jahren freundete
ich mich mit dem rumänischen Nationaltrainer der Frauen und späteren
DSB-Bundestrainer Sergiu Samarian an. Wir tauschten trainingsrelevante
Informationen, unter anderem Turnierbulletins aus. Zusammen bauten wir eine
internationale Kartei mit Repertoires von Spitzenspielerinnen auf.
Schließlich nutzte ich die UWV-Phase, die Zeit unmittelbar vor dem Wettkampf.
In einem Intensivlehrgang wurde schwerpunktmäßig das Eröffnungsprogramm der
Spitzenmannschaften mit Weiß und Schwarz studiert und das eigene Repertoire
aktualisiert. Auch Trainingspartien gegen Männer gehörten zum
Vorbereitungsprogramm. Ungemein wichtig war es inmitten internationaler
Wettkämpfe, die Spielerinnen immer wieder zu ermutigen, nach Niederlagen
aufzurichten und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Gründliche Auswertungen,
vornehmlich der Verlustpartien, gehörten zum Standard im Heimtraining.
Die Anforderungen
an deine Tätigkeit gingen also weit über das rein schachliche Training
hinaus?
Als Trainer war ich
Mannschaftskapitän, Sekundant, Delegationsleiter, Betreuer, Schiedsrichter
und Manager. In den zwanzig Jahren als Klubtrainer in Halle und Trainer für
die NM Frauen betreute ich Aktive bei nationalen und internationalen
Meisterschaften, Einladungsturnieren, internationalen Länder- und
Clubkämpfen, leitete NM-, Nachwuchs- und Übungsleiterlehrgänge sowie
Lehrkonferenzen, nahm an Verbandstagen, Präsidiums- und Bürotagungen teil,
führte die Kommission Leistungssport und den Trainerrat. Da es immer an
finanziellen Mitteln fehlte, musste ich je nach Wettkampfform und
Notwendigkeit andere Aufgaben mit wahrnehmen. Die Einsätze zu den
Qualifikationswettkämpfen für die Weltmeisterschaft, zyklischen Zonen-,
Interzonen- und Kandidatenturnieren waren ungemein zeitaufwändig. Allein das
Kandidatenturnier 1967 in Subotica, wo ich Waltraud Nowarra betreute, dauerte
31 Tage. Damals gab es ja noch überwiegend Rundenturniere mit
Hängepartien-Tagen statt Schweizer System und K.-o.-Turnieren.
Als langjähriger
Trainer trifft man mit vielen Persönlichkeiten im Schach zusammen und du
hattest das Glück, einige Weltmeister persönlich zu kennen…
Es ist schon etwas
Erhebendes, klassische Weltmeister nicht nur aus den Geschichtsbüchern,
sondern persönlich kennen gelernt zu haben. Von den 17 mir bekannten
Champions erlebte ich Dr. Max Euwe, Dr. Michael Botwinnik, Wassili Smyslow,
Tigran Petrosjan, Boris Spasski, Bobby Fischer, Garri Kasparow, Alexander
Khalifman, Viswanathan Anand und die Frauen Olga Rubzowa, Jelisaweta Bykowa,
Nona Gaprindaschvili, Maja Tschiburdanidse, Zsuzsa und Judit Polgar bei
Olympiaden und Turnieren am Brett. Anatoli Karpow kannte ich nicht zuletzt
durch unsere Schachschule im Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin gut.
Michael Tal, seinen Trainer Alexander Koblenz und mich verband durch die
häufigen Aufenthalte und gemeinsamen Erlebnisse in Deutschland und Riga eine
Freundschaft über viele Jahre.

Beim FIDE-Seminar 1986 in Leningrad mit Lothar Schmid und dem späteren
DSV-Präsidenten Dr. Michael Schmidt
Und wie war es als
Spieler? Wie ich hörte, durfte man früher als Trainer nicht mehr aktiv
spielen?
Das stimmt. Nach dem
Einstieg als hauptamtlicher Trainer, war es leider nicht mehr möglich, ein
Turnier oder eine Meisterschaft (Einzel und Mannschaft) wettkampfmäßig zu
spielen. Eine solche Order, wie es sie im DDR-Sport für professionelle
Trainer in allen Sportarten gab, war im internationalen Schach undenkbar.
Deshalb zeigten bei uns Spitzenspieler wenig Interesse an einer
Trainerlaufbahn. Wolfgang Uhlmann verstand es beispielsweise geschickt,
solche Angebote abzuwehren. Trotz des Verbots suchte jeder Klubtrainer eine
Nische, nämlich als Ersatzspieler bei den ersten Mannschaften, die wir
ohnehin als Kapitän zu den Sonderliga-, später Oberligarunden begleiteten.
Hohe Wertzahlen konnte man bei diesen sporadischen Einsätzen nicht erreichen.
Ich kam mit den raren Partien auf eine Wertzahl von 2280. Aus
Trainingsgründen spielte ich Fernschach, vor allem um das
Eröffnungsrepertoire zu stabilisieren und freute mich über ein Remis gegen
Weltmeister Jakow Estrin beim Eberhard-Wilhelm-Cup. In dieser Situation
konnte man nur nach dem Grundsatz „Wer lehrt, der lernt“ als Trainer
bestehen.
Das Jahr 1972
brachte einen Einschnitt im DDR-Sport und damit auch für dich als
Leistungssporttrainer. Was steckte eigentlich hinter den Beschlüssen?
Über Nacht durften wir
nicht mehr zu offiziellen FIDE-Veranstaltungen fahren, ob nach Westen oder
Osten, das spielte keine Rolle. Es betraf nicht nur Olympiaden, sondern auch
Zonenturniere, Interzonenturniere, Kandidatenwettkämpfe, Jugend- und
Studentenweltmeisterschaften sowie Turniere in westlichen Ländern. Dies
reglementierte ein wie folgt begründeter Beschluss der DTSB-Sportführung: Die
DDR sei als kleines Land ökonomisch nicht in der Lage, alle Sportarten
gleichermaßen zu fördern. Deshalb müsste zwangsläufig auf die
medaillenintensiven olympischen Disziplinen orientiert werden. Alle
nichtolympischen Verbände, auch solche mitgliedsstarken Sportverbände wie
Tischtennis, Tennis, Basketball (insgesamt 25!), wurden ausnahmslos von der
internationalen Bühne verbannt – unabhängig von ihrem Leistungsniveau, selbst
eine Sportart wie Kegeln, die in der Disziplin Asphalt gerade Weltmeister
geworden war. Auch im Schach waren wir zu dieser Zeit recht erfolgreich.
Waltraud Nowarra und Wolfgang Uhlmann kamen bis in die Kandidatenwettkämpfe
während sich Brigitte Burchardt und Petra Feustel bereits im neuen WM-Zyklus
für das Interzonenturnier der Frauen qualifizierten. Da dieses Turnier 1976
in der östlichen Stadt Tbilissi stattfand, durften beide als große Ausnahme,
nochmals teilnehmen, damit der Qualifikationszyklus beendet werden konnte.
Das Komplizierte im damaligen Deutschen Schachverband war, dass er in sechs
internationalen Föderationen integriert war: FIDE, ICCF, IBCA, ICSC, IGF und
WDCF. Die Ausnahmen wurden unterschiedlich begründet. Bei
Fernschach-Olympiaden der International Correspondence Chess Federation
mussten die Spieler nicht reisen. Bei Weltmeisterschaften der Sehgeschädigten
in der International Braille Chess Association und der Gehörlosen im
International Committee of Silent Chess ließ man die Versehrtensportler aus
sozialen Gründen gewähren. Die Go-Spieler in der International Go Federation
und Dame-Spieler der World Draughts and Checker Federation durften ebenfalls
nicht an Weltveranstaltungen teilnehmen. Im Fernschach ergab sich später der
kuriose Fakt, dass die Mannschaft der DDR in der erst 1995 abgeschlossenen X.
Fernschacholympiade noch die Bronzemedaille gewann, als das Land längst nicht
mehr existierte.
Spitzenleistungen im
Schach beeindruckten die Sportleitung kaum. Stattdessen wurde national der
Breitensport zum Ziel erklärt. Damit verband sich eine Kette von
einschneidenden Folgen wie geringere finanzielle Zuwendungen, Abbruch der
Förderung von talentierten Anschlusskadern, bis auf wenige Ausnahmen
untersagte Teilnahme an Wettkämpfen in westlichen Ländern, keine Aufnahmen
von Talenten in die Kinder- und Jugendsportschulen, Einschränkung des
Altersklassensystems bei den jüngeren Jahrgängen, Verwehren von Lehrgängen an
zentralen Sportschulen, Einschränkungen für Freistellungen u.a.m. Weder
Argumente, Petitionen noch Anträge konnten an diesem Beschluss, der einer
Beleidigung hunderttausender Sporttreibender gleichkam, etwas ändern.
Proteste durften von den Presseorganen nicht gedruckt werden. Kurioserweise
hatte niemand jenen „Leistungssportbeschluss“ schriftlich gesehen. Ich erfuhr
ihn während einer Trainerratstagung durch Verbandstrainer Hans Platz in
Leipzig. Er erläuterte ihn uns Clubtrainern mit der Maßgabe, dass wir die
Details den Spielern in unseren Sportclubs/Leistungszentren weitergeben
sollten.
Hast du deshalb
resigniert? Wie ging es trotzdem weiter?
Verantwortliche in der
Abteilung Wissenschaft des DTSB boten mir nach dem Beschluss an, im
Leistungssport des Sportbundes zu arbeiten, aber ich fühlte mich mit dem
Schach verwurzelt. Nach dem ersten Schock musste als Gegenstrategie meines
Erachtens alles getan werden, um Schach in unserem Lande aufzuwerten. Eine
Strategie war, durch Leistungen zu beeindrucken, was mit der erwähnten
Länderkampfserie glückte. So konnten wir wenigstens Einsätze im
sozialistischen Ausland sichern und damit versuchen, die Leistungssubstanz so
lange wie möglich zu erhalten. Durch den andauernden Erfolgszwang konnten
überwiegend nur etablierte Spieler eingesetzt werden, was bedauerlicher Weise
zu einem Missverhältnis gegenüber den Entwicklungschancen jüngerer
hoffnungsvoller Anschlusskader führte. Die Leistungspyramide erhielt dadurch
einen Knick. Besonders ärgerlich war auch, dass ab 1979 alle im In- und
Ausland erspielten Preisgelder abgegeben werden mussten. Hierbei wurde kein
Unterschied zwischen olympischen- und nichtolympischen Sportarten gemacht.
Für uns ging damit die letzte Motivation verloren. In der Folge wichen wir
auf Tele-Schacholympiaden aus, eine Kooperationsform zwischen FIDE und ICCF,
die über Fax-Geräte und mit Telefonstandleitungen gespielt werden konnten.
Selbst wenn wir nicht direkt an Olympiaden teilnehmen durften, waren wir in
dieser fernschachähnlichen Wettkampfform wenigstens weltweit präsent und auch
ziemlich erfolgreich: Bei der letzten Tele-Olympiade 1990 gewannen wir (durch
ein 4:4 im Endspiel gegen die UdSSR) sogar den Titel.
Schach in seiner
Bedeutung hervorzuheben, gehörte zu deinen wichtigsten Überlegungen?
In unserer kritischen
Lage galt es, die gesellschaftliche Bedeutung des strategischen Spiels mit
seinen Anforderungen für die Herausbildung von geistigen und charakterlichen
Wesensmerkmalen zu propagieren und durch wissenschaftliche Forschungen zu
stützen. Deshalb bemühte ich mich um das Zustandekommen der Ersten
Wissenschaftlichen Konferenz zum Thema „Schach und Persönlichkeitsbildung“
1972 im Haus des Lehrers in Halle/S. und hielt das Hauptreferat. Zwei
zentrale Nachwuchskonferenzen schlossen sich 1973 und 1975 an. Zur gleichen
Zeit gründete ich eine Wissenschaftlich-methodische Kommission mit Experten
anderer Fachgebiete, aus der die spätere Präsidiumskommission „Kultur und
Bildung“ unter Leitung von Dr. habil.
Marion Kauke hervorging. Als
Hochschullehrerin initiierte sie schachwissenschaftliche Untersuchungen zur
Förderung intellektueller Leistungsfähigkeit, betreute schachrelevante
Diplom-, Beleg- und Abschlussarbeiten und verfasste schachwissenschaftliche
Veröffentlichungen.
Einladungen zu Vorträgen
über Schachdidaktik führten mich an den Lehrstuhl für Schach an der Moskauer
Hochschule für Sport und an die Lomonossow-Universität. Im September 1986
besuchte ich mit Dr. Michael Schmidt, Mitglied des Trainerrats und späterem
DSV-Präsidenten, ein wissenschaftlich-methodisches Lehrseminar der FIDE, das
anlässlich des WM-Matches Karpow-Kasparow im damaligen Leningrad stattfand.
Diese Erfahrung und das gewachsene gesellschaftliche Interesse am Schach
unter der Bevölkerung ermöglichten die beiden Spezialkurse „Bedeutung des
Schachs für Erziehung, Wissenschaft und Kultur“ mit hoher Beteiligung
nationaler und internationaler Fachwissenschaftler aus zahlreichen
Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 1988 und 1989 an der
Technischen Universität in Dresden. Beim ersten Kurs hielt ich einen Vortrag
„Zur Stellung des Schachs im System der Sportdisziplinen“, wobei besonders
die Transferwirkung unseres Spiels mit seinen schnell ablaufenden
strategisch-taktischen Denkprozessen für Zweikampfsportarten und Sportspiele
hervorgehoben wurde.
Wie kam es zur
Veröffentlichung der populären „Schachlehre“?
Eine Forderung des DSV
hieß, Schach in allen Schulen zu integrieren. Auch wenn es in der Realität
eine Illusion blieb, entstanden immer mehr Arbeitsgemeinschaften. Von vielen
Lehrern, Übungsleitern und Eltern wurde immer wieder nach Lehrmitteln
gefragt. Übungsleiter wollten wissen, wie man am zweckmäßigsten Schach
vermittelt. So versuchte ich als Verantwortlicher für die Aus- und
Weiterbildung im Verband, einen effektiven Lehrweg zu finden, indem mir ein
umfangreicher Praxisversuch helfen sollte. In der Goetheschule in Halle
unterrichtete ich eine erste und zweite Grundschulklasse Schach nach einem
von mir entwickelten Lehrprogramm. Danach wies ich zirka 40 tätige
Schachlehrer und Übungsleiter, auch im Ausland, ein. Sie erprobten diesen
Ausbildungsweg und gaben mir Feedback. Die gewonnenen Erkenntnisse, verbunden
mit pädagogischen Studien, verdichtete ich zu einem systematischen Lehr- und
Ausbildungsprogramm zum Erlernen der technischen Grundelemente. Daraus
entstand ein wesentliches Kapitel meiner Dissertationsschrift „Untersuchungen
über die didaktisch-methodische Gestaltung der Schachausbildung unter
besonderer Berücksichtigung der spieltheoretischen Entwicklung des
Schachsports“ an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dieser
effektive Lehrweg für den Gruppenunterricht sollte einem möglichst großen
Kreis von Interessenten zugänglich gemacht werden. Ich verfasste mehrere
Broschüren und nahm das Lehrprogramm 1985 in die erste Auflage des Buches
„Schachlehre – Ein Handbuch für Lehrende und Lernende“ auf. Nach einer hohen
Startauflage von 20 000 Exemplaren, die ganz schnell vergriffen waren,
folgten 1987 eine zweite und 1989 eine dritte. Das Buch galt als handliches
Kompendium, in dem Schachlehrende alles finden sollten, was sie zu einem
schnellen Vermitteln des Stoffs brauchten. Vor allem waren die zahlreichen
didaktisch geordneten Übungsaufgaben und Arbeitsblätter gefragt.
Nochmals zurück
zur „schachlichen Eiszeit“, wie du einmal die Zeitspanne betitelt hast. Diese
Periode im Sportleben ist aus heutiger Sicht vermutlich einmalig und kaum
nachvollziehbar. Warum hat der Weltschachbund nicht
geholfen und vielleicht gibt es weitere Fakten, die wir noch nicht kennen?
Meines Wissens hat sich
die FIDE als auch die 1985 gegründete ECU sehr wohl um unser nationales
Problem gekümmert. Ich sprach bei Auslandsaufenthalten (wie beim FIDE-Seminar
in Leningrad) mit allen anwesenden FIDE-Repräsentanten, später mit Herrn
Professor Kurt Jungwirth, dem Präsidenten der Europäischen Schachunion und
Horst Metzing als Geschäftsführer des DSB. Im Prinzip versprachen sie alle zu
helfen, sahen nur keinen direkten Weg, die DDR-Sportführung zu überzeugen.
Mir ging es vor allem darum, die internationale Öffentlichkeit auf unsere
Misere aufmerksam zu machen. Besondere Hoffnung setzte ich auch auf die
Autorität von Vitali Sewastjanow, der als Schachpräsident und Kosmonaut einen
hohen Bekanntheitsgrad besaß.
In persönlichen
Gesprächen bat ich bekannte Großmeister, unter anderem den damals amtierenden
Weltmeister Anatoli Karpow, uns zu helfen und über Diplomatie und Presse auf
den DTSB Einfluss zu nehmen. Michael Tal, Michael Botwinnik, Lothar Schmid,
Eduard Gufeld, Juri Awerbach, Nikolai Krogius, Aiwar Gipslis, Waleri
Tschechow, Lew Polugajewski und Nona Gaprindaschwili sowie die
einflussreichen Trainer Alexander Koblenz und Josef Watnikow,
Hauptschachlehrer an der Lomonossow Universität, setzten sich für uns ein.
Beim WM-Match Karpow-Kasparow in Moskau gelang es durch Hilfe ungarischer
Spitzenspielerinnen, mit Ministerpräsident Janos Kadar zu sprechen. Als
bekannten Förderer des Schachs bat ich ihn, seinen Einfluss geltend zu
machen, von außen auf die Regierung der DDR einzuwirken.
Ein besonderes Ziel war
es, den damaligen FIDE-Präsidenten, Florencio Campomanes als offiziellen
Fürsprecher nach Berlin einzuladen. Obwohl als Angestellter im Sport in
Zwängen, nutzte ich jede Gelegenheit, die diskriminierende schachfeindliche
Sportpolitik zu unterlaufen. Während der krankheitsbedingten Abwesenheit des
vom DTSB eingesetzten Schach-Generalsekretärs Willy Langheinrich (früher
Boxfunktionär), richtete ich ohne Zustimmung des für Nichtolympische
Sportarten zuständigen DTSB-Abteilungsleiters, an Campomanes eine Einladung.
Zum Verständnis für die damalige Hierarchie muss bemerkt werden, dass es laut
Geschäftsordnung untersagt war, in westliche Länder, einschließlich
Jugoslawien und Kuba, ohne Genehmigungsvermerk einen Brief zu schreiben, ein
Fax zu schicken oder ein Telefonat zu führen. Die Bürokratie sah auch vor,
dass jeder internationale Einsatz langfristig bei der „Abteilung Sport II“ in
siebenfacher (!) Ausfertigung eingereicht und vom Vizepräsidenten des DTSB
genehmigt werden musste. Die Sportverbände lebten unter dem Dach des
Deutschen Turn- und Sportbundes und besaßen keinerlei eigene
Entscheidungsbefugnis, vor allem nicht was internationale Belange angeht.
Eine spezielle Internationale Abteilung für Protokoll und Reiseverkehr mit 45
Mitarbeitern, gegliedert in zahlreiche Länderreferate, regelte von der
Planung, Übersetzung bis zum Ausstellen der Pässe und Kauf der Fahrkarten
alles.
Zum Spezialkurs
„Bedeutung des Schachs für Erziehung, Wissenschaft und Kultur“ 1988 in
Dresden musste die Sportführung den FIDE-Präsidenten empfangen. Ein Erfolg
dieser und weiterer sportpolitischen „Schachzüge“ war, dass wir im gleichen
Jahr das erste Mal wieder nach 16 Jahren zu einer Schacholympiade (in
Saloniki), starten durften.
In den 90er Jahren
schrieb ich einen Artikel über dein Wirken als Schachlehrer an Highschools in
New York? Wie kam es dazu?
Gleich nach der Wende
nutzte ich 1991 die Chance zur Fortbildung an der City University of New
York. Zugleich vermittelte ich Studenten des City College Schach. Die
Didaktik in meinem Buch „Schachlehre“ war die Grundlage dafür. Der Associate
Dean des Mathematik-Departments, Professor Alfred Posamentier, war erstaunt,
dass man Schach systematisch lehren kann.

Schachtraining in New York
Als wenige Jahre später
die Schuladministration von New York ein Projekt zur Förderung von 400
naturwissenschaftlichen Hochbegabungen initiierte, erhielt ich 1995 eine
Einladung, ausgewählte Schüler und Schülerinnen an der Stuyvesant-School
(ein Steinwurf vom World Trade Center entfernt) zu unterrichten. Da sich das
Vorgehen bewährte und die Kinder begeistert waren, wurde das Feldexperiment
ein Jahr später an der Stuyvesant-School wiederholt und auf die Bronx High
School of Science erweitert. Der Aufenthalt in New York war für mich eine
faszinierende Erfahrung, zumal ich nicht nur die modernsten technischen
Möglichkeiten der Telekommunikation und Computertechnik nutzen konnte,
sondern außer dem legendären Manhattan Chess Club auch Besuche in Washington,
Philadelphia und Boston auf dem Programm standen.

Die Weiterbildung an der
New Yorker Universität eröffnete mir die Möglichkeit, an einem pädagogischen
Forschungsprojekt der DFG Bonn und dem Institut für Allgemeine Pädagogik,
Abteilung Empirische Bildungsforschung und Methodenlehre an der
Humboldt-Universität Berlin, mitzuarbeiten. Unter der zentralen Thematik
„Aufwachsen in Deutschland“ führten wir systematische Beobachtungsstudien von
Kindern im Schulalltag durch. So lernte ich noch besser, Jungen und Mädchen
in ihrer sensiblen Entwicklungsphase im Alter von zehn bis 14 Jahren
verstehen.
Wie ging es nach
der Wende mit der Trainertätigkeit in Deutschland weiter?
Im Januar 1991 erhielt
ich mit einer Reihe anderer DSV-Trainer im Rahmen der Vereinigungsmaßnahmen
die A-Lizenz des DSB ausgehändigt. Zunächst gab ich Schachunterricht an einer
Grundschule in Berlin. Bei berufsbegleitenden- und Vollzeitkursen an
Kreativitätsschulen der Mehlhorn-Stiftung brachte ich ab 1995 in den Städten
Berlin, Potsdam, Teltow, Babelsberg, Cottbus, Neubrandenburg und Schwerin 460
Kreativitätspädagoginnen und Pädagogen das Schachspiel bei. Von 1996 - 2004
war ich Honorartrainer im Leistungsstützpunkt Rüdersdorf und Lehrwart des
Landes Brandenburg. Als Mitglied der Zentralen Lehrkommission des DSB wurden mir Lektorentätigkeiten in A-, B- und C-Trainerlehrgängen des
DSB zur Aus- und Weiterbildung in Berlin, Hamburg, Halle und mehreren Orten
des Landes Brandenburg übertragen. Allein im vergangenen Jahr war ich bei
sieben Trainerlehrgängen als Lektor oder Organisator tätig.
Im Jahr 2000
veröffentlichte ich mit meinem Sohn Uwe „Schachlehre – Schachtraining“ als
methodisches Handbuch für Lehrende und Lernende. Ziel war es, praktisch
tätigen Schachtrainern die Arbeit zu erleichtern, ihnen neben
didaktisch-methodischem Grundlagenwissen thematisch geordnete Übungs- und
Aufgabensammlungen in die Hand zu geben. Durch die Kompetenz Uwes als
spielstarkem Großmeister und Bundestrainer konnten wirksame Formen des
systematischen Schachtrainings und Erfahrungen zur Rolle des Schachtrainers
einbezogen werden.
Gibt es ein
Erziehungscredo im Sport, oder sollte wie in vielen Schulen, nur Wissen
vermittelt werden?
Meine tiefe Überzeugung
ist, dass ein Trainer und Schachlehrer nicht nur bilden, sondern auch
„ziehen“, also erziehen und disziplinieren sollte. Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit, sportgerechte Lebensweise, Trainingsfleiß sind unabdingbar
für stetige Leistungsentwicklung. Ein hohes, aber realistisches
Anspruchsniveau und beharrlicher Siegeswille sind gefragt. Sonst wird sich
der Sportler zwar verbessern, aber sein Leistungsvermögen nicht voll
ausschöpfen. Manchmal ist den Spielern selbst nicht bewusst, was sie hindert
oder blockiert. Dazu ist ja auch der Trainer da. Obwohl es nicht immer
einfach ist, muss er das Rückgrat haben, seinen Schützlingen den „Spiegel“
vorzuhalten, muss gegen Selbstbetrug kämpfen und notfalls auch gegen den
Willen der Sportler berechtigte Vorstellungen durchsetzen.
Problematisch für einen
Trainer ist die Pflicht, jederzeit als Vorbild zu wirken, weil er alle die
Eigenschaften, die er verlangt, auch vorleben sollte. Sobald er das nicht
tut, wirkt er unglaubwürdig. Zum Erziehungscredo gehört auch das Verhalten
von Spielern, Trainern und Funktionären rund um das Brett. Immer häufiger
wird gegen das Fairplay im Schach verstoßen, wie ich durch Vorträge bei
Trainerlehrgängen verdeutlichen konnte. Diese unschöne Entwicklung
veranlasste auch Großmeister Raj Tischbierek, seine A-Trainerarbeit 2004 den
geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen gestützt durch praktische
Erfahrungen zu widmen.
Besonders jüngere
Spieler orientieren sich oft am Trainer mehr als an den eigenen Eltern. Ich
bewundere Trainer, die viele ihrer eigenen Hoffnungen und Wünsche nicht leben
können, weil sie ohne im Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit zu
stehen, weder Zeit noch Energieleistungen scheuen, die Individualität ihrer
Schützlinge voranzubringen. Als Trainer darf man Talente nicht zu rasch
aufgeben. Bedeutsam ist die pädagogische Befähigung, Trainings- und
Wettkampfaufgaben mehr durch anspornendes Lob als durch Tadel zu bewältigen.
Ein Funken Humor kann nicht schaden. Mit einem Wort: Der Trainer sollte die
hohe Kunst beherrschen, geduldig und trotzdem unduldsam zu sein!
Was machen Deiner
Erfahrung nach Trainer richtig und was machen Sie falsch?
Beachtlich ist, wenn
Trainer über einen längeren Zeitraum hinweg ihre Schützlinge oder
Mannschaften regelmäßig und zuverlässig betreuen, an ihren Sorgen und Ängsten
teilhaben und sie nach Misserfolgen immer wieder zu motivieren verstehen.
Mich stört, dass manche
Übungsleiter, den Schützlingen ihre persönlichen Eröffnungsvorlieben
oktroyieren. So spielen häufig Kinder in den untersten Altersklassen nicht
das klassische 1.e4, sondern geschlossene Eröffnungssysteme oder Züge wie
1.b4, 1.c4 und 1.f4, deren strategische Gedanken sie noch gar nicht
verstehen. Mir gefällt auch nicht, wenn Trainer unmittelbar nach einer
verlorenen Partie mit den Worten „Wie kannst du nur…?“ oder „Warum hast du
das nicht gesehen?“ ihre Schützlinge noch tiefer ins psychische Loch stoßen.
Schließlich sollte in der Lehre und beim Trainieren nicht die laute und
schreiende Stimme des aufgeregten Schachlehrers zu hören sein, wodurch
speziell junge Mädchen noch stärker eingeschüchtert und verängstigt werden.
Muss sich auch ein
„gestandener“ Trainer noch weiterbilden?
Das würde ich auf alle
Fälle bejahen. Natürlich besitzen langjährige Trainer einen gewissen
Erfahrungsschatz durch die Aktiven- und Trainerlaufbahn. Trotzdem kann man
sich nicht zurücklehnen. Für mich besitzen derartige Weiterbildungen eine
lange Tradition. Schon im damaligen Deutschen Schachverband organisierte ich
seit Anfang der 80Jahre jeweils zu Jahresbeginn einen einwöchigen
Fortbildungslehrgang an einer Sportschule für alle sechs, später acht
hauptberuflichen Trainer, an denen auch die anderen Mitglieder des
Trainerrats teilnahmen. Das waren neben den beiden GM Wolfgang Uhlmann und
Lothar Vogt als Aktive der Verbandspsychologe, Verbandsarzt, Übersetzer und
ein Übungsleiter. Während dieser Woche wurden aktuelle schachspezifische und
pädagogisch-psychologische Weiterbildungsthemen gehört sowie der jährliche
Rahmentrainingsplan mit Leistungszielen, Kaderkreisen für Männer, Frauen,
Nachwuchs, Nominierungskriterien, Wettkampf- und Lehrgangspläne ausführlich
diskutiert und erarbeitet.
Auch in der heutigen
Zeit sind bestimmte Formen und Inhalte des Fortbildens unverzichtbar. Vieles
kann man autodidaktisch im Selbststudium lernen. Das regelmäßige Nachspielen
von Partien auf der CD-Rom im ChessBase Magazin zählt sicher dazu. Allein der
technische Fortschritt zwingt uns, neue Wege zu finden. So kann man sich kaum
noch einen modernen Schachtrainer ohne Computer, Eröffnungs-Datenbanken,
Powerbooks, Handy, Internetzugang und E-Mailanschrift vorstellen.
Computergestützte Hilfsmittel erlauben elektronische Lehr- und Lernweisen und
verbessern die Kommunikation untereinander. Auf diesem Gebiet gibt es keinen
Stillstand. Täglich kommen aktualisierte Programme, Datenbanken und Geräte
auf den Markt, die erworben, verstanden bzw. installiert werden müssen. So
sehe ich das auch mit den regelmäßigen
DSB-Weiterbildungen für die
Trainerlizenzen. Es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, welchen
Anforderungen sich ein A-Trainer stellen muss. Meine Fortbildung erfolgte
nach der Lizenzierung 1991 im zweijährigen Rhythmus 1993 in Stuttgart, es
folgten jeweils 15stündige Wochenendlehrgänge 1995 in Kienbaum, 1997 Berlin,
1999 Hannover, 2001 Helmstedt, 2003 Hannover und 2005 erneut in Berlin.
Eigentlich möchte ich keinen der besuchten Lehrgänge missen, da neben den
gebotenen Lektionen, überwiegend von uns selbst gehalten, vor allem der damit
verbundene Erfahrungsaustausch mit Kollegen ungemein wertvoll und angenehm
war.
Welche Aufgaben
hast du an der internationalen Trainerakademie in Berlin?
Seit Anfang 2001 widmete
ich als Koordinator und Organisator viel Kraft und Zeit dem Aufbau der
Berliner Trainerakademie. Vier Räume mussten neu eingerichtet, möbliert und
mit moderner Technik ausgestattet werden. So entstanden inzwischen ein
Schulungsraum, Computerkabinett, eine Bibliothek und ein Büro. Alle Geräte
wie Computer, Beamer, Spielmaterialien, Drucker etc. müssen gewartet werden,
um funktionstüchtig zu bleiben. Es galt Finanzpläne auszuarbeiten,
Ausschreibungen und Lehrpläne in Englisch zu verfassen, Lektoren zu gewinnen,
im Prinzip alles zu veranlassen, was für den Betrieb einer modernen
Lehreinrichtung notwendig ist. Für meine Begriffe wird diese Einrichtung mit
dem Anliegen „Train the Trainer“ voll dem Leitspruch der FIDE „Gens una sumus“
gerecht. Die Trainerakademie ist ein Novum. Mir ist kein anderer Sportverband
bekannt, der weltweit sportartspezifische Aus- und Weiterbildungen für seine
Trainer organisiert.

In der Bibliothek der Trainerkademie
Welche Rolle
spielt dabei der Deutsche Schachbund?
Aufgrund der Initiative
des früheren Ausbildungsreferenten, Professor Dr. Hochgräfe, vergab der
Weltschachbund auf seinem Kongress 2000 in Istanbul den Standort der
internationalen FIDE Trainerakademie nach Berlin. Darauf hin wurde mit Horst
Metzing, Uwe Bönsch und mir eine kleine Arbeitsgruppe gebildet. Mit dem
Aufbau einer Trainerakademie für den Weltschachbund entstand etwas völlig
Neues auf dem Gelände des Berliner Olympiastadions. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten organisierten wir inzwischen neben mehreren DSB- und DSJ-Lehrgängen bereits vier internationale Ausbildungskurse für
FIDE-Trainer und Instruktoren aus 18 Ländern von vier Kontinenten. Die
nächsten Kurse in diesem Jahr finden vom 21.-27. Juli und 20.-27. Oktober
statt, wie bei
www.fide-trainer-academy.com zu ersehen ist. Inzwischen
unterstützen so fachkundige Experten wie Michael Langer, Hanno Dürr, Michael
Greiser, Guido Feldmann und
Michael Richter das Unternehmen
Trainerakademie. Als für die Sache förderlich erwies sich auch die
unmittelbare räumliche Nachbarschaft zur Geschäftsstelle des DSB, der DSJ und ECU. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir ein Lob für die
hauptamtlich Tätigen in der Zentrale des Deutschen Schachbundes und der
Deutschen Schachjugend. Es beeindruckt mich immer wieder, das ganze Jahr spät
abends nach Dienstschluss noch Licht brennen und Mitarbeiter am Computer
sitzen zu sehen.

Erinnerst du dich
an einige Ereignisse aus deinem Schachleben, die dich besonders
beeindruckten?
In jungen Jahren
begeisterte mich die Ausstellung „Schach im Wandel der Zeiten“, die 1960
anlässlich der XIV. Schacholympiade in Leipzig stattfand. Damals gelang es,
wichtige Exponate, Raritäten, Bilder, Pseudo-Computer, historische
Schachspiele, Figuren, Briefmarken und Bücher, im Prinzip alles was irgendwo
in Welt in einem Museum oder Privatbesitz bekannt war, im Leipziger
Ringmessehaus auszustellen. Viel Beifall erhielt ein 1911 in Spanien
konstruierter mechanischer Apparat, der mit König und Turm den feindlichen
König (mit krächzender spanischer Stimme) mattzusetzen vermochte. Allein die
für Transport und Versicherung zu entrichtenden Gelder, vor allem für
Überseeexponate, machten ein kleines Vermögen aus. Meines Wissens war es mit
75 364 Zuschauern die bisher größte internationale Schachausstellung und ich
bin froh, durch eigene persönliche Leihgaben und Helfen beim Ausgestalten der
Räume Anteil daran gehabt zu haben. Alles in allem wurde in eindrucksvoller
Weise gezeigt, welchen hohen Wert Schach in der Menschheitskultur einnimmt.
Des Weiteren möchte ich
die Teilnahme 1964 an der Schacholympiade in Tel Aviv als Trainer nennen.
Spannend war schon der Reiseweg, der durch die damals drei geteilten Städte
der Welt führte. Vom gespaltenen Berlin flogen wir nach der Mittelmeerinsel
Zypern zur geteilten Hauptstadt Nikosia. Aus unerfindlichen Gründen durften
wir zwar nicht mit dem offiziellen Reisepass, aber mit dem unscheinbaren
DDR-Personalausweis die Grenze vom griechischen Teil nach dem nördlichen
türkischen Sektor passieren. In Israel erlebten wir die geteilte Stadt
Jerusalem mit Scharfschützen hinter einem Wall von Sandsäcken. Dort gab es
keine Chance, von der israelischen Seite einmal in den arabischen Teil zu
gehen. Beeindruckend im Gastgeberland waren die historischen heiligen Stätten
und der Besuch in einem Kibbuz mit seinen ungewöhnlichen
Erziehungsprinzipien. Während des FIDE-Kongresses wurde mir persönlich die
Urkunde als Internationaler Schiedsrichter überreicht.
Im September 1999
faszinierte mich die phantastische Geistesleistung von GM Dr. Robert Hübner
beim Blindsimultan an acht Brettern gegen eine zweite
Bundesligaligamannschaft in Berlin. Als Schiedsrichter erlebte ich innerhalb
der Absperrungen prickelnd hautnah, wie Robert Hübner mit einer unglaublichen
Konzentrationskraft und vibrierenden Nerven die starke Gegnerschaft des
Kreuzberger Schachclubs ohne Verlustpartie mit 6,5: 1,5 bezwang. Ungeachtet
technisch bedingter Kommunikationsstörungen in der hausinternen
Telefonleitung und verwirrender untheoretischer Eröffnungszüge seiner Gegner,
behielt er trotz geschlossener Augen sechs Stunden lang den Überblick.
Gern denke ich zurück an
eine fröhliche Autofahrt mit 11jährigen Mädchen meiner Rüdersdorfer
Übungsgruppe zu einem der Trainingslager, damals in die Jugendherberge Milow.
Während der Fahrt kündigte ich ihnen zum Zeitvertreib provokativ Aufgaben an
„die sie bestimmt nicht schaffen würden“. Ihr Widerspruch war gereizt, und
sie wollten es natürlich wissen. Ich bat sie, die Augen zu schließen, und es
ging los mit Fragen und Antworten aus dem Kopf wie „Wohin kann der Springer
von b1 ziehen?“ und „In wie viel Zügen gelangt der Springer von g1 auf die
achte Reihe?“. Wir landeten schließlich bei einfachen Mattaufgaben wie „Weiß
am Zuge setzt in zwei Zügen matt!“ (z.B. Weiß: Kg6, Tf7 - Schwarz: Kg8).
Unversehens gelangen ihnen die Lösungen ohne Ansicht des Brettes. Davon waren
die Mädchen selbst so überrascht, dass sie gar nicht genug bekommen konnten
und nach mehr Aufgaben verlangten. Ich hatte ihnen etwas gezeigt, von dem sie
nicht ahnten, dass sie es können würden. Keine Frage, dass wir die Spielchen
auf der Rückfahrt nach zwei Tagen wiederholten. Ihre Begeisterung wirkte auf
mich als Trainer zurück!
Was machst du am
liebsten, wenn du nicht gerade Schach lehrst, organisierst oder am Computer
schreibst?
Im Grunde interessiert
mich alles „rings um das Schach“ vom Computer- bis zum Fernschach. Ich spiele
gern 3 - 5 Minuten Blitzpartien mit Fritz9 auf dem komfortablen Server von
ChessBase gegen unbekannte Gegner aus aller Welt und suche bei Google bzw.
www.schachbund.de
nach neuen Informationen. Im Fernsehen sehe ich gern Sportsendungen,
besonders solche, die das aufwendige Training in einer Sportart zeigen, wie
beim Kräfte zehrenden Triathlon. Faszinierend finde ich Menschen, die ihre
Leistungsgrenzen ausreizen nach Reinhold Messners Philosophie „Bis zur Grenze
gefordert, können wir alle mehr, als wir wollen!“
Ich möchte weiterhin
überzeugende Argumente finden, Schach als Trainingsmittel für Strategie und
Taktik in vielen Sportarten zu nutzen. Einige Trainer im Fußball gehen von
ähnlichen Überlegungen aus und verwenden Schach als Freizeitbeschäftigung in
Trainingslagern. Diesem Anliegen widmet sich auch eine von mir betreute
Abschlussarbeit in der Kreativitätsschule Berlin mit dem Thema „Schach und
Boxen“.
Persönlich versuche ich,
den Körper durch gesunde Lebensweise mit Früchtemüsli ohne Nikotin und wenig
Alkohol gesund und geistig frisch zu halten. Tischtennis, Joggen, Schwimmen
und Saunieren gehören ebenfalls dazu. Mit Schach möchte ich mich noch viele
Jahre in einer sinnvollen Form beschäftigen, zumal im gereiften Alter eine
Menge Lebenserfahrung und Kompetenz eingebracht werden kann. Es ist ja das
Schöne bei diesem Spiel, dass man im Unterschied zu anderen Sportarten
lebenslang aktiv bleiben kann, und zwar nicht nur am Brett wie es der
gleichaltrige Viktor Kortschnoi vorlebt, sondern auch hinter dem Brett als
Trainer, Schachlehrer, Schiedsrichter oder Organisator.