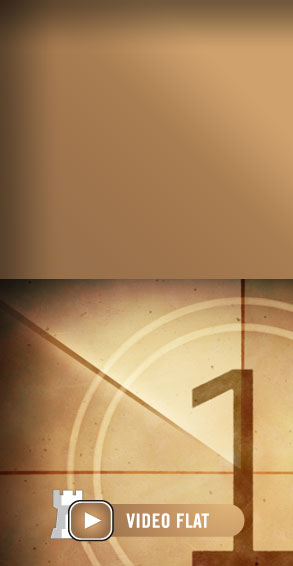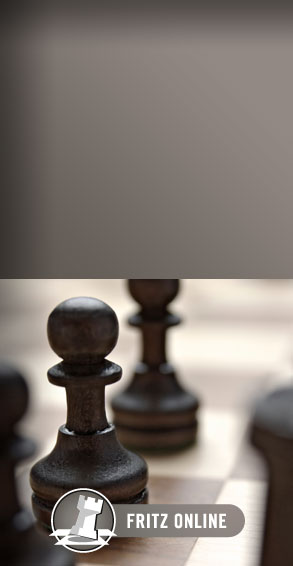Ein faszinierendes Leben, eine vorbildliche
Biographie
Von Johannes Fischer

Pal Benkö, Jeremy Silman: Pal Benko: My Life, Games and Compositions, 668
S., Leinen, Los Angeles: Siles Press 2003, 44,95€.
 Pal
Benkö ist ein Mann mit vielen Facetten. Als Schachspieler pragmatisch und
erfolgsorientiert, bekommt er doch sein Leben lang die eigene Zeitnot nicht in
den Griff; obwohl vom Studium von Eröffnungen gelangweilt, entwickelt er dennoch
zahlreiche neue Systeme und Varianten; obwohl er aus dem kommunistischen Ungarn
geflohen ist und während seiner zahlreichen Reisen unzählige
Frauenbekanntschaften unterhält, heiratet er schließlich seine langjährige
Verlobte, die weiter in Ungarn lebt; und obwohl er sehr aufs Geld achtet,
verbringt er doch Tausende von Stunden mit dem wenig einträglichen Komponieren
von Schachproblemen und Studien. Die 2003 erschienene, zusammen mit dem
amerikanischen Internationalen Meister Jeremy Silman verfasste, Autobiographie
Pal Benko: My Life, Games and Compositions zeigt verschiedene Seiten
eines amerikanischen Schachprofis, dessen faszinierendes Leben von Reiselust,
der Liebe zum Schach und zu den Frauen geprägt war.
Pal
Benkö ist ein Mann mit vielen Facetten. Als Schachspieler pragmatisch und
erfolgsorientiert, bekommt er doch sein Leben lang die eigene Zeitnot nicht in
den Griff; obwohl vom Studium von Eröffnungen gelangweilt, entwickelt er dennoch
zahlreiche neue Systeme und Varianten; obwohl er aus dem kommunistischen Ungarn
geflohen ist und während seiner zahlreichen Reisen unzählige
Frauenbekanntschaften unterhält, heiratet er schließlich seine langjährige
Verlobte, die weiter in Ungarn lebt; und obwohl er sehr aufs Geld achtet,
verbringt er doch Tausende von Stunden mit dem wenig einträglichen Komponieren
von Schachproblemen und Studien. Die 2003 erschienene, zusammen mit dem
amerikanischen Internationalen Meister Jeremy Silman verfasste, Autobiographie
Pal Benko: My Life, Games and Compositions zeigt verschiedene Seiten
eines amerikanischen Schachprofis, dessen faszinierendes Leben von Reiselust,
der Liebe zum Schach und zu den Frauen geprägt war.
Biographisches
 Den
ersten und umfangreichsten Teil des Buches bildet die Biographie Benkös. Er wird
1928 in Amiens in Frankreich geboren, aber bald nach der Geburt des Kindes
ziehen die Eltern nach Budapest, wo Benkö eine glückliche Jugend verlebt – bis
1940 der Zweite Weltkrieg über Ungarn hereinbricht. Es herrscht
Lebensmittelknappheit, Familien müssen nächtelang Schlange stehen, um morgens
ein Laib Brot zu ergattern, Schulen und öffentliche Gebäude können nicht geheizt
werden und eine Läuseplage bricht in der ganzen Stadt aus. Später kommen noch
amerikanische Luftangriffe hinzu, im Laufe derer Benkös Familie ausgebombt wird.
1944 besetzt die deutsche Armee Budapest und plündert die Stadt, 1945 kommt die
Rote Armee als "Befreier", aber setzt Plünderungen und Willkürherrschaft fort.
So werden Benkös älterer Bruder und Vater eines Tages von den Russen verhaftet,
in ein Arbeitslager verschleppt und erst ein paar Jahre später wieder
freigelassen. Kurz nach dem Verschwinden von Benkös Vater stirbt seine Mutter an
den Folgen der Entbehrungen des Krieges und der Ungewissheit über das Schicksal
von Mann und Sohn.
Den
ersten und umfangreichsten Teil des Buches bildet die Biographie Benkös. Er wird
1928 in Amiens in Frankreich geboren, aber bald nach der Geburt des Kindes
ziehen die Eltern nach Budapest, wo Benkö eine glückliche Jugend verlebt – bis
1940 der Zweite Weltkrieg über Ungarn hereinbricht. Es herrscht
Lebensmittelknappheit, Familien müssen nächtelang Schlange stehen, um morgens
ein Laib Brot zu ergattern, Schulen und öffentliche Gebäude können nicht geheizt
werden und eine Läuseplage bricht in der ganzen Stadt aus. Später kommen noch
amerikanische Luftangriffe hinzu, im Laufe derer Benkös Familie ausgebombt wird.
1944 besetzt die deutsche Armee Budapest und plündert die Stadt, 1945 kommt die
Rote Armee als "Befreier", aber setzt Plünderungen und Willkürherrschaft fort.
So werden Benkös älterer Bruder und Vater eines Tages von den Russen verhaftet,
in ein Arbeitslager verschleppt und erst ein paar Jahre später wieder
freigelassen. Kurz nach dem Verschwinden von Benkös Vater stirbt seine Mutter an
den Folgen der Entbehrungen des Krieges und der Ungewissheit über das Schicksal
von Mann und Sohn.
In diesen Zeiten kommt Benkö
das Schach zu Hilfe. Nicht nur, weil es die Möglichkeit des Rückzugs in eine
geordnete Welt bietet, sondern auch weil er gelegentlich Lebensmittel bei
Turnieren gewinnt und von Schachliebhabern unterstützt wird. Mit zehn hatte er
die Regeln des Spiels gelernt und war dann durch das Studium einer Sammlung von
350 Capablanca-Partien rasch besser geworden. Capablancas Partien hinterließen
einen prägenden Eindruck: Wie sein Vorbild ist Benkö Endspielspezialist, kein
Freund eröffnungstheoretischer Studien und besonders stark in Stellungen, in
denen die Damen getauscht sind. Aber anders als der legendär schnell spielende
Kubaner bleibt Benkö sein Leben lang Zeitnotkandidat, eine Schwäche, die ihn
zahlreiche wichtige Punkte kosten sollte.
 Mit
sechzehn spielt Benkö das erste ernsthafte Turnier seines Lebens und belegt als
absoluter Außenseiter den ersten Platz, was ihm gleich den Meistertitel
einbringt. 1948 gewinnt er die Ungarische Meisterschaft und gilt damit Ende der
vierziger Jahre neben Laszlo Szabo als der beste Spieler Ungarns. Doch 1952
erhält seine Karriere einen Knick. Nach einem Länderkampf in Görlitz unternimmt
Benkö zusammen mit zwei anderen Schachspielern auf der Rückreise über Berlin
einen halbherzigen Versuch, in den Westen zu fliehen. Sie scheitern kläglich,
Benkö wird verhaftet und interniert: "Das Lager – ein großes, dunkles Gebäude –
hatte viele kleine, schmale Räume, die alle mit zwanzig oder mehr Gefangenen
gefüllt waren. Die Fenster des gesamten Gebäudes waren alle geschwärzt, damit
auch ja niemals ein Sonnenstrahl hereinscheinen konnte. Die Opfer im Inneren
hatten keine Vorstellung von Zeit – wenn jemand krank wurde, ignorierte man sie
und ließ sie sterben, und wenn ihre Zähne schlecht wurden, zogen wir sie einfach
heraus." (S.69)
Mit
sechzehn spielt Benkö das erste ernsthafte Turnier seines Lebens und belegt als
absoluter Außenseiter den ersten Platz, was ihm gleich den Meistertitel
einbringt. 1948 gewinnt er die Ungarische Meisterschaft und gilt damit Ende der
vierziger Jahre neben Laszlo Szabo als der beste Spieler Ungarns. Doch 1952
erhält seine Karriere einen Knick. Nach einem Länderkampf in Görlitz unternimmt
Benkö zusammen mit zwei anderen Schachspielern auf der Rückreise über Berlin
einen halbherzigen Versuch, in den Westen zu fliehen. Sie scheitern kläglich,
Benkö wird verhaftet und interniert: "Das Lager – ein großes, dunkles Gebäude –
hatte viele kleine, schmale Räume, die alle mit zwanzig oder mehr Gefangenen
gefüllt waren. Die Fenster des gesamten Gebäudes waren alle geschwärzt, damit
auch ja niemals ein Sonnenstrahl hereinscheinen konnte. Die Opfer im Inneren
hatten keine Vorstellung von Zeit – wenn jemand krank wurde, ignorierte man sie
und ließ sie sterben, und wenn ihre Zähne schlecht wurden, zogen wir sie einfach
heraus." (S.69)
Aber nach dem Tod Stalins im
Frühjahr 1953 verordnet der damalige ungarische Präsident Nagy, der eine größere
Unabhängigkeit Ungarns von der Sowjetunion anstrebt, eine Häftlingsamnestie und
Benkö kommt wieder frei. Aber die Haft hinterließ Spuren: "Vorher glaubte ich,
ich würde immer Erfolg haben, ganz egal, was ich auch tat. Ich war voller
Selbstvertrauen, erzählte jedem, der es hören wollte, was ich dachte, und fühlte
mich unbesiegbar. Danach lernte ich meinen Mund zu halten. Das Lager hatte mir
eine schwere Dosis Sterblichkeit verabreicht und mir war schmerzhaft bewusst,
dass mein Leben jeden Moment ausgelöscht werden könnte" (S.71).
 Bald
jedoch darf Benkö wieder Schach spielen und sogar an Turnieren im Ausland
teilnehmen. 1957 benutzt er die Gelegenheit zur Flucht und beantragt während
eines Turniers in Reykjavik in der amerikanischen Botschaft politisches Asyl.
Drei Monate später darf er in die USA einreisen und wird amerikanischer
Staatsbürger.
Bald
jedoch darf Benkö wieder Schach spielen und sogar an Turnieren im Ausland
teilnehmen. 1957 benutzt er die Gelegenheit zur Flucht und beantragt während
eines Turniers in Reykjavik in der amerikanischen Botschaft politisches Asyl.
Drei Monate später darf er in die USA einreisen und wird amerikanischer
Staatsbürger.
Um Geld zu verdienen, arbeitet
er zunächst als Börsenmakler, dann als Immobilienhändler. Trotz dieser
beruflichen Belastungen qualifiziert er sich 1959 und 1962 fürs
Kandidatenturnier. 1959 beim Turnier in Bled und Zagreb belegt er allerdings nur
den letzten Platz, 1962 in Curacao wird er sechster in einem Feld von acht. So
talentiert Benkö auch war, in die absolute Weltspitze schaffte er es nie.
Anfang der sechziger Jahre
entschließt sich Benkö, seinen sicheren Beruf aufzugeben, um Schachprofi zu
werden. Zwar wusste er seit den Kriegsjahren in Budapest den Wert des Geldes zu
schätzen, aber Reiselust, Schachleidenschaft und die Abneigung gegen geregelte,
immer gleiche, Arbeitszeiten siegen am Ende über die Liebe zum Geld. Fortan
verdient Benkö seinen Lebensunterhalt durch Turniere, Startgelder, Vorträge,
Simultanveranstaltungen und Trainingsstunden. Paradoxerweise bedeutet Benkös
Beginn der Karriere als Schachprofi einen Abschied von seinen Träumen vom
WM-Titel: "Mein Leben als Profi in den USA verlangte von mir eine
kontinuierliche Teilnahme an offenen Turnieren im Schweizer System. Diese
Veranstaltungen sicherten mir ein annehmbares Einkommen, aber wirkten sich
zugleich negativ auf die Qualität meines Spiels aus. ... In offenen Turnieren
braucht man so viele Siege wie möglich (die schwächere Gegnerschaft macht das zu
einem Muss, aber zugleich ruiniert man damit die eigene Spielstärke), und oft
schafft man das nur, wenn man Risiken eingeht und eine leicht inkorrekte
Spielweise pflegt" (S.173). Dennoch dominiert Benkö die offenen Turniere in den
USA und von 1961 bis 1975 wird er acht Mal US-Open Champion.
Benkö nutzt die Freiheit des
Lebens als Schachprofi auch zu regelmäßigen Reisen nach Ungarn, denn dort, wie
man als Leser überrascht erfährt, wartet seine langjährige Verlobte Gizella auf
ihn. Eigentlich war Benkö immer das, was die Amerikaner einen "Ladies' Man"
nennen, jemand, der Erfolg bei Frauen hat. Immer wieder erwähnt er in seinen
Erzählungen von Turnieren und Reisen Freundinnen, mit denen er mehr oder weniger
lang zusammen war. Aber da er sich selbst gelobt hatte, bis ans Ende seiner Tage
Junggeselle zu bleiben, wenn er nicht bis vierzig heiraten würde, war er Mitte
der sechziger Jahre plötzlich in Zeitnot geraten.
Ungewöhnlich ist die Ehe
trotzdem. Gizella bleibt in Ungarn, während Benko weiter in den USA lebt und
zwischen Amerika und Europa hin- und herpendelt. Er spielt zahlreiche Turniere
in Europa, immer unterbrochen von Abstechern nach Ungarn. Trotz dieser
schwierigen Bedingungen hält die Ehe, Benkö wird bald Vater und tatsächlich ist
die Autobiographie seiner Frau Gizella, seinem Sohn David und seiner Tochter
Palma gewidmet.

Mitte der siebziger Jahre zieht
sich Benkö allmählich vom anstrengenden Turnierschach zurück. Er verbringt mehr
Zeit mit Frau und Kindern und komponiert Probleme und Studien. 1995 wird ihm der
Titel eines Großmeisters der Problemkomposition verliehen.
Am Ende seiner Biographie zieht
er positive Bilanz: "Oft werden die Leute gefragt, ob sie alles noch einmal so
machen würden, wenn sie könnten. Obwohl ich auf die Schrecken von Krieg und
Gefängnis verzichten könnte, wäre ich glücklich, das Leben eines Schachspielers
noch einmal führen zu können. Reisen in exotische Länder, der belebende
Wettkampf von Geist gegen Geist auf diesen 64 Feldern, die tiefe Befriedigung,
die nur durch künstlerische Tätigkeit entsteht, die Gesellschaft vieler enger
Freunde in der ganzen Welt – was kann man mehr vom Leben verlangen? Wenn ich
dazu noch an das Glück denke, meine wunderbare Frau getroffen zu haben, zusammen
mit meinen beiden erstaunlichen Kindern ..., dann kann ich nicht anders, als
mich sehr glücklich zu schätzen" (S.409).
Partien und Analysen
Neben der Lebensbeschreibung
enthält der biographische Teil 138 Partien Benkös, die er eingehend kommentiert.
Diese Anmerkungen bestechen durch eine gelungene Mischung aus Varianten,
strategischen Erläuterungen und unterhaltsamen Erzählungen über die
Begleitumstände der Partien. Schön sind auch die zahlreichen Fotos und die
kurzen Skizzen bekannter Schachspieler, die den Text begleiten. Aber nicht alle
Fotos zeigen Benkö, ein Highlight ist hier z.B. der auf Film gebannte Besuch
Fischers am Krankenbett Tals in Curacao 1962.

Interviews
Nach dem biographischen Teil
folgen drei Interviews, die Jeremy Silman mit Ron Gross, einem langjährigen
Freund Benkös, Larry Evans, einem Freund und Rivalen, und Benkö selbst geführt
hat. Hier sieht man Benkö aus einer anderen Perspektive und erfährt mehr über
das Leben als Schachprofi und die Eigenheiten der Schachszene in den USA.

Benkö mit Ron Gross
Eröffnungsübersicht
 Eine
Fundgrube an Eröffnungsideen bietet John Watsons Überblick über Benkös
Eröffnungsrepertoire. Obwohl Benkö eine ausgesprochene Abneigung gegen trockenes
Eröffnungsstudium hegte, stellt Watson fest, dass Benkö doch zahlreiche Systeme
und Neuerungen in die Praxis eingeführt oder populär gemacht hat. Das
bekannteste ist sicher das so genannte Wolga-Benkö Gambit (1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5
b5), über dessen Entdeckung und Ausarbeitung sich Benkö auch im biographischen
Teil ausführlich äußert.
Eine
Fundgrube an Eröffnungsideen bietet John Watsons Überblick über Benkös
Eröffnungsrepertoire. Obwohl Benkö eine ausgesprochene Abneigung gegen trockenes
Eröffnungsstudium hegte, stellt Watson fest, dass Benkö doch zahlreiche Systeme
und Neuerungen in die Praxis eingeführt oder populär gemacht hat. Das
bekannteste ist sicher das so genannte Wolga-Benkö Gambit (1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5
b5), über dessen Entdeckung und Ausarbeitung sich Benkö auch im biographischen
Teil ausführlich äußert.
Watson konstatiert weiter, dass
Benkö im Laufe seiner Karriere zwar fast alle Eröffnungen einmal ausprobiert
hat, aber vergleichsweise selten 1.e4 spielte, und mit Schwarz viel weniger
Punkte machte als mit Weiß. Letztendlich bevorzugte Benkö positionelle
Eröffnungen, in denen es nicht notwendig war, scharfe Varianten bis zum 20. oder
30. Zug zu erinnern, aber die dennoch gute Chancen auf aktives Spiel boten.
Benkö als Problem- und Studienkomponist
Der Schlussteil des Bandes
enthält 300 Studien- und Problemkompositionen von Benkö. Sie umfassen vom Zwei-
und Mehrzüger über Hilfsmattprobleme und Studien ein breites Spektrum.
Allerdings lagen Benkö Studien wegen ihrer Praxisnähe besonders am Herzen. Beim
Komponieren konnte und kann er seine Leidenschaft für das Endspiel mit seinen
analytischen Fähigkeiten verbinden. Benkös Liebe zur Studienkomposition erwachte
allerdings erst spät, nämlich 1964, als er bei der Analyse seiner Partie gegen
Matanovic aus dem Belgrader Turnier eine verborgene Möglichkeit entdeckte, und
dann daraus eine Studie komponierte, die bei dem jährlichen Endspielwettbewerb
des Hungarian Chess Magazine den zweiten Preis gewann. Voller Ehrgeiz
nahm Benkö die Aufgabe, die den ersten Preis gewonnen hatte, unter die Lupe,
entdeckte einen Fehler und wurde zum Sieger des Studienwettbewerbs ernannt.
Auch heute noch komponiert
Benkö Endspielstudien, dem, wie er erklärt, "einzigen Bereich des
Problemschachs, der noch einigermaßen sicher vor dem drängenden Zugriff der
Computer ist" (S.607-608). Manche der Studien Benkös sind relativ einfach,
andere hochkomplex. Besonders stolz ist er darauf, eine Studie komponiert zu
haben, "die so schwierig war, dass sie niemand je lösen konnte" (S.607).
 Im
Vorwort zu Benkös Autobiographie erklärt Co-Autor Jeremy Silman: "Dieses Projekt
brauchte fünf Jahre bis es fertig war. Ich habe das Buch so konzipiert, dass es
anderen Schachbiographien nicht gleicht – es soll Spaß machen, lehrreich sein,
Einsichten vermitteln und gelegentlich wirkliche Überraschungen enthalten. Wenn
Sie, der Leser oder die Leserin, finden, dass es Spiel/Sport/Kunst des Schachs
und der Großmeister, die es spielen, lebendig macht, dann halte ich diese fünf
Jahre für gute Investition" (S.XX). Ohne jeden Zweifel haben sich die fünf Jahre
gelohnt: Pal Benko: My Lifes, Games and Compositions ist unterhaltsam
geschrieben, enthält zahlreiche gut kommentierte Partien, eine aufschlussreiche
Analyse von Benkös Eröffnungsrepertoire und vermittelt einen guten Einblick in
Benkös Problemkompositionen. So setzt diese Biographie in mehr als einer
Hinsicht Maßstäbe.
Im
Vorwort zu Benkös Autobiographie erklärt Co-Autor Jeremy Silman: "Dieses Projekt
brauchte fünf Jahre bis es fertig war. Ich habe das Buch so konzipiert, dass es
anderen Schachbiographien nicht gleicht – es soll Spaß machen, lehrreich sein,
Einsichten vermitteln und gelegentlich wirkliche Überraschungen enthalten. Wenn
Sie, der Leser oder die Leserin, finden, dass es Spiel/Sport/Kunst des Schachs
und der Großmeister, die es spielen, lebendig macht, dann halte ich diese fünf
Jahre für gute Investition" (S.XX). Ohne jeden Zweifel haben sich die fünf Jahre
gelohnt: Pal Benko: My Lifes, Games and Compositions ist unterhaltsam
geschrieben, enthält zahlreiche gut kommentierte Partien, eine aufschlussreiche
Analyse von Benkös Eröffnungsrepertoire und vermittelt einen guten Einblick in
Benkös Problemkompositionen. So setzt diese Biographie in mehr als einer
Hinsicht Maßstäbe.