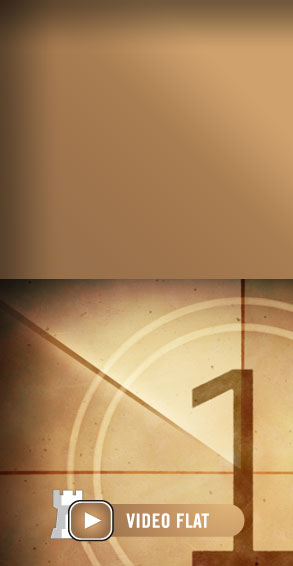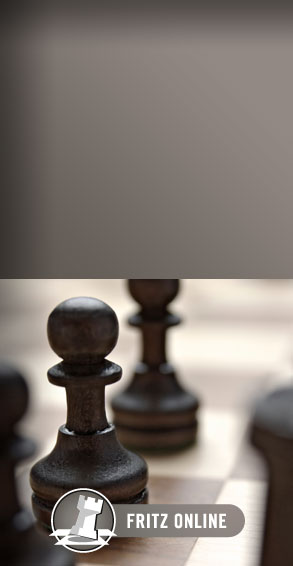DAS LETZTE HURRA DER MENSCHHEIT?
KUBRICKS HAL IST NICHT MEHR SO WEIT WEG
Von Dr. René Gralla
"World Chess Challenge 2006" in Bonn. Weltmeister Wladimir Kramnik bestreitet
ab kommenden Sonnabend in der Bundeskunsthalle sechs Partien gegen den Schachcomputer
"Deep Fritz 10" aus der Hamburger Softwareschmiede ChessBase. Den ersten Zug
führt Bundesfinanzminister Peer Steinbrück aus, assistiert von Werner Müller,
Vorstandsvorsitzender des Sponsors RAG AG. Kramnik misst sich mit dem Rechner
für eine Antrittsbörse von 500.000 Dollar; gewinnt er das Match, verdoppelt
sich der Betrag. Über das Kräftemessen zwischen menschlicher und elektronischer
Intelligenz hat ND-Autor René Gralla mit dem „Deep Fritz 10“-Programmierer Mathias
Feist (45) gesprochen; der Niedersachse bildet zusammen mit dem Niederländer
Frans Morsch (52) das Zweier--Team, das bereits 1991 die erste „Fritz“-Version
der Öffentlichkeit vorgestellt hat.

Vladimir Kramnik und Mathias Feist
ND: Weltmeister Kramnik misst sich ab kommenden Sonnabend zum zweiten Mal
mit "Deep Fritz 10", dem stärksten Schachprogramm der Welt. Das letzte Hurra
der Menschheit?
MATHIAS FEIST: Das mag durchaus sein. Inzwischen könnten wir tatsächlich den
Zeitpunkt erreicht haben, an dem es die letzten interessanten Matches gibt -
bevor die Programme einfach zu überlegen werden.
ND: Das Programm "Deep Fritz7" hat vor vier Jahren in Bahrain gegen Kramnik
ein 4:4-Unentschieden gehalten. Worauf gründen Sie Ihre Prognose, dass "Deep
Fritz 10" jetzt noch besser abschneiden wird?
FEIST: Seit Bahrain haben wir die Engine weiter entwickelt. Vor allem im positionellen
Bereich: was die Bewertung von Bauernstrukturen betrifft, ferner ist umfängliches
Endspielwissen hinzugekommen. Das äußert sich einerseits darin, dass die reine
Rechengeschwindigkeit deutlich langsamer geworden ist; andererseits weiß "Deep
Fritz 10" eben signifikant mehr und spielt entsprechend stärker.
ND: "Deep Fritz 10" kalkuliert langsamer? Fürchten Sie da nicht, dass Ihr
Computer die Bedenkzeit überschreitet? In Bonn sind das 40 Züge in zwei Stunden,
wie bei normalen Turnieren.
FEIST: "Deep Fritz 10" wird gegen Kramnik noch immer über acht Millionen Stellungen
pro Sekunde analysieren, das sollte wohl reichen.

Acht Millionen Stellungen pro Sekunde gegen menschliche Intuition
ND: Was ist das Erfolgsgeheimnis von "Deep Fritz 10"?
FEIST: Das Programm besteht aus mehreren Komponenten. Eine davon ist das Eröffnungsbuch,
das am Partieanfang benutzt wird. Aufgabe des Buches ist es, „Deep Fritz 10“
in Stellungen zu entlassen, die der Computer gut spielen kann; abgespeichert
sind knapp drei Millionen Positionen. Wenn das Programm im Buch keine Züge mehr
findet oder entscheidet, die Information nicht weiter zu benutzen, beginnt die
Engine zu rechnen.
ND: Diese Daten gleicht "Deep Fritz 10" in einer konkreten Situation ab.
Welche Rechentiefe hat das Programm?
FEIST: Abhängig davon, wie komplex die Stellung ist, werden wir mindestens zwischen
16 und 17 Halbzügen erreichen; das kann aber auch bis zu 20 Halbzügen gehen.
Jeweils ein Zug des Weißen beziehungsweise Schwarzen gilt als ein Halbzug; 20
Halbzüge sind zehn vollständige Schlagwechsel Weiß-Schwarz. Natürlich ist das
nur die Grundrechentiefe; manche Zugfolgen verwirft das Programm recht schnell,
während es andere Variantenbäume durchprüft bis zum 30. oder 40. Halbzug. "Deep
Fritz 10" hat vier Giga-Byte Hauptspeicher und zwei Dual-Core-Prozessoren.
ND: Während der Anfänge der Schachprogrammierung gab es zwei Schulen. Die
einen hofften, den Rechnern strategisches Denken beizubringen. Die anderen setzten
auf "brute force": Mit "roher Gewalt" sollten die Computer in einer gegebenen
Position alle denkbaren Züge untersuchen, so viele wie möglich. Beweist "Deep
Fritz 10", dass die Zukunft der "brute force"-Methode gehört?
FEIST: Strategie oder "brute force", das war der Richtungsstreit in den 70-er
Jahren. Wobei "brute force" zunächst rasch an Grenzen zu stoßen schien, wegen
der Vielzahl an möglichen Zügen; damals haben die Computer bloß drei bis vier
Halbzüge geschafft.
ND: Noch vor wenigen Jahrzehnten behaupteten sogar Fachleute, dass ein Elektronengehirn
niemals Großmeisterniveau erreichen würde. Ein Irrtum, wie sich spätestens 1997
herausgestellt hat, als der IBM-Rechner "Deep Blue" den damaligen Schachweltmeister
Garri Kasparow mit 3,5:2,5 Punkten gedemütigt hat. Liegt es daran, dass die
Maschinen einfach schneller geworden sind?
FEIST: Der Einsatz von Mikroprozessoren hat die Rechenleistungen der Computer
radikal verbessert, das ist sicher ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig wurden
die Maschinen kleiner und die Speicherkapazitäten größer. Außerdem gibt es verbesserte
Programmiertechniken, eine zentrale Rolle spielt das Null-Move-Verfahren. Der
Clou daran: Das Programm tut so, als ob zwei Züge nacheinander - ohne Zwischenzug
des Gegners - möglich wären. Ist die daraus folgende Lage schlecht, dann ist
logischerweise auch der erste der beiden Züge nicht gut und der betreffende
strategisch-taktische Ansatz insgesamt wird verworfen. Das hat den notwendigen
Rechenaufwand um cirka 85 bis 90 Prozent vermindert und Kapazitäten frei gesetzt
für die heute erreichte Suchtiefe; und die wiederum hat die Spielstärke der
Programme gewaltig verbessert.
ND: Wie ist es um das positionelle Verständnis von "Deep Fritz 10" bestellt?
Erkennt die Maschine auf einer offenen Linie einen so genannten "rückständigen"
Bauern? Der schwach und gefährdet ist, weil ihn kein rückwärtiger Kollege mehr
stützt?
FEIST: Ja, natürlich, das ist schließlich eine klare Angelegenheit. Doppelbauern
- das heißt, zwei Fußsoldaten direkt hintereinander, die deswegen als Block
relativ unbeweglich sind - , blockierte Bauern, überhaupt Defekte in der Bauernstellung,
all' das ordnet "Deep Fritz 10" richtig ein.

Was denkt der Rechner?
ND: Wie rechnet "Deep Fritz 10" eine bestimmte Stellung aus - ob sie vorteilhaft
ist oder eher bedenklich?
FEIST: Maßstab ist die kleinste Einheit auf dem Brett, der Bauer. Zeigt "Deep
Fritz 10" nach der Analyse auf dem Bildschirm zum Beispiel die Zahl "1,5" an,
heißt das: Der positionelle Vorteil der betreffenden Seite entspricht dem Mehrbesitz
von 1,5 Bauern.
ND: Die Maschine rechnet, der Mensch ist kreativ - das ist die Vorstellung
in der Öffentlichkeit. Wie kreativ ist "Deep Fritz 10"? Kann das Programm eine
Angriffsidee entwickeln?
FEIST: Aber ja, allerdings gelangt die Maschine dazu auf einem anderen Weg als
der Mensch. Der Computer schließt zunächst andere Möglichkeiten aus, außerdem
berücksichtigt er, ob eine Stellung positive Merkmale aufweist; so ird "Deep
Fritz 10" auch einen Plan für eine direkte Attacke auf den König finden. Eine
Rolle spielt, welche eigenen Figuren rasch dorthin schwenken können und ob der
Monarch, der matt gesetzt werden soll, noch ausreichenden Schutz hinter einer
Reihe Bauern findet. Und: Ist die Abwehrfront solide oder lässt sie sich zertrümmern?
Das sind gewisse Standardpläne, die das Programm enthält; die wendet "Deep Fritz
10" an und versucht ständig, sie im Match zu realisieren.
ND: Kinogänger kennen den Schachcomputer schlechthin; der heißt HAL und steuert
gleichzeitig ein Raumschiff in Stanley Kubricks Kinovision "Odyssee 2001". Ist
"Deep Fritz 10" bereits stark genug, um gegen einen HAL zu bestehen?
FEIST: Momentan wahrscheinlich noch nicht, so wie HAL im Film dargestellt wird,
als der annähernd perfekte Rechner. Aber das wird nicht mehr so weit weg sein.
ND: Auffällig ist, dass die besten Spieler der Welt das "Deep Fritz"-Programm
nicht mehr besiegen können. Kasparow kam 2003 über ein 2:2 nicht hinaus, auch
der deutsche Großmeister Dr. Robert Hübner schaffte 2001 bloß ein Remis mit
3:3.
FEIST: Das ist für die ja auch mittlerweile ganz schwer geworden. Und im Match
gegen Kramnik sehe ich nun sogar eher "Deep Fritz 10" in der Rolle des Favoriten.
Auf jeden Fall streben wir einen 3,5:2,5-Erfolg an. Entscheidend ist freilich
die Einstellung von Kramnik. Verzichtet der Weltmeister darauf, Partien gewinnen
zu wollen, hält Kramnik einfach seinen Laden dicht, dann wird es auch für "Deep
Fritz 10" schwer, eine Entscheidung zu erzwingen. Der Computer müsste sehr langfristige
Pläne entwickeln und würde dann möglicherweise doch an die Grenzen seines Rechenhorizonts
stoßen, trotz der Suchtiefe bis zu 40 Halbzügen.
ND: Falls "Deep Fritz 10" gegen Weltmeister Kramnik gewinnt: Ist Schach für
immer entzaubert? Weil sich die Siliziumintelligenz endgültig als überlegen
erwiesen hat?
FEIST: Trotzdem wird Schach nicht tot sein. Nur eine Sache wird vermutlich aufhören:
dass Menschen gegen Computer spielen. Die Computer werden aber weiterhin für
Analyse und Partievorbereitung eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang erinnere
ich daran, dass menschliche Läufer einst gegen Autos angetreten sind, das war
vielleicht sogar witzig. Mittlerweile ist das völlig witzlos geworden, trotzdem
laufen die Menschen immer noch - aber eben nicht mehr um die Wette mit Rennwagen.
ND: Beunruhigend ist aber der kulturphilosophische Aspekt. Der Entwicklung
der Schachcomputer ist eng verbunden mit den Forschungen auf dem Gebiet der
"künstlichen Intelligenz". Wenn nun eine Maschine derart intelligent ist, dass
sie unbesiegbar wird im tiefsinnigsten Spiel, das Menschen je ersonnen haben
- könnte das nicht ein Menetekel sein? Dass irgendwann die Computer rebellieren
wie in Science-Fiction-Filmen?
FEIST: Da müssen wir uns aber doch die Frage stellen: Was ist denn "künstliche
Intelligenz"? Ein Schachprogramm ist ein hoch spezialisiertes System; in dem
Bereich, auf den es spezialisiert ist, nämlich Schach, ist es durchaus intelligent,
das darf man ruhig behaupten. Bloß versuchen Sie doch einmal, mit einem derartigen
Programm eine Unterhaltung zu führen: Da wird es kläglich scheitern. Die Machtübernahme
durch Schachcomputer ist nicht zu befürchten.
ND: Kramnik kriegt 500.000 US-Dollar Antrittsgeld für seinen Wettkampf mit
"Deep Fritz 10". Gewinnt der Weltmeister, erhöht sich dessen Börse um weitere
500.000 US-Dollar. Umgekehrt geht das "Deep Fritz 10"-Team leer aus, selbst
wenn der Computer Kramnik besiegen sollte. Finden Sie das nicht etwas ungerecht?
FEIST: Nein, für uns ist diese Veranstaltung eine ausgezeichnete Werbung, damit
sind wir vollständig zufrieden. Außerdem ist es eine unvergleichliche Herausforderung,
"Deep Fritz 10" live vom amtierenden Weltmeister testen zu lassen.
ND: Sie, Herr Feist, programmieren nicht nur "Deep Fritz 10", sondern Sie
punkten gleichzeitig für einen niedersächsischen Verein in der Landesliga. Ist
das auch ein persönlicher Antrieb: Mit dem Computer dorthin zu gelangen, wohin
Sie persönlich als Schachspieler sonst niemals gelangen würden?
FEIST: Unterschwellig mag das vielleicht auch ein wenig hineinspielen, das will
ich nicht ausschließen.
ND: Der zweite Mann im Team "Deep Fritz 10" ist der Niederländer Frans Morsch.
Wie teilen Sie die Aufgaben untereinander auf?
FEIST: Der größere Teil der Engine stammt von Frans Morsch; ich habe die Datenbank
mit Endspielwissen aufgestockt und übernehme auch das Testen.
ND: In Bonn gegen Kramnik sind Sie das Gesicht von "Deep Fritz 10"; Sie führen
die Züge aus, die der Computer vorgibt.
FEIST: Frans Morsch mag das nicht, also mache ich das.
ND: Darin haben Sie ja schon Übung. Auch während des ersten Wettkampfes von
"Deep Fritz" gegen Kramnik in Bahrain saßen Sie am Brett ...
FEIST: ... und das ist manchmal richtig anstrengend, insbesondere, wenn der
Computer einen Zug anzeigt, den ich persönlich nicht spielen würde. Das kann
schon an den Nerven zerren. Solche Begegnungen nehmen mich mehr mit als meine
eigenen Partien, die ich im Verein oder in der Liga austrage.
ND: "Deep Fritz 10" ist nicht nur ein Schachprogramm, das Weltmeister ins
Schwitzen bringt; als Version "Fritz 10" kann das auch jeder Amateur kaufen.
Ein Champ im Kasten und zum Anfassen - aber hat der normale Schachspieler überhaupt
noch eine Chance gegen diesen Superrechner, der einen Kramnik fordert?
FEIST: Oh ja! "Fritz 10" verfügt über einen Modus, der sich der Spielstärke
seines Gegners anpasst. Dann versucht Fritz, nicht mehr als 60 Prozent der Partien
zu gewinnen. Damit Sie einen Gegner haben, gegen den es sich zu spielen lohnt
- weil Sie ihn auch mal schlagen können. Dieser spezielle Modus heißt "Freund".

Dr. René Gralla