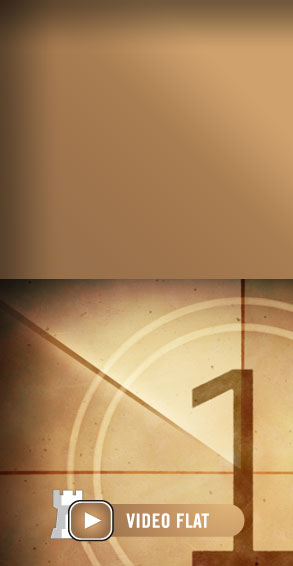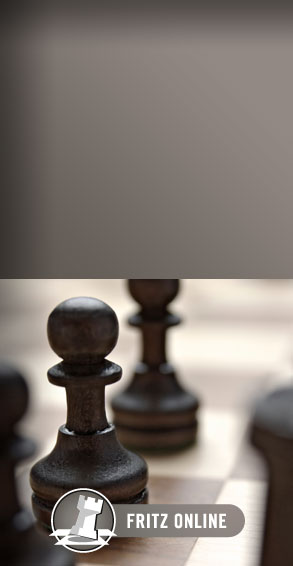Das Interview mit Heinrich Burger wurde von Conrad Schormann geführt und erschien zuerst auf seinem Blog "Perlen vom Bodensee". Nachdruck mit freundlicher Genehmigung. Mit einer Einleitung von André Schulz.
Der Tod des Benno Ohnesorg
Der Besuch des persischen Herrschers Schah Mohammad Reza Pahlavi am 2. Juni 1967 in West-Berlin erzeugte Proteste und Demonstrationen, vor allem durch Studenten, die gegen die politischen Bedingungen und Lebensumstände im Iran protestierten. Während der Proteste kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf zahlreiche Menschen verletzt wurden und der Student Benno Ohnesorg starb. Die Berliner Behörden und auch die Medien haben zeitnah und auch später noch versuch, die Vorgänge zu rekonstruieren, wobei sich aber angesichts unterschiedlicher Berichte und Perspektiven kein völlig klares Bild ergab.
Am Mittag den 2. Juni 1967 versammelten sich etwa 2000 Demonstranten vor dem Schöneberger Rathaus, das vom Schah im Rahmen seines Aufenthalts besucht wurde. Im Verlauf der Proteste griffen Anhänger des Schahs, eigens aus dem Iran als "Jubelperser" zur Unterstützung eingeflogen, die Demonstranten gewaltsam an. Auch die Berliner Polizei ging mit großer Brutalität gegen die Demonstranten vor.
Am Abend versammelten sich erneut etwa 2000 Demonstranten vor der Deutschen Oper, wo der Schah mit seiner Frau, Bundespräsidenten Heinrich Lübke und der Berliner Bürgermeister Heinrich Albertz eine Opernaufführung besuchten. Auch hier kam es zu Provokationen und Gewalttaten zwischen den bestellten Schah-Anhängern und Demonstranten.
Beim Eintreffen der prominenten Besucher wurden die Gäste beschimpft und ohne Erfolg mit Obst beworfen. Die Polizeikräfte erhielten von der Einsatzleitung den Auftrag, den Opernvorplatz bis zum Ende der Aufführung zu räumen und gingen dabei erneut mit großer Brutalität gegen die Protestierenden vor, die vor der Oper eine Sitzblockade versuchten. Die eingeflogene Schläger-und Jubeltruppe des Schachs beteiligte sich an den Krawallen. Fliehende Studenten wurden von Polizisten verfolgt und verprügelt.
Auch der Student Benno Ohnesorge floh zusammen mit anderen Studenten vom Opernplatz in die Krumme Straße. Er wurde dort im Hinterhof des Hauses Nr. 66 gestellt und von drei Polizisten festgehalten und verprügelt, als sich um 20.30 Uhr der Zivilbeamte Karl-Heinz Kurras näherte und aus 1,5 Metern Entfernung zwei Schüsse auf Benno Ohnesorg abgab. Der Student starb kurz danach.
Der Tatort wurde von der Polizei nicht untersucht. Kurras gab zum Tathergang drei verschiedene Versionen ab.
- Er habe sich von den Demonstranten bedroht gefühlt. Daraufhin habe er seine Waffe gezogen und entsichert. Dann habe er einen oder zwei Warnschüsse abgegeben, von denen einer als Querschläger Ohnesorg getroffen habe.
- Im Handgemenge sei seine Waffe aus Versehen losgegangen.
- Zwei Männer mit Messern hätten ihn angegriffen, als er am Boden lag und er habe aus Notwehr geschossen.
Karl-Heinz Kurras wurde wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung angeklagt. In der Hauptverhandlung im November 1967 sagte er aus, eine Gruppe von bis zu zehn Personen habe ihn in der Krummen Straße umringt und mit Messern angegriffen. Zur Verteidigung habe ein oder zwei Warnschüsse abgegeben. Der zweite Schuss habe sich in einem Handgemenge gelöst und Ohnesorg versehentlich getroffen. Von 80 Zeugen bestätigte nur einer diese Beschreibung des Tathergangs. Da ein Gutachter Kurras eine eingeschränkte Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeit attestierte, sprach der Richter ihn frei, obwohl er Kurras Aussage nicht für glaubwürdig hing. Auch im Revisionsverfahren wurde Kurras frei gesprochen.
Der Märtyrertod von Benno Ohnesorge spielte im Gründungsmythos der "68er" eine große Rolle und wurde auch bei der Radikalisierung der Studentenbewegung bis hin zum Linksterrorismus der 1970er und 1980er Jahre immer wieder angeführt. Die "Rote Armee Fraktion" und die "Bewegung 2. Juni" bezogen sich bei der Begründung ihrer Haltung und ihrer Taten auf den Tod von Benno Ohnesorg.
Einer der Fotografen, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um Fotos vom sterbenden Benno Ohnesorg zu machen, war Heinrich Burger. Er war zu dieser Zeit Polizeifotograf. Später wurde er Pressesprecher der SPD.
Außerdem war Burger aktiver Schachspieler. Als Fernschachspieler nahm er am Halbfinale der 11. Fernschachweltmeisterschaft teil. Später ernannte ihn der ICCF zum Fernschachgroßmeister. 1974 wurde Heinrich Burger zum Präsidenten des Berliner Schachverbandes gewählt.
1976 wurde Burger jedoch als DDR-Agent enttarnt und 1977 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er wurde aber nach kurzer Haftzeit gegen in der DDR inhaftierte Westagenten ausgetauscht und spielte ab 1979 in der DDR Schach.
2009 wurde dann bekannt, dass auch der Todesschütze Karl-Heinz Kurras ein Agent der DDR-Staatsicherheit gewesen war. Dies warf ein ganz neues Licht auf die Vorgänge in der Krummen Straße 66 vom 2. Juni 1967. Neue Untersuchungen ergaben, dass Kurras den Studenten Benno Ohnesorg unbedrängt aus kurzer Distanz erschossen hatte, so dass der Verdacht auf absichtliche Tötung nahe lag. Ein schriftlicher Mordauftrag des MfS wurde im Zuge der neuen Ermittlungen jedoch nicht gefunden. Die Ermittlungen zum Mordverdacht wurden 2011 ohne Ergebnis eingestellt. Karl-Heinz Kurras starb im Dezember 2014.
Cui bono?, fragten sich die Römer in solchen Fällen. In der ideologischen Auseinandersetzung mit der BRD haben die Unruhen um den Schah-Besuch und besonders der Tod des Studenten Benno Ohnesorg der DDR sehr genützt, denn sie führten zur Destabilisierung der BRD und einem erbitterten ideologischen Glaubenskampf mit vielen Gewalttaten.
Heinrich Burger lebt immer noch in Berlin und ist dem Schach verbunden. Als er die Fotos vom sterbenden Benno Ohnesorg machte, sei er noch kein DDR-Agent gewesen, gibt er in seinem Interview mit Conrad Schormann an. Die Stasi hätte ihn erst 1968 angeworben.
André Schulz
Interview mit Heinrich Burger
Herr Burger, beginnen wir unsere Zeitreise am 2. Juni 1967, dem Tag, an dem Benno Ohnesorg erschossen wurde.
Als Polizeireporter der Berliner Morgenpost war ich mitten im Tumult, aber den Schuss habe ich nicht wahrgenommen, daran habe ich keine Erinnerung. Wahrscheinlich war ich zu angespannt.
Wie sind Sie in den Berliner Hinterhof geraten, in dem es geschah?
Auf den Straßen war Aufruhr, ich bin mit meiner Nikon dem Pulk von prügelnden Polizisten und fliehenden Demonstranten gefolgt, plötzlich waren wir in diesem Innenhof mit seinen überdachten Parkplätzen. Was vor sich geht, habe ich nur schemenhaft gesehen, auch die Szene, in der die drei Polizisten auf den am Boden liegenden Studenten einschlagen. Erst als meine Negative im Labor im Springer-Haus entwickelt waren, sah ich auf den Abzügen, was sich genau abgespielt hatte.
Mehr als 40 Jahre später stellte sich heraus, dass Ihr Foto den Moment zeigt, in dem Karl-Heinz Kurras Benno Ohnesorg erschießt.
2009 haben die Behörden ein weiteres Mal die Ermittlungen aufgenommen. Ich wusste davon, weil der Autor Uwe Soukup es mir gesagt hatte. Soukup hatte mich für sein Buch über den 2. Juni 1967 um Fotos gebeten, leider konnte ich ihm nicht helfen. Aber dann klingelte es am Morgen des 15. Juni 2010. Vor der Tür stand Oberstaatsanwalt Dirk Feuerberg mit einer Heerschar von Beamten – eine Hausdurchsuchung. Die hat sich im Nachhinein als nützlich erwiesen. In einer Kiste im Keller fanden die Beamten tatsächlich die Negative von jenem Tag. Sie waren zwischen andere Unterlagen geraten, die mit Fotos nichts zu tun hatten.
Hätte der Staatsanwalt Sie nicht einfach fragen können?
Es hatte sich herausgestellt, dass Kurras als informeller Mitarbeiter für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) gearbeitet hatte, darum die neuen Ermittlungen. Seitens der Staatsanwaltschaft stand die Frage im Raum, ob es sich bei der Tat am 2. Juni 1967 um einen von der DDR gesteuerten Auftragsmord gehandelt hat – und ob ich als ehemaliger DDR-Kundschafter womöglich in die Sache verwickelt war. Das ist kurios, weil ich 1967 noch gar nicht für die DDR gearbeitet habe. Aber immerhin tauchte das entscheidende Foto wieder auf. Die Behörden haben mit Hochleistungsgeräten Abzüge gemacht, darauf ist tatsächlich Kurras zu sehen.

Kurras vor der Verteidigerbank auf einem Stuhl sitzend, seitlich fotografiert. Hinter ihm sitzt sein Verteidiger Roos und studiert einen Vorgang. 14 November 1967. Ludwig Binder: Studentenrevolte 1967/68, West-Berlin; veröffentlicht vom Haus der Geschichte. Stiftung Haus der Geschichte. Quelle: Wikipedia
Neben dem Beruf war ich damals links engagiert, bei verschiedenen Gesprächsrunden aktiv, das war bekannt. 1968, unsere Tochter war gerade ein halbes Jahr alt, klingelte ein Fotoreporter von der DDR-Nachrichtenagentur ADN. Angeblich interessierte er sich für meine Fotos. Meine Frau und ich, beide sozialistisch eingestellt, haben ihm gerne geholfen. Wenig später folgte eine Einladung nach Ost-Berlin, da sind wir unserem späteren Führungsoffizier begegnet. Der sagte erst, er sei von der Presse, aber bald hat er sich als MfS-Mitarbeiter offenbart. Und er fragte, ob wir als Kundschafter für die DDR arbeiten wollen. Wir waren damals begeistert von linken Ideen, wollten gerne etwas für den Sozialismus tun, ohne zu wissen, wie der real aussah. Also haben wir zugesagt. Meine Frau und ich unterschrieben eine Verpflichtungserklärung, so fing das an.
Nun mussten Sie in Positionen aufsteigen, in denen Sie Sachen hören, die für die DDR wichtig sind.
Ich war lange SPD-Mitglied gewesen, ohne mich zu engagieren. Das MfS forderte mich auf, die Mitgliedschaft zu aktivieren. Außerdem habe ich den Arbeitgeber gewechselt, bin Chef vom Dienst bei der Berliner Stimme geworden. In dieser Funktion hatte ich viel mit Brigitte Seebacher zu tun, der späteren Frau von Willy Brandt. Brigitte machte damals Öffentlichkeitsarbeit für die SPD, wollte aber lieber journalistisch arbeiten. Wir haben dann getauscht. Sie übernahm meinen Job bei der Berliner Stimme, ich ihren bei der SPD. Dort wurde ich Pressesprecher. Als solcher konnte ich an den Sitzungen des geschäftsführenden Landesvorstands teilnehmen, bei denen der oberste Zirkel der Berliner SPD zusammentraf. Innensenator und Bürgermeister Kurt Neubauer zum Beispiel war stets dabei. Ich bekam Interna zu hören, die das Ministerium für Staatssicherheit hochinteressant fand. Aus meiner Sicht war das alles gar nicht so bedeutend.

Heinrich Burger als Pressesprecher der SPD
Zum Beispiel?
Ach, zum Beispiel ging es darum, wie sich die Berliner SPD das Passierscheinabkommen mit der DDR vorstellt.
Die Politik war damals durchsetzt mit Agenten.
Allerdings. Ein weiterer Abteilungsleiter aus diesem Landesvorstand ist noch nach der Wende verurteilt worden, als rauskam, dass er ebenfalls für die Stasi gearbeitet hatte. Es waren damals unglaublich viele Spione unterwegs. Wahrscheinlich hat es sich nicht nur im Landesvorstand der Berliner SPD überschnitten.
Sie sollten auch für die West-Seite spionieren, für das Berliner Landesamt für Verfassungsschutz.
Das ergab sich aus meiner nun engagierteren Mitarbeit bei der SPD. Ein Genosse in Wilmersdorf war Mitarbeiter im Verfassungsschutz Berlin. Der sprach meine Frau und mich 1969 an, ob wir unsere Erkenntnisse über die Studentenszene mit dem Verfassungsschutz teilen würden. Wir haben das mit unseren Leuten in der DDR geklärt, die fanden das wunderbar und haben gesagt: „Machen!“ Das MfS wollte natürlich wissen, woran der BRD-Verfassungsschutz besonders interessiert ist.
Sie waren Doppelagent.
Wenn Sie so wollen. Doppelagent in Absprache mit dem MfS der DDR.
Hat Sie das MfS in Berlin ideal platziert gesehen? Sollten Sie weiter aufsteigen?
Wäre ich nicht aufgeflogen, wäre ich wahrscheinlich in Bonn gelandet. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Marie Schlei war sehr interessiert daran, mich in die damalige Hauptstadt zu holen.
Aufgeflogen sind Sie, weil Ihre Frau die Agententätigkeit gestanden hat …
… und da sind wir wieder beim Berliner Verfassungsschutz, namentlich bei Oberamtsrat Michael Grünhagen, der später bei den Ermittlungen rund um den Mord am V-Mann Ulrich Schmücker eine zentrale Rolle spielte. Mit Grünhagens Familie waren wir befreundet. Meine Frau hat ihm gestanden, dass sie und ich als Kundschafter für die Stasi arbeiten. Danach geriet sie in Panik, sie ist mit unserem Kind nach Ost-Berlin geflohen. Den Behörden dort hat sie aber nicht erzählt, was sie im Westen schon alles gestanden hatte. Sie dachte, das lässt sich reparieren. Sie wurde dann in den Westen zurückgeschickt. Ich war zu der Zeit in Portugal im Urlaub, mich hatte sogar ein Freund von der dpa telefonisch gewarnt, was meine Frau getan hatte. Ich bin trotzdem zurückgeflogen. Bei der Ankunft am Frankfurter Flughafen wurde ich verhaftet.
Und später verurteilt zu sieben Jahren Gefängnis.
Aber ich bin nach drei Jahren gegen vier BND-Agenten ausgetauscht worden. Einer von denen, ein Mitglied der CDU, war während der Haft in der DDR umgedreht worden. Der hat nach dem Austausch in Berlin wieder für die CDU gearbeitet und dabei für die DDR spioniert – bis er enttarnt worden ist. Dann saß er im Westen im Gefängnis.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer damaligen Frau?
Wir haben uns nach der Wende wiedergesehen. Und wir haben uns beim jeweils anderen entschuldigt. Ich dafür, dass ich im Prozess versucht hatte, sie als unglaubwürdig darzustellen, sie dafür, dass sie mich ins Gefängnis gebracht hat. Wir waren beide reumütig. Heute haben wir eine gute Beziehung zueinander.
Wie sehen Sie Ihre Arbeit für das Ministerium für Staatssicherheit heute?
Im Nachhinein betrachtet, war das alles sinnlos. Der „real existierende Sozialismus“ existiert ja nicht mehr, er ist untergegangen. Für das, was ich getan habe, verurteile ich mich aber nicht. Schon damals habe ich mich für vieles eingesetzt, das mich heute immer noch bewegt: Frieden in der Welt, Gerechtigkeit, Umweltschutz. Meine Grundhaltungen haben sich kaum geändert …
… aber sie sind nicht mehr ideologisch aufgeladen?
Ich bin fern aller Ideologien und kämpferischen Haltungen. Den Kapitalismus halte ich allerdings nach wie vor für eine Gesellschaftsform, die unsere Umwelt kaputtmacht, die unseren menschlichen Beziehungen schadet und so weiter. Wie wir derzeit wirtschaften und leben, das geht auf Dauer nicht gut. Als Menschheit müssen wir einen Weg finden, auf eine friedliche und soziale Weise miteinander auszukommen.
Kritisch gegenüber unserer Gesellschaftsordnung sind Sie offenbar immer noch.
Aber damals unterlag ich der falschen Annahme, dass sich Dinge erzwingen und mit Gewalt überwinden lassen – siehe die Erziehungsdiktatur in der DDR. Gerechtigkeitsgefühl und soziales Miteinander lassen sich nicht anordnen. Dahinzukommen, ist ein Prozess. Damals habe ich nicht verstanden, dass eine mit Direktiven gesteuerte Gesellschaft nicht konkurrenzfähig ist, schon gar nicht konkurrenzfähig mit einer kapitalistischen, die ohne Skrupel Verlierer zurücklässt. In der DDR wurde einerseits vieles, das nicht funktionierte, künstlich am Leben gehalten, andererseits war die Kreativität des Einzelnen stark beschnitten. Dieses System konnte nicht bestehen gegenüber einer Gesellschaft, in der sich Kräfte frei entfalten und in der sich die Besten durchsetzen. Die DDR war zum Scheitern verurteilt, das ist mir erst spät klargeworden.
Im März 1974 wurden Sie Präsident des Berliner Schachverbands. Hatte da auch das Ministerium für Staatssicherheit die Finger im Spiel?
Gar nicht. Ich war ein bekannter Berliner Schachspieler, und aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit wurde angenommen, dass ich organisatorisch manches auf die Beine stellen kann. Ich bin gefragt worden, habe nach kurzer Überlegung zugesagt, dann wurde ich als Nachfolger von Alfred Kinzel gewählt.

Kinzel wurde damals DSB-Präsident, das hätte auch Ihr Weg sein können. Vielleicht wäre in den Jahren nach dem Fischer-Spassky-Match Schachpolitik auf der deutsch-deutschen oder internationalen Ebene für das MfS interessant gewesen.
Wirklich nicht. Ich kann es nicht belegen, aber nehme eher an, dass mein Schach-Engagement in der DDR gar nicht so gerne gesehen wurde. Es hat ja Kräfte absorbiert, die ich anderweitig – politisch – hätte einsetzen können.
Wie lief Ihre Kommunikation mit dem MfS?
Es gab verschiedene Kanäle. Einer davon war mein sogenannter Funkwagen, den ich als Polizeireporter fuhr: ein Kombi mit einem Funktelefon. Vorne konnte man den Hörer abnehmen, der hintere Teil des Wagens war voll mit dem Gerät, ein riesiger Kasten. Damit konnte ich schon 1968 mobil mit der Redaktion telefonieren, zum Beispiel durchgeben, was für Fotos von mir zu erwarten waren, wenn ich bei irgendeinem Ereignis gewesen war. Damals war das etwas ganz Besonderes. Im Springer-Haus hatten wir, glaube ich, nur zwei dieser Wagen. Einen fuhr ich. Diesen Kanal habe ich oft genutzt, um die Genossen in Ost-Berlin zu informieren.
Gab es direkten Kontakt zur Stasi?
Die wichtigste Schiene war die über den Kurier. Den hatten wir in einem konspirativen Haus in Glienicke kennengelernt, wo wir uns beraten haben, dort haben wir auch gelegentlich übernachtet. Dieser Mann, Hans Goldschmidt, wurde mein Freund und kurioserweise später mein Chef, als ich in der DDR lebte, dazu kommen wir später bestimmt noch. Eine andere Kontaktperson war unsere Putzfrau. Die war uns vom MfS vermittelt worden. In Wirklichkeit tat sie nur so, als würde sie putzen. Sie hat Bänder mitgenommen, die ich besprochen hatte, manchmal auch Filme von meiner Minox.
Eine Minikamera. Die war Teil Ihrer Agentenausstattung?
Damit habe ich bei der SPD Dokumente abfotografiert, manchmal mit selbstgebastelter Beleuchtung, indem ich Lampen an eine Stuhllehne klemmte, damit es hell genug ist.
Keine Agentengeschichte ohne geheimen Briefkasten.
Den gab es, ein hohler Baumstumpf in einem Park in Schöneberg in der Nähe unserer Wohnung. Dort habe ich gelegentlich Sachen deponiert.
Wie hat das MfS Sie auf dem Laufenden gehalten oder Anweisungen gegeben?
Entweder bei unseren direkten Treffen in Ost-Berlin oder über den Kurier, der Aufträge, Wünsche oder Einschätzungen der von uns gelieferten Berichte brachte. Auf diese Weise hatten wir ein Feedback. Aber wir mussten aufpassen, dass der Kurier nicht zufällig Besuchern über den Weg läuft. Eine Lampe im Fenster war das Warnzeichen. Wenn sie leuchtete, wusste er, dass er nicht klingeln kann.

Heinrich Burger mit Kater Paulchen
Ihre Arbeit, Ihre Agententätigkeit - Sie waren in dieser Zeit alles andere als unterbeschäftigt. Wie kamen Sie dazu, ambitioniert Schach zu spielen? Und dazu noch das zeitintensive Fernschach?
Mit Fernschach habe ich früh angefangen. Zu Beginn meiner Studentenzeit Anfang der 60er-Jahre habe ich mich oft geärgert, dass ich Gewinnstellungen nicht gewinnen konnte. Mal reichte die Konzentration nicht, mal verrechnete ich mich. Ein Kommilitone war Fernschachspieler, der bat mich, ihm bei den Analysen zu helfen. So habe ich festgestellt, dass Fernschach auch etwas für mich ist. Da konnte ich in Ruhe überlegen. Fortan hat Fernschach bei mir immer eine größere Rolle gespielt als Nahschach.
Aber Sie haben im Nahschach Bundesliga gespielt?
Am ersten und zweiten Brett sogar. Mit Lasker-Steglitz sind wir 1974 in die Bundesliga-Endrunde gekommen. Gleich zum Auftakt spielten wir gegen den späteren Meister Solinger SG. Ich bekam es am zweiten Brett mit Lubomir Kavalek zu tun, am ersten Brett spielte mein Mannschaftskamerad Herbert Kauschmann gegen Robert Hübner. Kavalek hatte sich auf meinen offenen Spanier vorbereitet, setzte mir eine Neuerung vor und gewann. Die Partie ist oft veröffentlicht wurden, nur konnten die Schachmagazine mit dem Namen „Burger“ nichts anfangen. Die Partie ist als Lubomir Kavalek - Arthur Bisguier in die Schachgeschichte eingegangen, das habe ich nie korrigiert. Jedenfalls war ich im Nahschach wahrscheinlich nicht ganz schlecht, aber auch nichts Besonderes. Knapp über 2200.
Als Sie aufgeflogen waren und in Haft saßen, haben Sie aus dem Gefängnis heraus weiter Fernschach gespielt. Ging das einfach so?
Zu Beginn saß ich eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft, da lief gerade das Semifinale zur Weltmeisterschaft. Einer meiner Gegner war ein bekannter DDR-Meister. Speziell bei dieser Partie hatte ich Sorge, dass die Behörden nun meinen Postverkehr unterbinden. Aber sie haben mich weiterspielen lassen. Weil in der DDR wahrscheinlich die Stasi mitlesen würde, habe ich auf meinen Karten stets meine Situation in der Haft geschildert. Später stellte sich heraus, dass die Karten an meinen Schachfreund in der DDR tatsächlich über einen Stasi-Schreibtisch liefen. So war man dort immer informiert, wie es mir geht. Aus der Haft heraus habe ich auch die Deutsche Meisterschaft mitgespielt. Ich bin Vizemeister geworden, punktgleich mit Heinz-Wilhelm Dünhaupt, der die bessere Wertung hatte.
Sie waren auch schachjournalistisch tätig.
Für die Deutsche Schachzeitung habe ich im Gefängnis gearbeitet. Deren Chefredakteur Rudolf Teschner war ein Freund unserer Familie, er kannte meinen Vater, war oft zu Besuch, bei diesen Gelegenheiten haben auch wir die eine oder andere Partie gespielt. Für mich war Teschner immer ein väterlicher Freund. Für seine Zeitung habe ich Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche gemacht und gelegentlich Partien kommentiert. Das ging während der Haft weiter.
Nach drei Jahren Gefängnis der Austausch auf der berühmten Glienicker Brücke …
… nein, da war er nicht, das ist ein Fehler in meinem Wikipedia-Eintrag. Der Austausch lief viel prosaischer ab. Das fing an mit meinem Mittagessen im Gefängnis: Pellkartoffeln mit Quark, in die ich mir reichlich Zwiebeln geschnitten hatte, eines meiner Lieblingsgerichte. Ich hatte mir den Magen vollgeschlagen, wollte mich gerade zum Mittagsschlaf hinlegen, da kam ein Aufseher rein: „Herr Burger, packen Sie Ihre Sachen zusammen.“ Der Gefängnisdirektor hat mich dann zu einer Rechtsanwaltskanzlei am Kurfürstendamm gefahren, wo wir noch auf den Senatsbeschluss warten mussten, dass ich begnadigt und freigelassen werde. Und dann haben die versucht, mich zu bewegen, nicht nach Ost-Berlin zu gehen. Ich bekam meinen Ausweis zurück, es hieß: „Herr Burger, Sie sind frei.“ Ich wurde fast gedrängt, nun auf die Straße zu gehen, ich sei ja ein freier Mann.
Sie hätten im Westen bleiben können.
Mir kam das verdächtig vor, und ich habe lieber gewartet, bis mein Anwalt, der DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, mich abholt. Und der sagte mir, ich werde erwartet. Mit Vogels Mercedes sind wir dann am Grenzübergang Invalidenstraße rübergefahren. Der fuhr einfach durch! Keine Kontrolle, gar nichts. Als die Grenzer ihn sahen, gingen sofort die Schlagbäume hoch. Ein paar Tage später hat Vogel auf dem gleichen Weg mein Hab und Gut aus dem Gefängnis geholt. Meine Zelle war ja vollgestopft, vor allem mit Büchern. Vogel hat seinen Mercedes mit meinen Sachen vollgepackt und auch die rübergebracht.
In der DDR standen Sie wahrscheinlich anfangs ohne Job da.
Nein, das war geregelt. Es war klar, dass ich in die Kinderfilmgruppe des DEFA-Dokumentarfilmstudios gehen kann, in den Betriebsteil Berlin. Es gab zwei Betriebsteile, neben dem in Berlin noch die bekannteren Spielfilmstudios in Babelsberg. Ich ging zum Dokumentarfilm. Dort war nämlich Hans Goldschmidt, mein früherer Kurier, mittlerweile Chef der Kinderfilmgruppe. Mir hatte er den Posten des Chefredakteurs freigehalten, bis ich aus der Haft entlassen wurde und in die DDR kam. Das war 1979. Bevor ich die Arbeit antrat, unternahm ich mit meiner damaligen Frau zwei Reisen, nach Jalta zum Beispiel mit Chauffeur und allem Drum und Dran, eine Belohnung für unsere Kundschaftertätigkeit.
Sie sind von der schreibenden Zunft zum Bewegtbild gewechselt, anscheinend nicht ganz freiwillig. Hat Sie die neue Arbeit ausgefüllt?
Die neue Arbeitsstelle ist mir nicht zugewiesen worden. Das war ein Vorschlag, den ich toll fand, über den ich mich riesig gefreut habe. Dokumentarfilm hatte mich immer interessiert, mir hat die Arbeit von Beginn an Freude gemacht. Auch die anfängliche Skepsis der Kollegen, die meine Geschichte natürlich kannten, verflog schnell.
Aus dem Springer-Haus und der West-Berliner Politik zum DDR-Dokumentarfilm. War es leicht, sich einzufügen?
Meine burschikose West-Art, wenn Sie so wollen, mein Selbstvertrauen, mit dem ich auftrat, haben mir geholfen. In Verhandlungen mit der Hauptverwaltung Film habe ich in der DDR manches Projekt durchgesetzt, an dem mir am Herzen lag, das aber auf große Skepsis der Behörden gestoßen war.
Gibt es bekannte Werke, bei denen Ihr Name im Vor- oder Abspann steht?
Nicht solche von der Kinderfilmgruppe. Dort war meine Arbeit redaktioneller Art. Ich habe Regisseure und Dramaturgen angeleitet, sie bei der Entwicklung von Stoffen begleitet, ihre Arbeit redigiert. Aber ich habe dann ein „postgraduales Studium Kulturpolitik“ absolviert, auch das mit großer Freude und durchgehend sehr gutem Erfolg. 1983 wurde ich Leiter der „Gruppe Dokument“. Dort entstanden die Dokumentarfilme bekannter Regisseure. Winfried Junge, Volker Köpp, Jürgen Böttcher und viele andere waren Teil der Gruppe, die ich leiten durfte. Winfried Junges Langzeitprojekt „Kinder von Golzow“ stockte damals seit einigen Jahren, es lag auf Eis. Ich habe mich in Absprache mit Junge bei der Hauptverwaltung Film dafür eingesetzt, dass es weitergeführt wird – und hatte Erfolg. Vielleicht war das meine größte Tat damals. Unter dem Namen „Lebensläufe“ wurde ein Riesenprojekt daraus, das bis in die Gegenwart reicht. Erwähnen möchte ich noch Jürgen Böttcher, der damals nur noch malte und keine Filme mehr machte. Ich habe erreicht, dass er zusammen mit einem Redakteur ein neues Filmprojekt angeht. Daraus entstand das preisgekrönte Werk „Rangierer“. Seitdem macht Jürgen Böttcher wieder Filme
Wurden Sie ein linientreuer DDR-Bürger?
Lassen Sie mich das anhand meiner Bekanntschaft mit dem Dissidenten Konrad Weiß erläutern, dem späteren Bundestagsabgeordneten. Auch der war anfangs Mitglied der Kinderfilmgruppe, daher kannten wir uns. Als ich zum Leiter der Gruppe Dokument aufstieg, haben wir viele vertrauensvolle Gespräche geführt. Durch meine Kontakte in die Hauptverwaltung war ich häufig informiert, wenn etwas gegen ihn lief, und habe das an ihn weitergegeben. Ein Jahr nach der Wende veranstaltete Konrad Weiß bei sich zu Hause eine „Jahreswendefeier“, bei der unter anderem der spätere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse zu Gast war, ein Freund von ihm, den ich auch kannte, weil er bei uns als Autor gearbeitet hatte. Zu dieser Feier unter Dissidenten lud Konrad Weiß mich ein, den ehemaligen MfS-Kundschafter. Daraus lässt sich ablesen, dass ich in diesen Kreisen als jemand geschätzt wurde, dem man vertrauen kann.

Demonstration in Ost-Berlin: An solchen Präsentationen der Betriebe und ihrer Produkte nahmen auch die DEFA-Studios teil. Rechts grüßt Heinrich Burger, links wirbt der Hauptdramaturg der Gruppe „document“ Wolfgang Geier für eines der bemerkenswertesten Werke seiner Gruppe.
Also verflog ihre Begeisterung für den Arbeiter- und Bauernstaat, als sie dort lebten?
Heute schaue ich gerne auf meine Zeit in der DDR zurück, das liegt vor allem an den zehn Jahren bei der DEFA, wo wir große künstlerische Freiheit und erhebliche Mittel hatten. Dort hatte ich das Gefühl, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, nützlich zu sein, anderen zu helfen. Andererseits entwickelte sich Skepsis. Nach etwa eineinhalb Jahren sah ich ein klares Bild von den Verhältnissen in der DDR, und ich ging in eine kritische Distanz. Ein Anhänger des Sozialismus bin ich gleichwohl geblieben. Christa Wolfs Aufruf „Für unser Land“ habe ich wie viele andere Kulturschaffende unterschrieben. Christa Wolfs Ziel, die DDR zu erhalten und etwas Gutes daraus zu machen, das später einmal ein vereintes Deutschland bereichert, habe ich geteilt.
Ihrer Schachleidenschaft sind Sie in der DDR treu geblieben. Inwiefern unterschied sich das DDR-Schach vom westdeutschen?
Die Vereine waren anders strukturiert, meist an Betriebe oder Institutionen gebunden. Ich wurde Mitglied bei AdW, Akademie der Wissenschaften, dem Verein des späteren Fernschach-Weltmeisters Fritz Baumbach. Der nahm sofort mit mir Kontakt auf, ich habe ihm dann bei den Analysen für seine WM-Partien geholfen.
Sie wurden DDR-Nationalspieler.
Für die DDR habe ich bei der Fernschach-Olympiade gespielt, bei der wir als DDR-Nationalmannschaft eine Bronzemedaille gewannen, als die DDR schon lange nicht mehr existierte. Das war eine so interessante Geschichte, wir wurden sogar zu Günther Jauch eingeladen. Zum Schluss der Sendung ließ Jauch die DDR-Fahne hissen, und es ertönte „Auferstanden aus Ruinen“.
Nach der Wiedervereinigung waren Sie Nationalspieler fürs vereinigte Deutschland.
Bei der Fernschach-Olympiade wurde ich fürs erste Brett nominiert. Wir haben gemeinsam mit den punktgleichen Tschechen die Goldmedaille gewonnen. Bei der Gelegenheit habe ich eine von meinen beiden Großmeisternormen gemacht. Anfang der 90er bekam ich den GM-Titel verliehen.
Wie ging es nach der Wende beruflich weiter?
Dramatisch. Das DEFA-Dokumentarfilmstudio ist abgewickelt worden, später zog dort Sat.1 ein. Anfangs hatten wir Hoffnung, das Studio zu erhalten, aber das verflüchtigte sich bald. Es fehlte Geld, die Konkurrenz war groß, wir waren auch gar nicht gewollt. Die Gruppen wurden aufgelöst, das Studio übertrug mir die Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe Vorführungen gemacht, Präsentationen gehalten oder Pressekonferenzen organisiert. West-Berater sollten uns damals den Übergang erleichtern. Einer von denen meldete sich entsetzt bei der Studioleitung: Wie man denn dem ehemaligen Stasi-Mann Burger die Öffentlichkeitsarbeit anvertrauen könne. Ich wurde ins Archiv versetzt, ein besserer Abstellraum. Dann die Arbeitslosigkeit, als das Studio aufgelöst wurde.
An Kontakten für eine weitere Tätigkeit mangelte es Ihnen nicht.
Mehrere Regisseure haben damals versucht, mich zu überreden, eine Filmproduktionsfirma zu gründen, mit der ich sie weiter betreue. Heute bedauere ich manchmal, dass ich das nicht gemacht habe, aber eine solche Entscheidung hätte alle meine anderen Interessen beeinträchtigt, vor allem das Fernschach, das ich mit großer Energie und mit großem Erfolg betrieb. Ein Filmproduzent hätte keine Zeit für so ein Hobby. Nach zweijähriger Arbeitslosigkeit fand ich einen Job, bei dem ich mir meine Zeit selbstständig einteilen konnte: Außendienst bei der Debeka. Dort habe ich bis zur Rente 2006 gearbeitet.
Spielen Sie noch Fernschach?
Damit habe ich lange aufgehört. Es war eine Leidenschaft, aber als nach und nach die Engines übernahmen, verlor es seinen Reiz. Ich hatte keine Freude mehr daran. Heute kann man Fernschach nur noch spielen, wenn man mit mehreren Engines arbeitet, diese extrem tief suchen lässt und dann noch Ideen findet, die tiefer gehen als das, was die Engine gesehen hat. Und trotzdem enden fast alle Partien remis. Wer sehr gewissenhaft arbeitet, hat geringe Chancen, eventuell eine Partie zu gewinnen.
Wo trifft man Sie heute am Brett?

Heinrich Burger 2012 beim Lichtenberger Open | Foto: BSV
Ich spiele für einen kleinen Berliner Verein, Caissa heißt der. Aber seit Beginn der Pandemie findet dort kaum noch etwas statt. Es wird jetzt wieder zaghaft versucht, mit Maske zu spielen, aber das möchte ich nicht. Vier Stunden, hinter der Maske wird es warm, die Brille beschlägt, das ist nichts. Wahrscheinlich werde ich erst wieder am Brett auftauchen, wenn wir wieder ganz normal spielen können.
Hoffen wir auf einen Impfstoff.
Ich habe gerade die Spiegel-Titelgeschichte über die Impfstoff-Entwicklung gelesen und würde vermuten, dass wir uns noch mindestens ein Jahr gedulden müssen. Es kann sein, dass die Pandemie mein Nahschach-Leben am Brett beendet.
So eine traurige Note zum Schluss?
Ich sage das ja nicht wegen meines Alters. Zwar werde ich nächstes Jahr 80, aber ich fühle mich viel jünger, mir geht es gut. Nein, mir erscheint die Pandemie wie eine Schachentwöhnung. Das Spiel verschwindet aus dem Leben. Ich will jetzt mal meine Accounts auf diversen Schachseiten aktivieren, mich dem Online-Spiel widmen und mich an kürzere Bedenkzeiten herantasten. Bislang habe ich phasenweise täglich eine Zehn-Minuten-Partie gespielt, um hinterher Partieanlage und Eröffnung zu studieren, niemals eine Blitzpartie nach der anderen. Aber das muss man wohl tun, um Freude daran zu entwickeln. Allerdings habe ich seit einiger Zeit eines meiner anderen Hobbies, das Fotografieren, wieder intensiviert. Das kostet enorm viel Zeit, wenn man es erst nimmt.
Die Fragen stellte Conrad Schormann.
Der Spiegel: Aus kurzer Distanz...
Deutschlandfunk: Gründungsmythos mit Fragezeichen
Berliner Morgenpost: ... im Kalten Krieg...