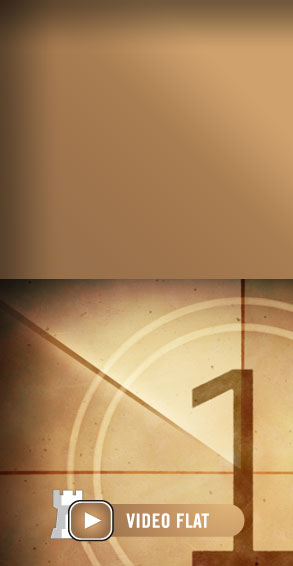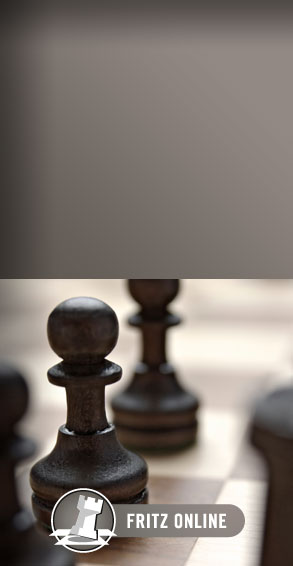Interview mit Prof. Robert von Weizsäcker, Präsident des Deutschen
Schachbundes

Horst Metzing, Geschäftsführer des DSB und Präsident Robert von Weizsäcker
ChessBase: Vor zwei
Jahren wurden Sie auf dem Kongress des Deutschen Schachbundes zum
Präsidenten des DSB gewählt. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz zu den
vergangenen zwei Jahren als DSB-Präsident aus?
Prof. Robert von
Weizsäcker: Gleich in meiner ersten Amtszeit als Präsident des Deutschen
Schachbundes stand das Schachleben in Deutschland vor einer historischen
Dimension. Mit der Weltmeisterschaft in Bonn und der Olympiade in Dresden
konnten wir Höhepunkte erleben, die es seit Jahrzehnten in unserem Land
nicht gegeben hat. Der DSB hat diese Ereignisse nach besten Kräften genutzt,
um Schach im In- und Ausland zu präsentieren und zu popularisieren.
Als DSB-Präsident
verfolge ich in erster Linie das Ziel, die gesellschaftliche Akzeptanz des
Schachs in Deutschland zu erhöhen und damit den Schachsport auf allen Ebenen
zu fördern. Das Herunterbrechen dieses Anliegens in den Mikrokosmos
spezifischer Verbandsstrukturen ist keine triviale Übung, da sich der DSB
als Verband der Verbände einer Reihe von Anreizproblemen gegenübersieht. Das
habe ich vor meiner Wahl vor zwei Jahren geahnt, und jetzt weiß ich es aus
eigener Erfahrung.
Wie bereits vor meinem
Amtsantritt betont, verfüge ich im Gegensatz zu meinen Vorgängern nur über
ein sehr begrenztes Zeitbudget. Es gehörte daher zu meinen ersten
Amtshandlungen, eine Aufteilung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
vorzuschlagen. Die operative Führung des DSB im engeren Sinne liegt
außerhalb meiner zeitlichen Möglichkeiten. Diese erfolgt durch das
Geschäftsführende Präsidium sowie das Präsidium insgesamt im Zusammenwirken
mit der Geschäftsstelle. Die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre haben
nun gezeigt, dass eine gewisse Dezentralisierung der Führung mit den gegeben
Strukturen zum Teil unvereinbar und zudem in der Praxis nicht reibungslos
umsetzbar ist. Im Interesse einer effizienten und kostenbewußten Führung des
DSB möchte ich mich daher mit Nachdruck für eine strukturelle Verschlankung
aussprechen. Elemente einer Straffung der Leitungs- und Gremienarbeit sind
eine deutliche Verkleinerung des Präsidiums, klare
Zuständigkeitsabgrenzungen sowie eine direktere Kontrolle des
Ausgabenverhaltens der einzelnen Referate. Ein entsprechender
Satzungsentwurf, der einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung
darstellt und in zahlreichen Gremien- und Präsidiumssitzungen ausgearbeitet
wurde, wird dem Bundeskongress in Zeulenroda vorgelegt werden. In diesem
Zusammenhang bin ich froh, dass ich Herrn Dr. Hans-Jürgen Weyer gewinnen
konnte, für das Amt eines Vizepräsidenten des DSB zu kandidieren. Herr Dr.
Weyer ist nicht nur der langjährige Präsident des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen - der größte Landesverband in Deutschland - sonder
darüber hinaus auch ein absoluter Experte des Verbandswesens. Im Falle
seiner Wahl erhoffe mir von ihm eine tragende Rolle im operativen Bereich.

Robert von Weizsäcker macht den ersten Zug bei der WM Anand gegen Kramnik in
Bonn
Bei Amtsantritt
nannten Sie u. a. zwei Aufgabengebiete, die Ihnen besonders am Herzen lagen:
Die Jugendförderung und die Rolle des Deutschen Schachbundes innerhalb der
FIDE. In welchem Maße sehen Sie in diesen Bereichen Ihre Ziele verwirklicht?
Mein persönliches Engagement galt neben dem oben genannten generellen Ziel
in der Tat zum einen dem Bereich Kinder und Jugend – die Zukunftsträger des
Schachs – und zum anderen der internationalen Repräsentanz des Deutschen
Schachbundes.
Wegen der
Schacholympiade in Dresden konnten eine Reihe von Aufgaben nicht in dem
ursprünglichen geplanten Umfang durchgeführt werden. Insbesondere der
Kinder-, Jugend- und Schulschachbereich, das legen meine bisherigen
Erfahrungen als DSB-Präsident nahe, sollte jedoch in Verbindung mit einer
generellen Förderung der Breitensportaktivitäten zukünftig ein höheres
Gewicht erhalten. Diese Bereiche sind für die Verbreitung des Schachs in
Deutschland von immenser Bedeutung. Ich bin ja vor zwei Jahren in erster
Linie als Spieler und nicht als Funktionär angetreten. Meine vornehmliche
Motivation bestand und besteht also darin, etwas für die Spieler zu tun,
Begeisterung im Umfeld des Schachsports zu wecken und damit möglichst auch
die Anzahl der aktiven Spieler zu erhöhen. Hier stellt die Schachjugend das
entscheidende Potential für die Zukunft dar.
Mit der FIDE gab es
einige Gespräche darüber, inwieweit der DSB sich verstärkt in die Arbeit
einbringen kann. Hier bedarf es einer längerfristig angelegten
Koalitionsbildung, um einen gewissen Einfluss auf die FIDE zurück zu
gewinnen. Konkret ist eine Umsetzung der Ideen vermutlich erst in Verbindung
mit den Neuwahlen 2010 möglich.
Jugendförderung
Nimmt man Presseartikel
als Maßstab, so scheint der Stellenwert des Schachs, gerade auch als
pädagogisches Hilfsmittel sehr hoch zu sein. Die Trierer Studie oder das
Hamburger Modell „Schach statt Mathe“ haben viel Resonanz erzeugt. Wirkt
sich dies auch positiv auf die Jugendarbeit im Deutschen Schachbund aus?
Sowohl die Trierer
Studie als auch das lobenswerte Projekt „Schach statt Mathe“ (wobei mir
persönlich diese scharfe Substitution nicht ganz einleuchtet) wird von der
Deutschen Schachjugend für die Jugendarbeit und für die
Schulschachaktivitäten genutzt. Sichergestellt werden muss natürlich, dass
diese positiven Erkenntnisse auch auf allen Ebenen des DSB, seinen
Landesverbänden und den weiteren Untergliederungen umgesetzt werden.
Wie sehen Sie den
Leistungsbereich in der Schachjugendförderung. Können deutsche Kinder im
internationalen Vergleich noch mithalten?
Gerade im Kinder- und
Jugendbereich zeigen die Ergebnisse, dass sich der DSB nicht zu verstecken
braucht. Ich möchte nur daran erinnern, dass Arik Braun die Bronzemedaille
bei der Juniorenweltmeisterschaft 2008 sowie Filiz Osmanodja bei der
Jugendweltmeisterschaft und bei der Jugendeuropameisterschaft U 12 im
vergangenen Jahr die Silbermedaille gewonnen haben.
Internationale
Präsenz

IM Gespräch mit ECU-Präsident Boris Kutin in Dresden
In den großen
internationalen Verbänden, besonders in der FIDE, ist das deutsche Schach
kaum vertreten. Die Vertreter der Schachverbände aus Ost-und Südosteuropa
haben in der FIDE das Sagen und bestimmen die Richtung, wobei der
autokratische, teils auch orientierungslose Führungsstil der FIDE-Führung
eines internationalen Sportverbandes eher unwürdig ist und regelmäßig auf
Kritik stößt. Gibt es Pläne seitens der DSB-Spitze, sich in der FIDE stärker
einzubringen und hier Veränderungen zu bewirken?
Wie oben bereits
erwähnt, habe ich vor meiner Wahl zum DSB-Präsidenten darauf hingewiesen,
dass es mein Ziel ist, den Einfluss des DSB in der FIDE zu stärken. Es
reicht nicht aus – das hat die Vergangenheit gezeigt – die FIDE-Führung
ständig von außen zu kritisieren. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen
wir versuchen, dies von innen heraus zu erreichen. Dazu stehe ich nach wie
vor. Der DSB ist mit seinen Fachleuten in den FIDE-Kommissionen recht gut
vertreten, nicht jedoch in der FIDE-Führung. Wir müssen jetzt daran
arbeiten, bei den FIDE-Wahlen im nächsten Jahr in Khanty Mansiysk unsere
Interessen auch tatsächlich durchzusetzen.
Schachstandort
Deutschland

Mit Innenminister Wolfgang Schäuble beim Jubiläum des Turmdiploms

Wettkampf zweier Schachliebhaber
Bei der Präsentation der Schacholympiade wurde von den Organisatoren
vor allem die Stadt Dresden, allenfalls noch das Bundesland Sachsen in den
Vordergrund gerückt. Konnte sich der Deutsche Schachbund trotzdem
ausreichend in Szene setzen und für sich werben?
Der wesentliche
Geldgeber war die Landeshauptstadt Dresden. Insofern ist verständlich, dass
sie sich und das Land Sachsen vorrangig präsentiert haben. Das wurde von uns
im Vorfeld auch so eingeschätzt. Aus diesem Grunde hat der DSB zusätzliche
bundesweite Aktionen im Vorfeld der Schacholympiade durchgeführt, womit auf
die anstehende Veranstaltung aufmerksam gemacht werden sollte. Es handelte
sich dabei um die von unserem Olympiadeausschuss inszenierten Aktivitäten,
wie zum Beispiel die Simultanveranstaltungen der Nationalspieler, der
Schach-Deutschland-Cup, die Fahrrad-Sternfahrt, das Projekt Olympiaverein
und die Herausgabe des Olympiademagazins. Insofern glaube ich, dass sich der
DSB sowohl national als auch international im Rahmen seiner Möglichkeiten
als Mitorganisator der Schacholympiade präsentieren konnte.
Mit Arkadij Naiditsch
hat nun erstmals ein deutscher Spieler die magische 2700-Elomarke erreicht
und gehört zum erlesenen Kreis der Supergroßmeister. Auch Georg Meier hat
jüngst einen deutlichen Sprung gemacht. Trotzdem muss man feststellen, dass
das deutsche Spitzenschach im internationalen Vergleich mehr und mehr
abgehängt wird. Kann man diese Entwicklung stoppen? Wie könnte man Talente
besser zum Profischach und evtl. in die Weltspitze bringen?
Über die Erfolge von
Arkadij Naiditsch und Georg Meier freue ich mich außerordentlich. Damit sind
jetzt zwei jüngere Spieler näher an die Weltspitze herangerückt. Der DSB hat
in der Vergangenheit durchaus Spitzenspieler unterstützt. Wenn es nach mir
gegangen wäre, hätte diese Unterstützung noch viel umfangreicher ausfallen
sollen. Aber: Es fehlt an Ressourcen. Umverteilungen scheinen unter dem Dach
des DSB sehr schwer durchzusetzen zu sein – egal in welche Richtung. Doch
wenn durch Umschichtungen kein zusätzliches Geld in das Spitzenschach
gelenkt werden kann, dann benötigt man zusätzliche externe Quellen:
Stichwort Sponsoren. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren verschiedene
Gelegenheiten genutzt, um Gespräche mit potentiellen Sponsoren zu führen.
Mein Eindruck bisher ist, dass man sich generell gegenüber dem Thema Schach
zwar sehr aufgeschlossen zeigt, dass daraus freilich noch lange nicht die
Bereitschaft folgt, Gelder in den Schachsport zu investieren. Es hat sich
gezeigt, dass der DSB selbst nur geringe Chancen hat, unmittelbare
Unterstützungen aus der Wirtschaft zu erhalten. Mehr Aussicht auf Erfolg hat
die gezielte finanzielle Förderung spezifischer Schachereignisse, z.B. der
Deutschen Meisterschaft. Sollte es auf absehbare Zeit schwierig bleiben,
externe Mittel zu akquirieren, so bleiben die Finanzen des DSB ein
Nullsummenspiel.
Die Frage nach der
Talententdeckung ist komplex. Gute Rahmenbedingungen, ein gewisses
gesellschaftliches Ansehen und die daraus abgeleitete Tragfähigkeit einer
auf Schach basierenden materiellen Existenz wären natürlich wünschenswert.
Der Rest ist ein Wechselspiel aus Begabung, Motivation, letztlich
erreichbarer Spielstärke und Selbstselektion. Gegeben die relative
Erbarmungslosigkeit der schach-wirtschaftlichen Situation wäre es freilich
nicht verantwortungsvoll, Spielern mit leichter Hand zu empfehlen, den
Schachsport professionell zu betreiben.
Ist die Deutsche
Bundesliga, die sich ja als Verein neu organisiert und damit auch vom DSB
unabhängig gemacht hat, ein geeignetes Übungsfeld für heranwachsende
Talente? Nimmt sie diese Aufgabe in ausreichendem Maße wahr oder könnte man
sich Verbesserungen vorstellen? Wie ist in diesem Zusammenhang die große
Anzahl von Legionären zu sehen, die in der Bundesliga die Bretter besetzen?
Es steht mir nicht zu,
die Arbeit des neu gegründeten Vereins Schachbundesliga e. V. zu
kritisieren. Erst vor zwei Jahren haben wir die Vereinbarung der
Sonderstellung der Bundesliga getroffen. Wir sollten dem Verein die Chance
geben, die Marke Schachbundesliga zu entwickeln. Die Entscheidung, die Zahl
der ausländischen Spieler nicht mehr zu begrenzen, wurde vom DSB getroffen.
Wir sind nicht gerade glücklich darüber, konnten jedoch angesichts der
Rechtsprechung des EuGH (Bosman-Urteil) und der Auffassung der EU-Kommission
nicht anders entscheiden.
Doping im Schach

Im Gespräch mit Artur Jussupov in Bonn
Die FIDE hat schon vor
ein paar Jahren Dopingproben bei offiziellen Turnieren eingeführt. Der
Deutsche Schachbund hat sich zum Jahresbeginn ebenfalls dem Antidoping-Code
der Nationalen Doping Agentur unterworfen - ohne Notwendigkeit, wie viele
Schachfreunde z.B. bei der auf der ChessBase-Webseite geführten Diskussion
meinen.
Zum Thema Doping hat
es ja eine zum Teil wilde Diskussion gegeben. Diese möchte ich nicht näher
kommentieren. Ich selbst betrachte das Thema Doping völlig undogmatisch.
Schach bildet für mich einen Dreiklang aus Sport, Wissenschaft und Kunst. In
meinen ersten Stellungnahmen nach meiner Wahl in 2007 habe ich Schach ja in
erster Linie als Kulturgut vertreten. Ich persönlich möchte Schach nicht auf
die Kategorien des Sports verengen. Aber: Wenn es um die bestmögliche
institutionelle Förderung des Schachs geht, gibt es zur Zeit keine
realistische Alternative zu unserem Bekenntnis zur Mitgliedschaft im Kreis
der Sportverbände – eine Mitgliedschaft, für die der DSB überdies jahrelang
gekämpft hat.
Lange Zeit hat
übrigens der DSB in Übereinstimmung mit dem Deutschen Sportbund auf
Doping-Kontrollen verzichten können. Wir haben immer argumentiert, dass es
entweder im Schachsport keine Doping-Möglichkeiten gibt oder dass zumindest
Doping kein aktuelles Problem ist. Diese Auffassung lässt sich in der
heutigen Zeit nicht mehr aufrechterhalten. Es gibt durchaus Doping-Mittel,
die auch von Schachspielern genommen werden könnten. Ob diese Mittel der
Leistungssteigerung dienen oder nicht, spielt bei der Bewertung, inwieweit
es sich um unerlaubte Medikamente handelt, keine Rolle. Schon im Interesse
unserer Spielerinnen und Spieler, insbesondere natürlich auch unserer
Nachwuchsspieler, sind wir gehalten, gegen Doping vorzugehen.
Unabhängig davon wurde
von der Politik Druck auf alle Sportverbände ausgeübt, den NADA Code im
vollen Umgange anzuwenden. Es gab für keinen Verband irgendeine
Sonderregelung. Ich halte es für falsch, die Zugehörigkeit des Schachs zur
Sportfamilie erneut in Frage zu stellen. Der DSB hat sich zu seiner
Sporteigenschaft bekannt und muss dann auch die entsprechenden Konsequenzen
ziehen.
Auf der anderen Seite
droht durch zunehmende Miniaturisierung und Verbesserung der Technik immer
größere Gefahr, dass Spieler bei ihren Partien technische Mittel zu Hilfe
nehmen. Auch wenn manche kürzlich erhobenen Beschuldigungen vielleicht zu
Unrecht erfolgt sind, so dokumentiert sich dadurch doch die Verunsicherung,
die bei den Spielern herrscht. Was kann an dieser Stelle unternommen werden,
damit alle Spieler in der Gewissheit spielen können, dass die Partien unter
regulären Bedingungen vor sich gegangen ist?
Mir ist bewusst, dass
technische Hilfsmittel im Schachsport eingesetzt werden könnten. Es wird
daher Aufgabe der Organisatoren und Schiedsrichter sein, diesen Missbrauch
zu unterbinden. Dass man jeden Spieler mit Metalldetektoren untersucht, dass
man sie kontrolliert wie etwa bei einem Flug in die USA, dass man die
Spieler während der Partie auf Schritt und Tritt verfolgt – dass ist für
mich nicht gerade eine schachsportliche Traumvorstellung, doch wer weiß,
wozu man in der Praxis noch gezwungen sein wird.
Organisation des DSB

Zusammen mit Helmut Pfleger und Klaus Bischoff bei der Kommentierung der
WM-Partien in Bonn
Bei Amtsantritt
äußerten Sie das Bedürfnis, die Strukturen des DSB und seiner Landesverbände
zu verschlanken, teils um Prozesse zu beschleunigen, teils um Kosten für
vielleicht überflüssige oder unergiebige Meetings zu sparen. Haben Sie hier
Erfolge erzielen können?
Dazu habe ich mich ja
oben bereits kurz geäußert. Um Strukturen im DSB zu verändern und die
Organisation zu verschlanken, sind Satzungsänderungen notwendig. Ich habe
entsprechende Vorschläge gemacht. Nach langer Diskussion innerhalb der
beauftragten Kommissionen, innerhalb der Landesverbände sowie im Präsidium
wird dem diesjährigen Bundeskongress eine Satzungsänderung vorgelegt werden,
über die dieser dann zu befinden hat.
Umgekehrt kommt aus den
Landeverbänden die Klage, man sei zuwenig in die Meinungsbildung und
Beschlussfassung des DSB eingebunden. Selbst bei wichtigen Themen würden die
Entscheidungen in einem kleinen Kreis getroffen und die Verbandsvertreter
dann nur noch zum Abnicken einberufen…?
Diese Kritik teile ich
nicht. Generell versuchen wir, die Landesverbände von Anfang an über unsere
Arbeit zu informieren. Nur muss man dabei natürlich berücksichtigen, dass
das Präsidium (und nicht die Landesverbände) gewählt wurde, um den DSB zu
führen. Die neue Satzung kann übrigens einen festen Vertreter der
Landesverbände im Präsidium des DSB vorsehen.
Öffentlichkeitsarbeit

Interview für das Fernsehen
Während das Schach
selbst in den Medien eigentlich sehr gut repräsentiert ist – viele regionale
Zeitungen berichten regelmäßig über Schachaktivitäten aus ihrem
Verbreitungskreis – findet man den Deutschen Schachbund, die deutsche
Nationalmannschaft oder die Erfolge deutscher Spitzenspieler eher selten in
den Massenmedien. Woran liegt das?
Bei meinem Amtsantritt
habe ich darauf hingewiesen, dass mir die Darstellung des Schachsports in
der Öffentlichkeit am Herzen liegt und dass ich mit der aktuellen
Berichterstattung in den überregionalen Medien unzufrieden bin. Im Vorfeld
der Schacholympiade haben wir Dagobert Kohlmeyer mit einer verstärkten
Öffentlichkeitsarbeit beauftragt. Ich selbst habe zahlreiche Interviews
gegeben und mich wo ich konnte in der Außenvertretung des deutschen Schachs
engagiert. Unabhängig davon müssen wir weiterhin daran arbeiten, die
überregionalen Medien zu überzeugen, Nachrichten über das deutsche
Spitzenschach zu publizieren.
Die Webseite des
Deutschen Schachbundes macht im Vergleich zu den Internetpräsenzen anderer
Sportverbände eher keinen guten Eindruck. Die Seite wirkt konzeptionslos,
der Nachrichtenteil zufällig und zusammenhangslos. Manche Inhalte sind
informativ, aber kaum zu finden. An welche Rezipienten richtet sich
eigentlich die DSB-Seite und nach welchen Kriterien wird der Erfolg
bewertet?
Die Internetseite des DSB findet durchaus Zustimmung und ist zum Teil auch
informativ. Mir persönlich fehlt eine konzise inhaltliche Konzeption. Auch
darf es hier keine falsch verstandene Selbständigkeit geben, die von den
durch den DSB vorgegebenen Inhalten abgekoppelt ist. Das wird eine Aufgabe
des neuen Präsidiums sein, die mit dem für die Öffentlichkeitsarbeit
Zuständigen und dem Webmaster besprochen werden muss. Insgesamt ist das ein
sehr wichtiges Feld, das langfristig kaum allein ehrenamtlich bewältigt
werden kann. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing müssen zukünftig eine
deutlich höhere Beachtung finden.

Vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte André Schulz.