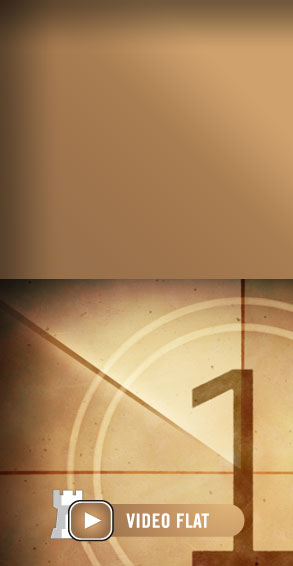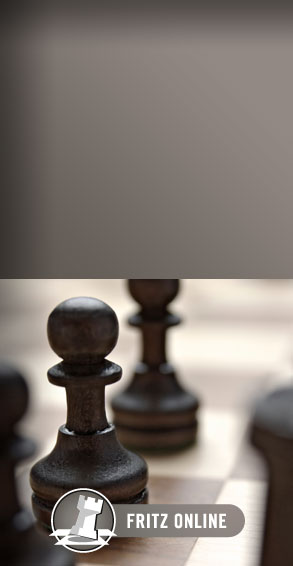Karol Irzykowsky: Portrait von Witold Jacek Zbroja
Karol Irzykowsky: Portrait von Witold Jacek Zbroja
KAROL IRZYKOWSKI – Literat und Schachspieler
Von Thomas Lemanczyk
 Die Schachleidenschaft mancher berühmter Schriftsteller ist wohldokumentiert,
meist durch sie selbst.
Doch auch weniger berühmte Literaten haben sich das Schachspiel als einen
lebenslangen Begleiter erwählt. Es lohnt sich für den Schachinteressierten oft,
einen von ihnen dem Beinahevergessen zu entreißen, da sie auf diesem besonderen
Gebiet Einiges zu bieten haben. Der Pole KAROL IRZYKOWSKI (1873-1944) war von
Beruf Schriftsteller und Kritiker, ein zu Lebzeiten geachteter Vertreter der
polnischen Intelligenz, und ein begeisterter Schachspieler.
Die Schachleidenschaft mancher berühmter Schriftsteller ist wohldokumentiert,
meist durch sie selbst.
Doch auch weniger berühmte Literaten haben sich das Schachspiel als einen
lebenslangen Begleiter erwählt. Es lohnt sich für den Schachinteressierten oft,
einen von ihnen dem Beinahevergessen zu entreißen, da sie auf diesem besonderen
Gebiet Einiges zu bieten haben. Der Pole KAROL IRZYKOWSKI (1873-1944) war von
Beruf Schriftsteller und Kritiker, ein zu Lebzeiten geachteter Vertreter der
polnischen Intelligenz, und ein begeisterter Schachspieler.
IRZYKOWSKI wurde am 25. Januar 1873 in dem Dorf Błaszkowa
im damals österreichischen Galizien (heute Polen) als Sohn eines adeligen
Grundbesitzers geboren. Als sein Vater sein Vermögen verlor, mußte er sein
Philosophiestudium an der Universität Lemberg (poln. Lwów, heute ukr. Lviv)
abbrechen, und wurde 1896 Lehrer in Brzeżany. Aus seiner Lemberger Studentenzeit
haben sich einige Briefe an Freunde erhalten. Für Schachspieler ist folgender
Brief an einen gleichfalls schachbegeisterten Freund, EMIL GROSS, von Interesse,
da IRZYKOWSKI in ihm mitteilt, wie er seinen Ehrgeiz, ein besserer Spieler zu
werden zu befriedigen suchte und gleichfalls, ganz nebenbei, das Schachleben in
Lembergs Cafés beschreibt, das sicherlich in allen Metropolen (Lemberg war die
Hauptstadt Galiziens) des k. u. k. – Imperiums ähnlich ausgesehen haben mag.
Vor einigen Tagen ging
ich ins Wiener Café, da ich mich zu Hause, mein Freund, ohne Ihre Gegenwart,
langweilte. Dort traf ich an den Tischen eine Reihe Schachspieler an. Einige von
ihnen spielten eifrig, andere kiebitzten. Ich setzte mich in die Nähe von Kohns
Tisch, meinem früheren Gegner. Als ich ihm so zuschaute, beschlich mich ein
Bedürfnis, selbst zu spielen. Besonders darum, weil ich in den letzten Kämpfen,
die ich mit Ihnen ausfocht, mein Schachwissen ein wenig auffrischen konnte. Aber
Kohn besiegte seinen Gegner und verließ das Brett. Ich setzte mich mit einem
anderen Gegner zum Spiel. Es war dies ein Mensch mit großem Kopf und kleinen
schwarzen Augen; solche sind meistens eingebildet (dies ist die Regel – eine
Ausnahme wird im weiteren beschrieben). Als ich ihn fragte, ob er spielen
möchte, fragte er: „Spielen Sie stark, mein Herr? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen
eine Vorgabe geben soll oder nicht.“ Ich antwortete darauf: „Na, mittelmäßig.“
„Haben Sie schon einmal mit jemandem von den hiesigen Spielern gespielt?“ „Ich
spielte mit Kohn, aber ich habe verloren.“ „Nun, das ist keine Empfehlung.“ Wir
setzten uns dennoch ans Brett. Mein Partner opferte eine Menge Figuren,
angeblich um meine Spielstärke zu testen; er verlor aber, wozu ich
wahrscheinlich den kleinsten Beitrag leistete. Hier die Partie:

KAROL IRZYKOWSKI
– Dr. BUJAK
Lemberg 1894
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4 d5
5.exd5 e4 6.dxc6 exf3 7.Dxf3 Dxd4 8.cxb7 Lxb7 9.Dxb7 Dxc4 10.Dxa8+ Kd7 11.Df3

Zu diesem Zug notiere ich eine Bemerkung und
mache Sie darauf aufmerksam, daß ich solche Anmerkungen bei jeder der
Partien anbringen werde, die ich Ihnen schicke. Zunächst allerdings erlaube ich
mir zu erläutern, welcher Art diese Anmerkungen sein werden: sie werden nicht
sachlicher, sondern psychologischer Art sein, denn ich möchte lernen stark zu
spielen und habe mir vorgenommen zu beobachten, welche Ungenauigkeiten meinem
schachlichen Denken unterlaufen und wie ich infolgedessen das eigene und das
gegnerische Spiel beurteilen muß.
Hier z. B. ist der Zug 11.Df3 gut, da 11...Lb4+ mit
Damenverlust drohte, allerdings habe ich das gar nicht gesehen. Ich sah bloß,
daß Schwarz mit 11...Sd5 meine Dame von der weißen Armee hätte abschneiden
können. Selbstverständlich sollte ein Schachspieler solche Sachen beinahe
unbewußt wahrnehmen, ganz zu schweigen von längeren Kombinationen.
11...Lb4+ 12.c3
Te8+ 13.Le3 Sd5 14.Sd2 Dd3 15.De2 Dg6 16.cxb4 Te6 17.0–0 Tf6 18.Sf3
Diesen Zug
führte ich bloß aus, um meinem Gegner zu zeigen, daß ich mich vor seinem
18...Sf4 wegen 19.Dd2+ (auch sofort Se5 geht an) nicht fürchtete. Allerdings sah
ich nicht, daß mir das nur wenig geholfen hätte wegen 19...Td6 (...), neben
alledem entstand nun zufällig die Drohung Se5+.
18....Ke8 19.Dd2
Vielleicht wäre 19.Lc5
genauso stark gewesen, aber Weiß imponierte die Aufstellung von Dame und Läufer
in einer Linie, besonders darum, weil zwei Sachen miteinander verbunden werden:
die Deckung des Bauern b4 und der Angriff auf den Springer d5. Solch eine
Kalkulation ist beim Schach allerdings unzweckmäßig.
19...c6 20.Lc5
Dieser Zug ist gut, denn wenn jemand eine Figur mehr
hat, dann sind alle seine Züge gut. Hier z. B. öffnet sich die e-Linie für den
Turm. Hauptsächlich erfreute mich hier allerdings, daß ich auf 20...Txf3 21.Dd2+
spielen kann.
20...Sf4 21.Tfe1+ Se6 22.Tad1
und er gab auf.
In der zweiten Partie spielte Dr. Bujak das Muzio-Gambit
und gewann tatsächlich infolge meines schlechten Spiels am Anfang die Figur
zurück, aber danach opferte er wieder zuviel und verlor. Soweit ich die Partie
erinnere, schreibe ich sie Ihnen auf:
Dr. BUJAK – KAROL IRZYKOWSKI
Lemberg 1894
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.Lc4 g4
5.0–0 gxf3 6.Dxf3 Df6 7.e5 Dxe5 8.d3 Lh6 9.Ld2 Se7 10.Kh1 Sbc6 11.Lc3 Sd4 12.Df2
Sef5 13.Sd2 Se3?
Besser 13...c5; 13.Sg5+ wäre schlecht.
14.Sf3 Dh5
Vielleicht war 14...Sg4
besser?
15.Lxd4 Tg8 16.Lxe3 fxe3 17.Tae1 d5 18.Txe3+ Lxe3 19.Dxe3+
Le6 20.Sd4 Dh4 und gewinnt.
Nun
erklärte mein Partner: „Ich teste am Anfang immer den Spieler, wie er sich zu
wehren weiß; aus einigen Ihrer Züge in der ersten und zweiten Partie konnte ich
erkennen, daß Sie schwach spielen. Ich gebe Ihnen jetzt eine Springervorgabe und
nun lassen Sie uns um eine halbe Krone spielen.“
Ich war einverstanden. Mir
scheint, daß mit dem Testen bloß die Hälfte der Wahrheit ausgesprochen war.
In Wirklichkeit hat doch jeder die Absicht zu siegen und auch das Hingeben von
Figuren verfolgt diesen Zweck; erst nachdem er sich vergaloppiert hat, erwacht
in ihm der neue Plan, das „Testen“ des Gegners; es geht ihm aber nur um die
Rettung seiner Ehre. Es folgt die dritte Partie:
Dr. BUJAK – KAROL
IRZYKOWSKI
Lemberg 1894
(Weiß gibt den Sb1
vor)
1.e4 e6 2.e5 d5 3.d4 c5 4.Sf3 f6 5.exf6
Sxf6
Wie
gewöhnlich schauten viele Kiebitze bei unserer Partie zu; unter ihnen auch einer
der besseren Spieler, Wiśniowiecki, der besser als Bujak sein soll. Dieser
schlußfolgerte hier, daß ich verlieren würde, weil man die Französische
Verteidigung mit dem Springer auf h6 spielt!
6.Lg5 Le7 7.dxc5
Da5+ 8.c3 Dxc5 9.Ld3 Sc6 10.0–0 e5 11.Lc2 e4
Besser war 11...Lg4 und erst danach e5-e4; auf diese Weise hätte ich
unvermeidlich eine Figur gewonnen, weil das Fehlen des Springers b1 es
verhindert, daß sein Bruder auf f3, wie es sonst der Fall ist, von d2 aus
gedeckt werden kann. Falls 12.h3 und 13.g4, so folgt 13...Sxg4 und der Sf3 ist
nicht zu retten.
12.Sd2 Lg4 13.De1 0–0 14.Le3 Dd6?
(Da5) 15.Lb3 Kh8 16.f3
exf3
16...Sa5 hätte nichts eingebracht; beispielsweise
17.fxg4 Sxg4 18.g3 Sxb3 19.axb3 und Schwarz besitzt kein Äquivalent für die
Figur.
17.Sxf3 Lxf3 18.Txf3 Sg4 19.Tg3 Sxe3 20.Txe3 Dc5 21.Kh1
Tad8
Um den faulen Bauern d5 zu verteidigen; besser jedoch
war 21...Lf6 und der spätere Tausch des Bauern auf d4.
22.Td1 Tf5 23.Th3 Tdf8
War es jetzt nicht vielleicht besser, sofort 21...Tf5
und 22...Taf8 zu spielen?
24.Tf3 Txf3 25.gxf3 Txf3 26.Lxd5 Te3 27.Df1 h6?

Ein grober Fehler. Ich hätte 27...Se5 spielen müssen, womit ich
alles Folgende vermieden und sogar Angriff erlangt hätte.
28.Df7
Weiß glaubte, dieser Zug
sei ein rechtmäßiger Erfolg seines Angriffs; meiner Meinung nach gibt es
allerdings gar keinen Angriff und der Zug 28.Df7 ist bloß zufällig ermöglicht
worden durch die Unterlassung von 27...Se5. Unwidersprochen sei jedoch, daß die
gesamte Gruppe d5, Le7, Sc6 schwach war und mein Spiel hemmte.
28...Kh7 29.Tg1 Lg5 30.Dg8+ Kg6 31.Lf7+
Spekulationen mittels
31.Txg5 (auf Dh5 matt) wären vergebens wegen 31...Te1+. Weiß konnte hier ein
Dauerschach mit der Dame auf den Feldern f7 und g8 oder f5 und f8 geben, aber er
wollte auf Gewinn spielen.
31...Kf5 32.Dxg7
Außer 30.Dg8+ hätte Weiß
auch noch 30.Df5+, 31.Dc8+ und danach 32.Lf7, wodurch er gewonnen hätte,
probieren können, weil 32...Se7 unspielbar ist wegen 33.Dxc5! So teilte es
Wiśniowiecki mit - ich bemerkte darauf, daß ich
doch 31...Ld8, und nicht 31...Kh7, spiele. Statt alledem hätte Weiß h2-h4
probieren können.
32...Se5 33.Tf1+ Tf3 34.Dh7+ Kg4?
Besser ist 34...Kf6 oder
34...Kf4. Schwarz hätte doch die Folgen des Zuges De4+ oder Le6+, die man zu
erwarten hatte – jetzt oder nach Turmtausch – berechnen können. Weiß spielt
allerdings in gleicher Weise wie Schwarz, d. h. kläglich, und zieht:
35.Tg1+
Hierauf bietet sich die
Gelegenheit zu 35...Dxg1+ und Gewinn, ich sah diese Gelegenheit darum, weil
solche Züge dem Schachspieler weniger wegen ihrer Güte als wegen ihrer
Ungewöhnlichkeit auffallen. Trotzdem zog ich anders.
35...Kh4
Ich erinnere mich nicht
mehr genau, was mich derart blendete. Es war wohl so, daß ich gerade die Folgen
von 35...Dxg1 berechnete, als plötzlich etwas anderes den Gang meiner Gedanken
kreuzte. Kaum hatte ich den Zug 35...Kh4 gemacht, als
Wiśniowiecki meine Aufmerksamkeit darauf lenkte, daß ich Dxg1
spielen konnte.
36.Lg6 Sxg6?
Wozu? Besser sofort 36...Dxg1+.
37.Dxg6

37...Dxg1+ und gewinnt, wenngleich
auch Bujak sich noch lange besann, ob diese Stellung nicht doch noch zu retten
ist. Also war es mein Sieg, auch wenn Bujak
sich jetzt beschwerte, daß Wiśniowiecki mir den Zug vorgesagt hätte. Ich fragte
mich, was passiert wäre, wenn er nicht 35.Tg1 gespielt hätte. Wir stellten die
Position auf und er spielte jetzt 35.Le6+ Kh4 (besser Kh5) 36.Txf3 Sxf3 37.De4+,
worauf ich ihm dann sagte, daß er gewonnen hätte, weil wirklich nicht zu sehen
ist, daß ich im 34. Zug Kf6 oder Kf4 spielen konnte, und nach 35.Le6+ Kh5,
dachte ich, daß das Recht auf den Sieg ihm gebührt.
Die Kiebitze waren allerdings schon nach dem ersten
Partieschluß gegangen, also war ich in ihren Augen der Sieger. Wir gaben uns je
eine halbe Krone. (...)
Am Montag spielte ich mit Kohn zwei Partien, die beide
remis ausgingen, aber in beiden hatte ich die Überhand, besonders in der ersten,
die ich Ihnen notiere. Kohn spielt klar besser als Bujak, aufmerksamer, er ist
ein älterer und ruhiger Spieler, der lange überlegt und mir dadurch Gelegenheit
zum Nachdenken gibt. Bujak dagegen steckt mich mit seiner Gedankenlosigkeit und
Fiebrigkeit an. Ich glaube allerdings, daß Kohn sich gegen mich nicht anstrengte
– letztlich muß ich beiden zuerkennen, daß sie besser als ich spielen, sie haben
eine größere Routine und sind an das Caféhaus-Spielen gewöhnt: auf Tischchen,
die von flimmerndem Gaslicht beleuchtet werden, inmitten eines riesigen Lärms in
dem gestritten wird, Züge vorgeschlagen werden und den Spielern zugerufen wird:
„Oho, jetzt stehen Sie auf Verlust!“ Aber ich kehre zurück zur Partie:
KAROL IRZYKOWSKI
– KOHN
Lemberg 1894
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.d3 Sf6 5.Le3 Lb6 6.Sbd2 h6
7.Sf1 0–0 8.Sg3 d5 9.exd5 Sxd5 10.Dd2 Sxe3 11.fxe3 Sa5? 12.Sxe5 Dg5
Diesen Zug habe ich
übersehen als ich 12.Sxe5 spielte! Es ist bloß ein Zufall, daß ich auf ihn eine
gute Antwort habe.
13.d4 c5 14.0–0
Sxc4 15.Sxc4 Lc7 16.Se4?

Ich sah die Gefahr, die h2 drohte, doch machte wieder den
gleichen Gedankenfehler, indem ich mit zunächst 16...Dh4 rechnete, worauf
17.Sed6 beabsichtigt war; allerdings sollte jemand, der so viele Partien wie ich
durchgearbeitet hat, die besonders einfache Kombination, die jetzt erfolgt
vorhergesehen haben.
16...Lxh2+ 17.Kxh2
Dh4+ 18.Kg1 Dxe4 19.Tf4 De7 20.Taf1 Le6?
Er hätte
vorher mit 20...cxd4 schlagen sollen.
21.d5 Tad8 22.e4 Dg5?
Ein grober Fehler. Schwarz
hätte nicht das Feld verlasen sollen, von dem aus er den Punkt f7 und den Bauern
c5 deckt. Vielleicht war das beste 22...b6, aber darauf könnte der Springer über
e5 nach c6 gelangen.
23.Df2
Ein sehr guter Zug, aber er
ist ein Ergebnis der Situation, also nicht mein Verdienst. Wer weiß, ob ich ihn
gemacht hätte, wenn ich nicht ein Feld für die Dame hätte finden müssen, weil
ich sie aus dem Wirkkreis des Turmes entziehen wollte! Mit diesem Zug habe ich
vierfachen Nutzen erzielt: 1) ich ziehe die Dame weg; 2) ich bedrohe f7, weil 3)
der Läufer ziehen muß; 4) ich bedrohe c5.
23...Lxd5
Dieser Zug zeigt, wie sehr
Kohn mich unterschätzt, denn das Opfer ist unnötig; man konnte einfach 23...Lh3
spielen. Sicherlich, 24.Txf7 wäre die Folge, und nach den Abtäuschen auf f7:
23.Lh3 24.Kh2 Lg4 25.Txf7 Txf7 26.Dxf7+ bleiben zwei starke Freibauern übrig.
Kohn dachte lange über diesem Zug nach, sicherlich wußte er nicht, ob er sich
vor Tf4-f5 ängstigen sollte.
24.exd5
24.Tf5 wäre nicht gut,
wegen 24...Dg4 25.Se3 De4.
24.Dxd5 25.Se3 Dxa2 26.b3
Damit die Dame durch das Schlagen auf b2 nicht den Punkt
g7 deckt; daß auf diese Weise auch Dd4 (nach Txf7) ausgeschaltet ist, habe ich
überhaupt nicht bedacht. Es kann aber sein, daß eine tiefere Analyse aufzeigt,
daß 26.Sf5 sofort besser ist, trotz des Stellung der Dame auf b2 (z. B. 26.Sf5
Dxb2 27.Sxh6+ oder 27.Tg4).
26...Da5 27.Sf5 f6 28.Sxh6+
Als ich den Springer opferte, freute ich mich darüber,
später Df2-f4 spielen zu können, weil die schwarze Dame a5 von nirgends her
Entsatz leisten kann, weder von c7 aus (was mir übrigens nichts schaden würde)
noch von d2 aus (?).
28...gxh6 29.Tg4+ Kh8
Am besten. Jetzt zog ich...
30.Df4
...übersehend, daß Schwarz
die Diversion nach d2, wo die Dame durch den Turm doch gedeckt ist, machen kann.
Mit dem Zug 30.Dh4 hätte ich auf der Stelle gewonnen, weil ich auf 30...Dc7 mit
31.Dxh6+ Dh7 32.Txf6 gewinne, und auf 30...Dd2 mit 31.Txf6. Jetzt geschah etwas,
das mir den Humor vollends verdarb.
30...Dd2 31.Df5
Es ist denkbar, daß 31.Dh2 besser wäre; und danach z. B.
so: 31...Td4 32.Txd4, aber damit hätte ich die Partie ja nicht gewonnen. 31.Dc7
hätte zu nichts geführt.
31...Td4 32.Dxc5 Tfd8 33.Txd4
Lange dachte ich über
33.Txf6 nach, es hätte aber im besten Falle bloß remis gebracht.
33...Dxd4+ 34.Dxd4 Txd4 35.Txf6 Kg7
und remis.
Am Dienstag spielte ich wieder mit
Bujak, von dem ich glaube, daß er mehr Kreativität, d. h. mehr Routine besitzt
als ich, aber weniger aufpaßt. Die erste Partie war eine Springervorgabe (die
Vorgabe gab er), die ich verlor. Weiter spielten wir vier Partien ohne Vorgabe,
von denen ich drei gewann und eine verlor. In zwei der Siege hatte ich Angriff,
also habe ich zurecht gewonnen; in der dritten gab es ein Evans-Gambit, das
Bujak mit Schwarz gewann, aber wieder einmal übertrieb er es. (...)
Am nächsten Tag spielte ich mit Dr. Bujak vier Partien,
von denen ich drei verlor und eine remis machte. (...)
Dr. BUJAK – KAROL
IRZYKOWSKI
Lemberg 1894
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sc3 Lb4 5.d3 d6 6.h3 h6
7.0–0 Lxc3 8.bxc3 g5 9.d4 Sxe4 10.dxe5 Sxe5?
Besser ist 10...dxe5. Ich hätte
hier die Folgen dieses Zuges ausrechnen sollen, nämlich den Zug Dd1-e2 nach dem
Abtausch auf e5, der doch auf der Hand liegt – ich hätte ihn ja selbst gezogen.
Hier ist der Ort, um Ihnen – wie versprochen – , die
Sache mit den Anmerkungen darzulegen. Auf das Denken eines Spielers von meinem
Kaliber hat die augenblickliche Stellung der Figuren auf dem Brett starken
Einfluß und behindert mich bei den Kombinationen. Sehr oft geschieht es im
Zugabtausch, daß ich nicht die Veränderung der Figurenstellung berücksichtige
und ich als Folge der gemachten Züge z. B. übersehe, daß die Dame, die zuvor den
Turm überdeckte, nach dem nächsten Zug den Turm „en prise“ läßt. Dies
geschieht, weil man die Dame augenblicklich auf ihrem Posten sieht, von dem aus
sie den Turm deckt und dieses Bild der Situation wird fehlerhaft auf die neue
Situation übertragen. Dieses Beispiel ist nicht prägnant – ich hoffe, Ihnen
einmal ein weniger gesuchtes geben zu können. Dies ist ein Denkfehler im Schach,
wie es auch Denkfehler im Leben gibt, z. B. ist die Hoffnung solch ein
Denkfehler.
Ich glaube deshalb, das beste Mittel um das
Schachspielen zu erlernen ist es, in solch einer Kaffeehausatmosphäre seine Züge
zu berechnen. Das Nacharbeiten der Partien, aber sogar das Fernschach eignen
sich hierzu weniger, weil man selbst die Figuren bewegt und sich alles vor Augen
führt, sich folglich nicht an das Berechnen ohne zu ziehen gewöhnen kann. Ich
meine, die Turnierspieler spielen darum so stark, weil sie sich an solch ein
Denken gewöhnt haben. Sie ziehen nicht bedenkenlos drauflos, weil sie sich daran
gewöhnten, über Züge nachzudenken. Während bei ihnen alles geordnet zugeht,
würde ich, selbst wenn mir jemand genügend Zeit zum Nachdenken geben würde, dies
nicht ausnützen können, da ich nicht ans Denken gewöhnt bin. Nach einer gewissen
Zeit gerät einem die Stellung im Kopf durcheinander, und man macht einen Zug,
von dem man weiß, daß er schwach ist, und man stellt dann fest, daß der Gegner
mit eben solchen Zügen antwortet, die man selbst auch gemacht hätte.
Denken im Schach bedeutet: sich die Stellung nach dem Wechsel
genau vorzustellen ohne sich von dem gegenwärtigen Bild irritieren zu lassen.
11.Sxe5 dxe5 12.De2 Lf5 13.f3 Sd6
14.Dxe5+ Kd7 15.Td1 Kc8 16.Txd6 cxd6 17.Dxf5+ Kb8 18.La3 Te8 19.Dxf7
und Schwarz gab auf. (...)
Das Schach-Niveau des
21-jährigen KAROL war noch nicht sehr hoch, aber sein Ehrgeiz ein besserer
Spieler zu werden, wird aus diesen Mitteilungen doch deutlich. Mehr Briefe das
Schach betreffend haben sich nicht erhalten.
Seine Lehrerstelle gab er indes auf, da ihm der Vortrag
aufgrund seines Stotterns sehr schwer fiel. 1898 zog er um nach Lemberg, wo er
eine Stelle als Stenograph im Lemberger Landtag annahm. Bereits 1897 begann er
seine Arbeit am Drama Zwycięstwo [Der Sieg], einem Werk, das er 1906
veröffentlichte, und das die Partie TARRASCH-WALBRODT, Hastings 1895,
zur Grundlage hatte. Es erschien auch sein schriftstellerisches, 1891
begonnenes, Hauptwerk, die Pałuba [Vogelscheuche, Hexe] (1903),
gemeinsam mit der Novelle Sny Marii Dunin [Die Träume der Maria Dunin]
(entstanden 1896). Dieses damals nur wenig verstandene Werk hatte dennoch
literaturgeschichtliche Bedeutung. Der geniale BRUNO SCHULZ (1892-1942) schreibt
in seiner Besprechung der Ferdydurke, WITOLD GOMBROWICZ’ (1904-1969)
Hauptwerk, daß dessen Buch „einen dem Autor vielleicht nicht einmal bekannten
(!) Vorgänger hat – die verfrühte und daher erfolglose Pałuba von KAROL
IRZYKOWSKI.“ (zitiert nach: WITOLD GOMBROWICZ, Gesammelte Werke, Band 1,
Frankfurt/Main 1998, S. 369.)
Kindlers Neues Literaturlexikon (Bd. 8, München
1990, S. 448) bemerkt zu IRZYKOWSKIS Pałuba folgendes: „Drei Jahre
nach SIEGMUND FREUDS Traumdeutung veröffentlicht, doch augenscheinlich
unabhängig von dessen Lehre, stellt die dem Werk vorangestellte Novelle Sny
Marii Dunin (...) den ersten Versuch einer literarischen Nutzung
psychoanalytischer Einsichten dar, der, jahrzehntelang übersehen, zum
eigenwilligen Vorläufer der Prosa PROUSTS und JOYCES wurde.“
(MIKOŁAJ DEUTSCH)
Neben alledem spielte IRZYKOWSKI fleißig Schach und gewann
enorm an Spielstärke dazu.
Im Klubturnier des Lemberger Schachvereins traf er u. a.
auf den bekannten Meisterspieler IGNAZ VON POPIEL, der l898 beim Kölner Turnier
STEINITZ unterlag (auch ein Sieg gegen EMANUEL LASKER, Berlin 1889, ist
überliefert, vgl. Megabase 2004).
KAROL IRZYKOWSKI
– IGNAZ VON POPIEL
Lemberg 1904
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Ld7 5.Sf3 Lc6 6.Ld3
Sd7 7.0–0 Sgf6 8.De2 Le7 9.Te1 0–0 10.Seg5 Lxf3 11.Dxf3 h6 12.Sh3 c6 13.Dg3 Kh8
14.Sf4 Da5 15.c3

15...e5? 16.dxe5 Sxe5?? 17.Txe5 Dxe5 18.Sg6+ fxg6 19.Dxe5 Tae8
20.Ld2 1–0
1908 übersiedelte IRZYKOWSKI nach Krakau, der alten
Königsstadt Polens. Zwei Jahre zuvor heiratete er. Auch in Krakau blieb er dem
Schach treu und suchte regelmäßig den Krakauer Schachklub auf. Als einer der
führenden Krakauer Schachspieler war er ein würdiger Gegner des
CAPABLANCA-Bezwingers (Turnier New York 1916) OSCAR CHAJES, dem
galizisch-amerikanischen Schachmeister, der 1911 seine alte Heimat besuchte.
KAROL IRZYKOWSKI
– OSCAR CHAJES
Krakau
1911 (Anmerkungen nach IRZYKOWSKI)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 c6 5.Sf3
Sbd7 6.e3 Lb4 7.Sd2 Da5 8.Dc2 Se4 9.Sdxe4 dxe4 10.Lf4 e5 11.Lg3 Lxc3+ 12.Dxc3
Dxc3+ 13.bxc3 exd4 14.cxd4 0–0 15.Tb1 f5 16.Ld6 Tf6?
Besser war 16...Te8.
17.c5 b5
Um sich vom Druck auf den Damenflügel zu entlasten und
den Läufer entwickeln zu können.
18.d5! cxd5 19.Lxb5 Sb8
Schwarz glaubt, mit diesem
originellen Zug allem gerecht zu werden und den Läufer nach b7 entwickeln zu
können. Die unmittelbare Drohung war 20.Lc6.
20.Kd2!

Der Anfang einer weitberechneten Kombination, die einen
Bauerngewinn zum Ziel hat. Dieser Zug verbindet nicht bloß die Türme sondern
verhindert vor allem die Möglichkeit eines Schachs im 23. Zug.
20...Lb7 21.Lxb8 Txb8 22.c6! Lc8
Falls 22...La8, dann
gewinnt 22.c7 Tc8 23.Thc1.
23.Lc4!
Das war die Idee der
Kombination, die nicht möglich gewesen wäre ohne den 20. Zug von Weiß, da
Schwarz jetzt ein Turmschach hätte.
23...Txb1 24.Lxd5+ Kf8 25.Txb1 Td6 26.Tb5
Auch dies mußte beim 20.
Zug berücksichtigt werden. Darum spielte Weiß 20.Kd2, weil nach 20.Ke2 Schwarz
hier 26...La6 hätte antworten können, oder er würde nach 25...Td6 26.Tbd1
mittels 26...La6 den König zurückwerfen.
23...Ke7
Wäre jetzt 26...Le6 mit
Gewinn des Läufers möglich, so erwiese sich die ganze Kombination als verfehlt.
Aber auf 26...Le6 antwortet Weiß 27.c7 Le728.Kc3 Kd7 29.Lxe6+ Txe6 30.Tc5 oder
30.Txf5.
27.Kc3
Und Weiß gewann schließlich nach verschiedenem
Umherziehen.
IRZYKOWSKI veröffentlichte regelmäßig seine Partien in
polnischen Schachzeitungen. In dieser Phase vor dem 1. Weltkrieg, als in Polen
ein organisiertes Schachleben noch nicht stattfand, konnte sich IRZYKOWSKI durch
seinen Schachenthusiasmus und seine Veröffentlichungen einem breiten Kreis
polnischer Schachspieler nahe bringen.
Hier nochmals eine Kostprobe:
KAROL IRZYKOWSKI
– ALEKSANDER AMEISEN
Krakau, 14.01.1913
(Anmerkungen nach IRZYKOWSKI)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6 5.Sc3 Lb4 6.Sdb5
Sf6 7.Sd6+ Lxd6
Hier wird gewöhnlich 7...Ke7 gespielt.
8.Dxd6 De7 9.e5 Dxd6
In der Hoffnung, danach den
Bauern d6 zu gewinnen.
10.exd6 a6 11.a4
Sb4 12.Kd1 Sg4 13.Le3 Sxe3+ 14.fxe3 0–0 15.a5 b5 16.axb6 Tb8 17.Sa4 Sd5 18.Ta3!
Deckt
gleichzeitig die Bauern e3 und b6, da auf 18...Sxb6 19.Tb3 folgt.
18...f5 19.c4 Sxb6
Schwarz möchte lieber die Qualität opfern als den weißen
Bauern zu erlauben sich zu verbinden. Ein verzweifelter Zug.
20.Tb3 Sxa4 21.Txb8 Sc5 22.b4!
Eine Kombination, die zum Ziele hat, mittels dreier
Opfer den Gewinn zu forcieren.
22...Se4 23.c5 Sf2+ 24.Ke1 Sxh1 25.Lc4 g5?
Am besten war 25...Kf7. Weiß kann dann den Springer h1
zurückschlagen, und die Spannung auf der 7. und 8. Reihe läßt nach, allerdings
kann der König sich nicht allzuweit von dem Turm entfernen, da eine Kombination
wie die jetzt folgende zu befürchten wäre.

26.Lxe6+ dxe6 27.c6 f4 28.Txc8
Schwarz gab auf.
KAROL IRZYKOWSKI traf im
folgenden auch auf andere führende Spieler Polens, so besuchte Meister
ALEKSANDER FLAMBERG
1914 die alte Hauptstadt und nahm an einem Turnier des Krakauer Schachklubs
teil:
ALEKSANDER FLAMBERG – KAROL IRZYKOWSKI
Krakau 1914
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lb5 d6
5.d4 exd4 6.Sxd4 Ld7 7.0–0 Le7 8.Sde2 0–0 9.Sg3 Te8 10.b3 Lf8 11.Lb2 g6 12.Dd2
Lg7 13.Tae1 a6 14.Le2 Sg4 15.h3 Sh6 16.Sd1 Dh4
Besser
18...Lxb2, wonach der weiße Springer schlecht stehen würde.
17.Lxg7 Kxg7 18.Se3 Se7?
Kein Opfer, sondern ein Übersehen.
19.Dc3+ f6 20.Dxc7 Lc6 21.Ld3
Nach 21.Dxd6 Lxe4? 22.Sxe4 Dxe4 23.Ld3 wäre die schwarze
Stellung reif zum Aufgeben.
21...Tad8 22.c4 Td7
Falls sofort 22...Sf7, dann 23.Dxe7 und 24.Sf5+.
23.Db6 Sf7 24.b4
Diesen Zug bezeichnete Herr Flamberg selbst als schwach.
24...Se5 25.Lc2 Kh8
Um Sc8 zu ermöglichen.
26.a4 Sc8 27.Dd4 b5 28.cxb5 axb5

29.Se2!
Es droht d6-d5, also mußte Weiß die Dame decken um e4xd5
zu ermöglichen.
29...Tde7
Der Turm hat keine arbeit mehr auf der d-Linie, also
räumt er das Feld für den Springer und übt in Erwartung von f2-f4 Druck auf der
e-Linie aus.
30.f4 Sd7 31.e5 bxa4 32.f5 Dxd4 33.Sxd4 Txe5 34.Sxc6
Txe3 35.Txe3 Txe3 36.Lxa4 Scb6
Beidseitig für remis erklärt.

Im Jahre 1918 übersiedelte er nach Warschau, wo
er bis zum Ende seines Lebens verblieb. 1919 wurde er Redakteur im Büro der
polnischen Sejmstenographen. Seine Weigerung, dem damaligen Präsidenten
PIŁSUDSKI eine Ehrenadresse zu unterschreiben (1933) brachte ihn um seine
Stelle. Er wurde emeritiert und beschäftigte sich ab da nur noch mit Literatur.
1939 wählte man ihn in den Wissenschaftlichen Beirat des Polnischen
Schachbundes.
Die Phase der Okkupation durch das faschistische
Deutschland erlebte er in Warschau. Seine schriftliche Hinterlassenschaft
verbrannte in dieser tragischen Zeit. Er selbst, schwer verletzt, wurde damals
in ein Krankenhaus in Żyrardów gebracht, wo er seinen Verletzungen am 2.
November 1944 erlag. Es hat angesichts der dort damals herrschenden
Unmenschlichkeiten durchaus einen seltsamen (vielleicht für Schachspieler
weniger seltsamen) Beigeschmack, wenn man seinen Erinnerungen aus dieser
Okkupationszeit folgt, und ihn sagen hört: „Es meldete sich eine Versuchung, die
schon lange bekannt war: ich ließ mich dazu verführen an einem Schachturnier
teilzunehmen. Ich gewann vier Partien, verlor vier – davon legal wohl bloß zwei,
dabei lernte ich manches, besonders über Fehler. Ach, meine alten Schachnotizen,
in gelegentlichen Anwandlungen über Jahre geführt – sie sind alle verbrannt!“
Es folgt nun eine Kostprobe aus dem
literarischen Schaffen IRZYKOWSKIS, ein im Jahre 1921 erschienener
literaturkritischer Essay, der Schach als Metapher aufgreift. Eine erstmalige
Veröffentlichung in deutscher Übersetzung:
KAROL
IRZYKOWSKI
Futurismus und Schach
(Übersetzung aus dem Polnischen von Thomas Lemanczyk)
Wollen wir uns die Situation der modernsten
Kunst veranschaulichen, so bieten sich zu diesem Behuf einige Proben aus dem
Mikrokosmos des Schachspiels an.
Die Art und Weise nach der heute Schach
gespielt wird währt erst einige Jahre. Früher bewegten sich Dame und Läufer bloß
um ein Feld weiter, mit der Folge daß die Möglichkeiten zu Kombinationen dünn
gesät waren; erst als spanische Schachspieler auf die Idee verfielen, den
Wirkungskreis dieser Figuren zu erweitern, eröffneten sich sehr schöne
Kombinationsmöglichkeiten, entwickelte sich langsam die Theorie, bis plötzlich
im 19. Jahrhundert eine grandiose Schachblüte einsetzte, sich
Turnierveranstaltungen mehrten sowie Schachschulen und Schachstile entstanden:
klassisch, idealistisch, realistisch, mit verschiedenen Renaissancen in neuester
Zeit. So erwies sich also die Einführung einer neuen Zugregel, nur zwei Figuren
betreffend, für das Schachspiel als ein solcher Antrieb wie es beispielsweise
die Erfindung des Schießpulvers für die Menschheitsgeschichte war.
Aber die Schachspieler sind sich darüber im
klaren, daß das heutige Schachsystem, das auf einer gewissen Absprache beruht,
nicht ewig andauern kann, daß irgendwann eine Zeit anbrechen wird, in der die
Kombinationen innerhalb dieses Systems sich mehr oder weniger erschöpft haben
und kodifiziert sein werden. Dann werden den Meistern, Künstlern und Denkern des
Schachs nicht mehr viele Felder verbleiben auf denen sie ihre Fantasie zur Schau
stellen können. So ist es verständlich, daß gelegentlich Projekte auftauchen,
die Schach wieder auffrischen sollen. Der Schachmeister LASKER erfand das „Freßschach“,
ein Spiel bei dem der König eine mit den anderen gleichwertige Figur ist und bei
dem Schlagzwang besteht, was also bedeutet, daß sich das Spiel nicht mehr um den
König dreht sondern die republikanischen Prinzipien des Damespiels aufs Schach
angewendet werden. Jemand anderes führte die Spielvariante der sog. ‚Fliegenden
Springer’ ein: Beide Spieler beginnen mit nur einem Springer, bei Bedarf können
sie den anderen Springer auf ein beliebiges Feld stellen. Andere wiederum
versuchen, zu viert zu spielen und verbinden zwei Bretter und zwei Partien. Es
gibt auch die Legende, der berühmte Schachmeister KISERITZKY
hätte ein dreidimensionales Schachspiel erfunden: sein Schachbrett war ein
Kästchen in Form eines Würfels, entsprechend zogen die Figuren.
Solche Projekte und Neuerungen, die man noch
beliebig erweitern könnte, verkomplizieren das Schachspiel und machen es
unendlich schwer. Die Folge aber dieser Erschwerungen ist eine ganz andere als
die angestrebte: anstelle das Spiel zu bereichern verarmt man es, anstelle die
Fantasie anzuregen desorientiert man sie, den Platz der Berechnung nimmt der
Zufall ein und der genialste Meister fällt herunter auf das Niveau eines
Stümpers. Folglich wird das Spiel primitiver durch die Einführung
komplizierender Elemente.
Man stellt also fest, daß die gegenwärtig Art
und Weise Schach zu spielen auf einer sehr glücklichen Konvention beruht: Das
Spiel ist weder zu leicht und es langweilt nicht, noch ist es zu schwer und
deshalb lassen sich seine Kombinationen im gewissen Rahmen beherrschen; dem
Zufall bleibt soviel Raum, als notwendig ist um aus dem Spiel keine
Wissenschaft, sondern eine Kunst zu machen, damit es die Sphären der
Irrationalität betreten kann. Nicht genug damit: das gesamte heutige Schach
stellt in gewisser Weise eine geistige Errungenschaft mehrerer Generationen von
Schachspielern dar; das Schachniveau wuchs unaufhörlich, denn die Jüngeren
nutzten die Erfahrungen der Vorgänger; Stile und Spielmethoden entwickelten sich
aus einander, teilweise wurden sie aufgesogen, teilweise wurde ihnen ihr
Gegenteil entgegen gestellt. Jeder heutige Schachmeister kennt Tausende
berühmter Schachpartien, Analysen und Positionen auswendig – nur ein Laie kann
glauben, daß infolge dessen für einen solchen Meister das Schachspiel an
Interesse verlieren würde. Die Sache verhält sich genau umgekehrt: Schach kann
nur für einen Stümper, der auf dem Brett bloß wenige Möglichkeiten wahrnimmt,
langweilig sein – erst ein gewisser Wissensschatz und Sachkenntnis beflügeln die
Fantasie und geben dem Spiel eine Perspektive. Schach in seiner heutigen Form
ähnelt alten Geigen, auf denen im Laufe der Jahre verschiedene Meister spielten:
das Holz dieser Geigen ist gleichsam ein lebender und singender Organismus.
Nicht die Essenz, sondern die Bedingung aller Kunst ist das Echo, der
Vorrat an schon gebahnten Wegen im Geiste, der plötzliche Assoziationen,
emotionale Kurzschlüsse auf weiten Räumen, ermöglicht.
Würde man aber beispielsweise der Dame bloß
die Eigenschaften des Springers hinzugeben – auch dies wurde schon probiert – so
riefe bereits diese geringe Modifikation wandalische Verwüstungen des Erbes der
Schachkultur hervor. Die gesamte vielbändige Schachliteratur, die gesamte
bisherige Spieltradition würde überflüssig – alles müßte von neuem beginnen,
neue Traditionen müßten begründet werden, dafür aber würde man viel Zeit
brauchen und sicherlich auch andere, aufnahmefähigere, gescheitere Gehirne.
Solche Krisen im schachlichen Mikrokosmos können sich noch viele Male
wiederholen, bis jener utopische Moment eingetreten sein wird, in dem eine
Schachmathematik mit Hilfe ihrer Formeln im voraus alle möglichen Kombinationen
erschöpft hat.
Derjenige, dem es schwer fällt, sich mit
diesem Fall vertraut zu machen, stelle sich das gleiche beim Kartenspiel vor:
was würde passieren, wenn beispielsweise zu den üblichen Karten eine fünfte
Farbe oder ein viertes Bild eingeführt würde?
Wer die bisherige Argumentation gut verstanden
hat, wird sich gewiß denken können, in welcher Beziehung sie zur tatsächlichen
Kunst steht. Schach ist bloß eine Quasi-Kunst, aber die Krisis, die heute in
fast jedem Bereich der Kunst herrscht, läßt sich gerade mit Hilfe der
angewandten Analogie zum Schachspiel unter mehr als einem Gesichtspunkt
verstehen und veranschaulichen.
Wir sind Zeugen einer
sehr intensiven Vermehrung der Elemente der Kunst. Diese Vermehrung
setzte schon vor einigen Jahrzehnten ein, doch etappenweise; in letzter Zeit
scheint es, als habe das Tempo dieses Prozesses zugenommen. In der Musik gab es
zuvor bloß die Neuerungen Wagners, jetzt kehrt man nicht bloß zurück zu früheren
Tonarten, zu früheren Instrumenten, sondern man versucht auch Vierteltöne
einzuführen, was eine wahre Revolution ist, da es der Musikalität der Menschen
außerordentliche Forderungen stellt. Ein Piano mit Vierteltönen wird sich
gegenwärtig sicherlich nicht einbürgern und Konzerte auf einem solchen würden
eine kurzfristige Sensation sein, aber allein in einem solchen Versuch wurzelt
bereits der Futurismus.
Futurismus, das
heißt – so verstehen wir hier diesen Begriff – Antizipieren der Zukunft,
ein gewaltsames momentanes Hinauslehnen über die zwangsläufigen Etappen der
Evolution und ein Blick auf das, was uns dort vielleicht erwartet. Dieser
Futurismus ist eine Welle, die, sehnsuchtsvoller oder interessanter als andere,
über den Pegel schießt, um zumindest in sich selbst ein Endresultat zu erzielen.
Offensichtlich hat dieser Futurismus nichts zu tun mit dem Futurismus MARINETTIS,
der ein NIETZSCHE’sches Äffchen, ein verspäteter Impressionist und ein Schreier
veralteter Losungen ist;
es geht auch nicht an, ihn mit einer bestimmten Technik aus der Malerei gleichen
namens zu vergleichen, obschon diese eines von vielen Details der hier
besprochenen Richtung darstellt. Der gegenwärtige Futurismus versteht sich nicht
mehr als eine Mode, sondern als ein psychologisches Bedürfnis: um über die
eigene Zukunft zu sprechen – es dringt besser in den im geraden Stile WELLS’
verfaßten Antizipationen durch als in vielen „futuristischen“.
In der Architektur
finden wir die interessanten Ideen des deutschen Architekten TAUT:
er reichte Projekte von ziemlich kleinen Tempeln bzw. Zukunftshäusern ein, aber
auch von Plastiken und Überarbeitungen von Bergen im Geiste einer höheren
Schönheit, von Umgestaltungen von Flüssen und Seen,
von Umgestaltungen des gesamten Weltkreises und späterhin der Sterne. Folglich
ist dies kosmische Architektur und gleichzeitig das krasseste Beispiel für
expressionistischen Subjektivismus: wir gewöhnten uns daran, die ursprüngliche
Schönheit der Natur als Maßstab für die Schönheit in der Kunst zu nehmen, ein
Maßstab der unbewußt an allen unseren Urteilen haftet, aber hier getraut sich
menschlicher Geist, dieser Schönheit sein Recht aufzuzwingen.
Von allen Künsten
jedoch stellte die Malerei einen Rekord bezüglich der bewußten Vermehrung
ihrer Elemente auf und wurde zur heutigen philosophischen Kunst par excellence,
die sich mit Experimenten aus der Theorie der optischen Erkenntnis beschäftigt.
Wie wird der Gegenstand aussehen, wenn wir unsere gesamte Kenntnis seiner
verdrängen, können wir uns vorstellen, wir würden ihm zum ersten Male sehen? Wie
würde dann die ganze Welt aussehen? Wie sehen die Gegenstände in unserer
Vorstellung, der Erinnerung und im Traum aus? Oder ein zweites Extrem: Wie sieht
der Gegenstand aus, wenn wir ihn gemeinsam mit der gesamten Fülle der Gedanken
und Gefühle betrachten, die in uns geweckt werden? Ein anderes Experiment
wiederum ist die Verschmelzung verschiedene Momente auf einem Bild zu einem
einzigen – gleichsam eine Behandlung der Zeit als Raum; oder ein unsymmetrisches
Ornament, die Ambition, aus der Malerei optische Musik zu gestalten, in der
unheimliche Linien, Punkte, Pläne und Konturen, eingeflochten gemäß eines
optischen Kontrapunktes, spielen und singen sollen... – Die Malerei, aus der
Welt der Realität verdrängt durch die Fotographie, möchte nicht bloß ihre
eigenen Mittel erweitern sondern sie möchte in die Welt auch neue Sachen
hineinsehen, sie bevölkern, bebauen und möblieren mit noch nicht dagewesenen
Schöpfungen.
Ist das Kino
schon eine Kunst ist oder ist es erst dabei, eine zu werden? Der Streit darum
bleibt fruchtlos. Gewiß ist, daß es künstlerische Elemente in sich trägt und daß
es schon auf das Drama, die Lyrik und die Malerei einwirkte, indem es Verwirrung
und Komplikationen in die Elemente dieser Künste brachte. Allein das Faktum der
Geburt des Kinos verheißt, daß die zukünftige Technik der Kunst noch andere
Überraschungen und Umwälzungen bringen kann – die man vorläufig als Barbarei
bezeichnen wird, als Feinde der geordneten Tradition. Würde sich beispielsweise
das Kino mit dem Grammophon verbinden, so zerstörte dies innerhalb weniger Jahre
das gesamte Theater, aber nicht bloß das Theater, auch die gesamte geschriebene
Literatur würde verarmen.
Das
übermächtige Beispiel der Malerei bewirkte, daß innerhalb der Poesie die
futuristischen Proben sich nicht, wie es bisher geschah, auf dem Felde des
Inhalts zeigten, sondern im Bereich der Form, besonders im Bereich des
Hauptinstruments der Poesie, dem Wort. Wer sich auch bloß flüchtig die neuesten
polnischen futuristischen Werke anschaut: von CZYŻEWSKI, STERN, WAT, MŁODOŻENIEC,
JASIEŃSKI und die
Słopiewnie
von TUWIM,
würde den sicheren Eindruck gewinnen, daß sich aus der polnischen Sprache
irgendein gemütliches Esperanto entwickelt. Dies sind neue Assoziationen und
Assoziationsstörungen, ein etymologisches sich Austoben der erstarrten Sprache –
manchmal bloß Späßchen der Drucker und dadaistisches Geplapper. In Deutschland
dauert dieses Fließen der literarischen Sprache schon seit einigen Jahren an,
sodaß wer heutzutage modernste deutsche Literatur liest, glauben muß, er könne
kein Deutsch. Wir möchten hier kein grundlegendes Urteil über diese Neuerungen
fällen, uns interessiert ihre kulturelle Bedeutung. Wir sehen, daß die Auflösung
der bisherigen Formen noch nicht alle Elemente erfaßt hat: die Syntax, die
Flexion, die Teile der Rede bewegten sich nicht vom Platz, wenngleich bekannt
ist, daß auch sie bloß historische konventionelle Gebilde sind und daß bloß im
Gymnasium die Grammatik die Mathematik der Sprache zu sein scheint. Die
Auflösung hat auch nicht die Laute ergriffen, obwohl die Linguisten wissen, daß
die menschliche Rede sich ohne weiteres noch hunderter weiterer Geräusche
bedienen könnte und daß allein 50 Vokale zu haben wären. Neuerer der Sprache
kann man nur bis zu einer gewissen Grenze sein, solange nämlich die
kontrastreiche Grundlage der bisherigen Sprache funktioniert, muß, nach einigen
unsinnigen Versuchen, sogar der am weitesten linksgerichtete Dadaist
ausgehungert und ermüdet wiederkehren. Man kann nämlich nicht kompletten Unsinn
sagen, immer wird er Rest oder Schutt gewissen Sinnes sein.
Diese Versuche sind also eher
futuristische Faxen, als bewußter Futurismus in großem Maßstab. Aber genauso wie
in der Malerei, haben sie eine sichere Wirkung: sie sind asozial, unverständlich
und individualistisch. Die Sprache ist ein gesellschaftliches Band; wer sie ohne
Vertrag auflockert, ohne neue Konventionen verbindlich zu machen, der wird
automatisch mit Unverständlichkeit bestraft. Kein
Futurist versteht den anderen – das ist die erheiternde Seite dieser
Angelegenheit. Das Echo,
das wir als die Bedingung ästhetischer Wirkung bestimmten, funktioniert in
diesem Falle nicht – so, als nähme man aus einer alten Geige den Resonanzboden
heraus. Die Kunst begibt sich auf gefährliche Irrwege und je fesselnder sie dem
Philosophen erscheint, desto besorgter um sie sollte ihr Adressat und Liebhaber
sein.
Wir haben unsere Sache nun an einen Punkt geführt,
an dem die Berechtigung, Schach zum Vergleich heranzuführen vollends
offensichtlich wird. Aber es lohnt, sich Gedanken über die Art der von uns
angesprochenen Gefahr zu machen. Diese Gefahr ist nicht allzu fürchterlich, da
der Prozeß der Futurisierung der Kunst sich über Jahre erstreckt und unter neuen
Einflüssen zum Versiegen kommen kann oder aufgeschoben wird. Wir erwägen hier
tatsächlich bloß seine ideale Dauerhaftigkeit. Um uns seine weitere Entwicklung
zu veranschaulichen, gebrauchen wir ein weiteres Bild – das Bild des Reims.
Zwischen Reim und Inhalt des Gedichts besteht
jenes Verhältnis, daß der Reim wie ein Dirigent verfährt, der die in der Seele
des Dichters angesammelte potentielle Elektrizität lenkt, bündelt und
konkretisiert.
Es gibt heute wohl keinen derart naiven Dichter
mehr, der behaupten wollte, die Reime kämen ihm „von selbst“ in den Kopf. Die
Künstlichkeit des Reims als poetisches Werkzeug ist etwas zu offensichtlich. Die
Improvisation, die Leichtigkeit des Reimens kommt von der Übung oder von einer
besonderen Fertigkeit des Gedächtnisses und hat folglich nichts zu tun mit
dichterischem Talent. Ich hörte auf einem Bankett die Improvisationen eines
gewissen Ex-Theaterdirektors, der eine uferlos lange gereimte Rede hielt, die
voller durchschnittlicher Prosa war. Ich kann mir auf der anderen Seite
ausgesprochen gut vorstellen, daß ein wahrer Dichter mit dem Reimen große
Probleme haben würde. Nicht der „hat Form“, der die raffiniertesten Reime machen
kann, sondern der, der zu seinen Reimen den besten Inhalt findet, der in jedem
seiner Gedicht ein Maximum dessen herauszukristallisieren vermag, was er
ausdrücken wollte. Ob nun der Reim seinen Inhalt sucht oder der Inhalt seinen
Reim, ist ziemlich unbedeutend: weder ist das eine schändlich noch das andere
besonders rühmlich. Das Ergebnis kann in beiden Fällen das gleiche sein, und ich
bin geneigt anzunehmen, daß der erste Fall häufiger auftritt als der zweite.
Die heute entstehenden neuen
„Formen“ der Kunst sind sozusagen erst der Reim, der vorausgeeilt ist und sich
nach seinem Inhalt umsieht. Der Reim für sich ist
etwas Wunderliches; natürlich und selbstverständlich macht ihn erst all das, was
vor ihm steht. Das
Schicksal der neuen Formen hängt davon ab, ob sie es schaffen, die in der
gegenwärtigen kulturellen Atmosphäre enthaltene Elektrizität auf sich zu ziehen,
oder ob diese sich auf verschiedenen anderen Punkten, ohne spezifisch
künstlerische Bedeutung, entlädt. In gleicher Weise irrt der futuristische Reim
– ich gebrauche den Begriff „Reim“ hier in einem weitergehenden Sinne – zur Zeit
umher, ist selbstzufrieden und verlangt nach Bewunderung wie ein
beschäftigungsloser Lakai, der eine zeitlang die Rolle des Herrn spielt.
Späterer Zusatz: Der Futurismus entstand,
als die Kunst zum ersten Mal eine größere Erschütterung von seiten rein
technischer Elemente (besonders von seiten des Kinos) erfuhr, und sie sich, in
stärkerem Maße als früher, erinnerte, daß sie ebenfalls (das heißt: nicht
ausschließlich) eine Technik ist. Deshalb begnügte sich der Futurismus auch mit
der Genugtuung, die das Erregen von Aufsehen erzeugte. Genauso wie jemand, der
zum ersten Mal in seinem Leben die Klaviatur eines Pianos berührte und davon –
immerhin – einen gewissen ästhetischen Eindruck gewann, wie abwegig und
barbarisch dieser auch sein mag.
Dieser Artikel würdigt das Leben eines polnischen Autors. Den Liebhabern
deutscher Literatur sei die Seite des ARNO-SCHMIDT-Experten Dr. MARIUS
FRÄNZEL anempfohlen:
http://www.musagetes.de/as/schachstellen.html.
Dr. FRÄNZEL hat mit vorbildlichem Fleiß ein kommentiertes
Verzeichnis aller Schachstellen im Gesamtwerk ARNO SCHMIDTS
zusammengestellt.
An dieser Stelle möchte ich Herrn TOMASZ LISSOWSKI (Warschau), der mir
erlaubte, Text- und Bildmaterial aus seinem gemeinsam mit MIROSŁAWA
LITMANOWICZ verfaßten Buch KAROL IRZYKOWSKI - Pióro
i Szachy [Schriftstellerei und Schach] (Warschau
2001) für meinen Artikel zu verwenden, meinen Dank aussprechen.
Hier die Partie mit den Chessbase-Kommentaren aus der Megabase 2004:
TARRASCH
- WALBRODT,
Hastings 1895
1.e4 e5 2.Sf3
Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.Sc3 d6 6.d4 Ld7 7.Lxc6 Lxc6 8.De2 [8.Dd3! exd4
9.Sxd4 Ld7 10.Lg5 Le7 11.0–0–0±] 8...exd4 9.Sxd4 Ld7 against 10.Sd4-f5
10.0–0 Le7 11.b3 [11.Lg5!] 11...0–0 12.Lb2 b5
… 14... c5, 15... b4, 16...
Lb5µ
13.a4 [¹13.e5;
¹13.Tfe1 b4 14.Sd5] 13...b4 14.Sd1
[14.Sd5 c5 15.Sf3 (15.Sxe7+ Dxe7 16.Sf3 Dxe4 17.Dd2 De7 18.Tfe1 Le6³)
15...Sxd5 16.exd5 Lf6ƒ]
14...c5 15.Sf3 Lc6 16.Sd2 [16.e5 Sd5ƒ]
16...d5!ƒ
17.e5 [17.exd5 Sxd5µ]
17...Se8 18.Se3 Dd7 19.Tad1 d4! 20.Sec4
De6 21.f4 f5 22.Sa5 Ld5 23.Dd3 Kh8!
… Tg8, g5‚
24.Dg3 Ta7 25.Sac4 Tg8 26.Tde1 g5!
27.Te2 Ld8 28.Dd3 Tag7 29.g3–+ TARRASCH
[¹29.fxg5
Txg5 30.Sf3µ]
29...gxf4?! ×f5 [29...g4! TARRASCH
30.Kf2 h5 31.Ke1 Th7 32.Kd1 h4 33.Kc1 Kg7 34.Kb1 Tgh8 35.Tg1‚
µ/–+]
30.Txf4 Tg5 31.Tef2 Sg7 32.Sd6 Dxe5?! [32...Tf8 33.S2c4 Th5
… Lg5 34.g4‚;
32...Lc7! 33.Sxf5 (33.S6c4 Lxe5
34.Te2 Lxf4 35.Txe6 Sxe6µ)
33...Lxe5µ]
33.Sxf5 Sh5? [33...Se6! 34.Te4
(34.Th4? T5g6 35.Th6 Lg5 36.Txg6 hxg6 37.Sh4 Lxh4 38.gxh4 Sf4–+)
34...Lxe4 35.Dxe4 Dxe4 36.Sxe4 Tg4! 37.Sed6©]
34.Txd4 Sxg3 [34...cxd4 35.Lxd4+-;
34...Sf6 35.Txd5 Dxb2 36.Txd8+-; 34...Lf6 35.Txd5 Dxb2 36.Se4+-] 35.Sxg3
Txg3+ 36.hxg3 Txg3+ 37.Kf1! Txd3 38.Tg4! 1–0
Es sei hier erwähnt, daß sowohl Zwycięstwo als auch die Pałuba
als deutsche Übersetzung nach wie vor Desiderat sind.
FLAMBERG bezwang nicht bloß ČIGORIN, sondern war auch zäher Gegner ALEKHINES
und RUBINSTEINS, vgl. die Megabase 2004.
Zitiert nach: WŁADYSŁAW LITMANOWICZ/JERZY GIŻYCKI: Szachy od A do Z
[Schach von A bis Z], Bd. 1, Warschau 1986, S. 377f..
Ich bin Chessbase sehr dankbar für diese so seltene Möglichkeit.
Quelle: KAROL
IRZYKOWSKI:
Cięższy i lżejszy Kaliber, [Schwereres und leichteres Kaliber] o. O. 1957,
S. 399-409; Erstdruck in: Kurier Lwowski, 1921, Nr. 109 und Ponowa,
Warschau, 1921, Nr. 1, S. 36-42.
Anm. d. Üb.: Im polnischen Original: ‚KIZIERZYCKI’.
Der Schachmeister DUFRESNE behauptet, Schach sei nicht bloß ein
Spiel, sondern auch die Exemplifikation eines gewissen Wissens vom Raum,
dessen Grundlagen noch nicht erforscht seien. Tiefe Gedanken über das
Schachspiel teilt WEKERIE in seinem Werk Philosophie des Schachs mit.
Seines Erachtens sind die Elemente des Spiels: Raum, Zeit sowie Wert und
Dynamik die den Figuren eigen sind.
Anm. d. Üb.: FILIPPO TOMMASO MARINETTI (1876-1944), der italienische
Begründer des ‘Futurismus’ (1909 veröffentlichte er das Futuristische
Manifest), einer ursprünglich literarischen Bewegung, die einen Bruch
mit den überkommenen, ihrem Verständnis nach der technischen Entwicklung
nicht gerecht werdenden, Stilrichtungen forderte und u. a. eine neue Syntax
und ein neues Vokabular zu erschaffen versuchte. Der Futurismus griff auch
bald auf die Malerei über (1910 entstand das Manifest der futuristischen
Maler), wo er allerdings bald wieder verschwand. Die futuristischen Maler um
UMBERTO BOCCIONI (1882-1916) stellten in ihren Bildern die Dynamik der
Gegenstände, ihre Bewegungen in Zeitraffer, sogar Geräusche (!) dar.
Anm. d. Üb.: Immerhin brachte er es später unter der faschistischen
Regierung MUSSOLINIS zum italienischen Kultusminister. In seinem Buch
Futurismo e Fascismo (1924) pries er den Faschismus als natürliche
Fortsetzung des Futurismus.
Anm. d. Üb.: BRUNO TAUT (1880-1938) wurde bekannt durch seinen
Glaspavillon für die Kölner Werkbundausstellung 1914. 1919 erschien sein
Buch Alpine Architektur, auf das sich IRZYKOWSKI hier offenbar
bezieht. Eine Vorstellung dieses Werkes findet sich unter:
http://emmet.de/por_taut.htm.
Eine Tatsache ist die Ausbesserung der Niagarafälle auf der kanadischen
Seite. Mit Hilfe von „unsichtbaren Stauwehren“, die die Fließrichtung der
Wasser der Ufergegend abändern, da diese das Felsgestein des Wasserfalls
durch Reibung vermindern, konnte ein Rückgang bewirkt werden.
Diese Befürchtung war eitel, da alle alten Formen der Kultur ein zähes Leben
führen. Zweifellos jedoch gelang dem Tonkino ein neuerlicher Raub innerhalb
der Klientel des Theaters und der Literatur. Gäbe es nicht die enormen
Kosten in der Herstellung der Tonfilme, gelänge es dem Kapital, vollständig
die sprachlichen Schwierigkeiten zu überwinden um den Film für jedes
einzelne Land zu adaptieren, und schließlich, würde die finanzielle
Notwendigkeit es nicht erzwingen, den künstlerischen Wert des Tonfilms so
niedrig wie möglich zu halten, um ihn populär zu machen – die Katastrophe
hätte beträchtlich an Geschwindigkeit zugenommen.
Anm. d. Üb.: TYTUS CZYŻEWSKI
(1880-1945), ANATOL STERN
(1899-1968), ALEKSANDER WAT
(eigentlich ALEKSANDER CHWAT) (1900-1967), STANISŁAW
MŁODOŻENIEC
(Pseudonyme JAN CHMUREK und JAN RUTA) (1895-1959), BRUNO
JASIEŃSKI
(1901-1939). Die Genannten bildeten den Kreis der polnischen Futuristen, die
sich am italienischen und russischen Futurismus (um VLADIMIR MAJAKOVSKIJ
(1893-1930)) orientierten und bald nach ihrem Erscheinen (etwa 1917) auch
wieder von der Bildfläche verschwanden (Mitte der 20er Jahre).
IRZYKOWSKI
nennt hier auch JULIAN
TUWIM
(1894-1953), der allerdings nicht zu den Futuristen zählte. TUWIMS unter
Einfluß des Dadaismus entstandenes Gedicht
Słopiewnie
(eine Wortschöpfung aus „Wort“ (słowo) und „Lied“ (pieśń),
also Wortlied)
ist dem polnischen
Komponisten KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937) gewidmet, der es 1921 als ‚Słopiewnie
für Stimme und Orchester, op. 46 bis’
vertonte.
Dieser Vergleich hinkt nur insofern, als daß die neueste Poesie anstelle des
Reims sich der Assonanz bedient