Schach und
Psychoanalyse
Unbestritten
ist der Nutzen zahlreicher Erkenntnisse aus der psychoanalytischen Forschung für
die Psychotherapie sowie für die Erklärung von Fehlleistungen im Leben der
Gesunden. Etliches von dem was SIEGMUND FREUD (1856-1939) und die von ihm
begründete psychoanalytische Schule seit ihrem Erscheinen zu Beginn des 20.
Jahrhunderts an seinerzeit Staunenswertem (Unbewußtes, etc.) zu sagen hatten,
ist heutzutage Allgemeingut geworden.
Zieht man dies
in Betracht, so bleibt es schwer zu verstehen, wieso so viel Widerwillen und
Ablehnung nach wie vor gegenüber der Lehre und manchen ihrer Erklärungen
vorherrscht, zwar nicht mehr in gleicher Heftigkeit wie zu FREUDS Lebenszeit,
aber dennoch. Aus seiner therapeutischen Praxis ist FREUD ein enormer
Erfahrungsschatz erwachsen, der ihm, gemeinsam mit seiner umfassenden
kulturellen Bildung und seinem enormen Scharfsinn zur Grundlage seiner
Psychoanalyse wurde. Seine Schriften umfaßten nicht allein die klinische Praxis,
sondern befaßten sich gleichfalls mit Problemen der Kultur, die mit
psychoanalytischer Terminologie zu deuten versucht wurden. Nicht nur die Psyche
des Patienten fand die Aufmerksamkeit FREUDS sondern ebenso manches interessante
Material menschlicher Kultur. Er schrieb Monographien über das Leben des
LEONARDO DA VINCI und MICHELANGELOS, wofür sich weit mehr der Begriff
Materialanalyse zu eignen scheint.
Eine solche
Materialanalyse fertigte der Brite, FREUD-Schüler sowie FREUD-Biograph ERNEST
JONES (1879-1958) im Jahre 1930 über PAUL MORPHY an. Großmeister REUBEN FINE
(1914-1993), Autor der Psychologie des Schachspielers (1956), fußte in
eben diesem Werk auf JONES’ sehr unterhaltendem Essay (dies nicht allein auf die
Erkenntnisse über MORPHY beschränkt).
„(...) [Es]
kommt uns das Bedenken, daß wir einen Menschen, der ein außerordentlicher Könner
auf einem bestimmten Gebiet ist, darum doch nicht ohne weiteres einen großen
Mann heißen würden. Gewiß nicht einen Meister des Schachspiels (!) (...)“, heißt
es ganz unvermittelt in FREUDS Werk Der Mann Moses und die monotheistische
Religion, im Jahre 1939 (hier zitiert nach Ausgabe Frankfurt/Main 1997, S.
110). Sollte dies ein Naserümpfen des Meisters über die Auswahl der JONES’SEN
Themen sein? Jedenfalls schrieb Jones (leider) nicht mehr über Schach.
Es liegt
erstmals eine deutsche Übersetzung dieser ersten psychoanalytischen Schrift zu
einem Schachmeister vor.
ERNEST JONES: Das Problem des PAUL MORPHY
Ein Beitrag zur Psychologie des Schachs
(Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Lemanczyk)
 PAUL MORPHY wurde am 22. Juni 1837 in New Orleans
geboren; er hatte eine sechseinhalb Jahre ältere und eine zweieinviertel Jahre
jüngere Schwester sowie einen zweieinhalb Jahre älteren Bruder.
Sein Vater war Spanier, aber von irischer Abstammung, seine Mutter war
französischer Herkunft.
PAUL MORPHY wurde am 22. Juni 1837 in New Orleans
geboren; er hatte eine sechseinhalb Jahre ältere und eine zweieinviertel Jahre
jüngere Schwester sowie einen zweieinhalb Jahre älteren Bruder.
Sein Vater war Spanier, aber von irischer Abstammung, seine Mutter war
französischer Herkunft.
Als PAUL zehn
Jahre alt war, brachte ihm sein Vater, selbst kein bedeutender Spieler, Schach
bei. Nach ein bis zwei Jahren erwies er sich als stärker als sein älterer Bruder
EDWARD, als sein Vater, als sein Onkel mütterlicherseits und als sein Onkel
väterlicherseits, der zu dieser Zeit der Schachkönig von New Orleans war. Eine
Partie ist überliefert, die er, einem Augenzeugen gemäß, an seinem zwölften
Geburtstag blind gegen seinen Onkel gespielt und gewonnen haben soll. Im selben
Alter spielte er gegen zwei Meister von internationaler Reputation, die sich zu
dieser Zeit in New Orleans aufhielten. Einer der beiden war der berühmte
französische Spieler ROUSSEAU, mit dem er etwa fünfzig Partien spielte und volle
90 Prozent gewann. Der andere war der ungarische Meister LOEWENTHAL, einer aus
dem halben Dutzend bester damals lebenden Spieler; von den beiden gespielten
Partien gewann der junge PAUL eine, die andere endete remis. Nach dieser Periode
wurde für etwa acht Jahre nur wenig ernsthaftes Schach gespielt, da er seinen
Studien nachging; sein Vater gestattete ihm zwar gelegentlich an Sonntagen zu
spielen, aber mit Ausnahme des Richters MEEK, dem Präsidenten des Amerikanischen
Schachkongresses, gegen den er als Siebzehnjähriger sechs Partien gewann, stieß
er nur auf klar unterlegene Gegner. Sein Onkel hatte bis dahin New Orleans in
Richtung Westen verlassen, ROUSSEAU war anderweitig unabkömmlich, und PAULS
Bruder, Vater und Großvater haben Schach aufgegeben als er noch Teenager war. So
ist möglicherweise die Behauptung wahr, daß er zu dieser Zeit auf niemanden
traf, dem er nicht einen Turm hätte vorgeben können, mithin also auf niemanden,
von dem er etwas hätte lernen können. Im Jahre 1851 wurde das erste
internationale Schachturnier ausgerichtet, das ANDERSSEN als Sieger verließ, und
1857, als MORPHY gerade zwanzig Jahre alt war, fand eins in New York statt. Er
errang mit Leichtigkeit den ersten Platz, wobei er bloß eine von siebzehn
Partien verlor. Er spielte während seines Aufenthalts in New York hundert
Partien mit den besten dortigen Spielern, verlor davon nur fünf. Unter
Umständen, auf die wir bald unsere Aufmerksamkeit lenken werden, besuchte er im
folgenden Jahr London und Paris; seine dortigen erstaunlichen Leistungen lesen
sich wie ein Märchen. Er schlug nicht bloß jeden Meister, ANDERSSEN
eingeschlossen, den er zum Spiel bewegen konnte, sondern er gab auch eine Reihe
staunenswerter Blindsimultanvorstellungen gegen jeweils ausgewählte acht
Spieler, wobei er die große Mehrheit der Partien gewann. Gegen Ende seines
Paris-Aufenthaltes schlug er den gesamten konsultierenden Versailler Schachklub
in einer von ihm blind geführten Partie. Nach seiner Rückkehr nach New Orleans
erklärte er, gegen jeden auf der Welt unter Vorgabe spielen zu wollen. Als er
hierauf keine Erwiderung erfuhr, erklärte er seine Kariere als Schachspieler,
die gerade einmal 18 Monate – einschließlich der sechs Monate öffentlichen
Spiels – andauerte, für endgültig und unwiderruflich beendet.
Über die
tatsächliche Spielstärke MORPHYS wollen wir später etwas sagen, doch für den
Moment genügt mitzuteilen, daß die meisten der kompetenten Beurteiler ihn für
den größten Schachspieler aller Zeiten erklärten. Nach seinem überaus verfrühten
Rückzug vom Schach begann er, wie sein Vater, als Jurist zu praktizieren. Aber
obwohl er viel Geschick in dieser Arbeit zeigte, blieb er in der Praxis
erfolglos. Schrittweise fiel er in einen Zustand der Zurückgezogenheit und
Introversion,
der in einer unverkennbaren Paranoia kulminierte. Im Alter von 47 Jahren starb
er an einer plötzlichen ‚Blutstauung im Gehirn’,
vermutlich einem Schlaganfall, wie auch sein Vater vor ihm.
Es stellt sich
das offenkundige Problem, in welchem Verhältnis denn – bzw. ob überhaupt davon
gesprochen werden kann – seine tragische Neurose zu den höchsten Leistungen
stand, die er in seinem Leben erbrachte, zu Leistungen, für die sein Name in der
Schachwelt für immer erinnert werden wird. Allgemein glaubte man, die exzessive
Beschäftigung mit Schach hätte sein Gehirn angegriffen, doch seine Biographen,
natürlich Schachenthusiasten, die bestrebt waren, das Ansehen ihrer geliebten
Beschäftigung zu wahren, beteuerten voll Überzeugung, daß dem in keiner Weise so
wäre. Angesichts dessen, was wir bisher über ihn erfahren haben, möchten wir es
allerdings für unmöglich halten, daß es keinerlei nähere Verknüpfung zwischen
der Neurose, die notwendig etwas zu tun hat mit dem Kern der Persönlichkeit, und
den großartigen Sublimierungsanstrengungen, die MORPHYS Namen unsterblich
gemacht haben, geben sollte. In Erwägung dieses Problems beginnen wir mit
einigen Gedanken über die Natur der in Frage stehenden Sublimierung.
Schon die
flüchtigste Begegnung mit Schach offenbart, daß es sich bei ihm um einen
Spiel-Ersatz für die Kunst des Krieges handelt, und tatsächlich war es eine der
Lieblingserholungen einiger der größten militärischen Führer von WILLIAM dem
Eroberer bis NAPOLEON. Im Wettstreit der beiden gegnerischen Armeen entfalten
sich, gleichsam wie in einem tatsächlichen Krieg, Strategie und Taktik; vonnöten
sind hier die gleiche Voraussicht und Rechenkraft sowie die gleiche Fähigkeit
zum Vorausahnen der gegnerischen Pläne. Die Konsequenzen gefällter
Entscheidungen ereilen den Spieler mit gleicher Strenge, wenn nicht sogar mit
noch rücksichtsloserer. Über all dies hinaus ist deutlich, daß das unbewußte
Motiv, welches die Spieler antreibt, nicht die bloße, für alle Konkurrenzspiele
charakteristische, Liebe zur Kampflust ist, sondern das weit grimmigere des
Vatermordes. Es ist wahr, daß das ursprüngliche Ziel des Fangens des Königs
aufgegeben wurde, aber vom Gesichtspunkt des Motivs, ausgenommen hinsichtlich
der Roheit, ist das jetzige Ziel der Kastration durch Bewegungsunfähigkeit kein
nennenswerter Wechsel. Die Geschichte des Spiels und seine Benennungen haben für
uns bestätigendes Interesse. Die Autoritäten scheinen darin überein zu stimmen,
daß das Spiel seinen Ursprung in Indien hat, von wo es nach Persien gelangte,
dessen arabische Eroberer es vor ungefähr 1000 Jahren nach Europa vermittelten.
Sein erster Name, von dem alle anderen abgeleitet wurden, war im Sanskrit
Chaturanga, wörtlich: vier Glieder. Dies war zugleich das indische Wort für
‚Armee’, vielleicht wegen seiner vier Bestandteile aus Elefanten, Streitwagen,
Pferden und Fußsoldaten. Die alten Perser kürzten den Namen Chaturanga ab
in Chatrang, und ihre arabischen Nachfolger, die weder den Anfangs- noch
den Endlaut dieses Wortes in ihrer Sprache besaßen, wandelten es ab in
Shatranj. Als das Spiel später in Persien wiederauftauchte muß das Unbewußte
mit im Spiel gewesen sein, denn der Name wurde nun abgekürzt in Schah,
eine offensichtliche Anpassung an den Namen des persischen Shah = König
fand statt; ‚Schach’ bezeichnet demnach das königliche Spiel oder das Spiel der
Könige. Shah-mat, unser ‚Schachmatt’, englisch ‚check-mate’, französisch
‚échec et mat’, bedeutet wörtlich ‚der König ist tot’. Zumindest die arabischen
Schreiber glaubten dies und die meisten europäischen Autoren folgen ihnen darin.
Moderne Orientalisten allerdings sind der Auffassung, daß das Wort ‚mat’
persischen und nicht arabischen Ursprungs ist und daß ‚Shah-mat’ ‚der König ist
gelähmt, hilflos und besiegt’ bedeute. Wieder macht dies aus der Sicht des
Königs nur einen sehr geringen Unterschied.
Im Mittelalter
wurde eine interessante Neuerung, die beiläufige Erwähnung verdient, in die
Regeln des Schachs eingeführt. Zu Seiten des Königs steht eine weitere Figur,
die ursprünglich sein Berater gewesen war, Persisch Firz (Türkisch
Vizier). Da seine Hauptbeschäftigung nicht im Kämpfen sondern im Beraten und
Verteidigen lag, war er in seiner Beweglichkeit die schwächste Figur auf dem
Brett. Sein einziger Zug verlief ein Feld diagonal. Im Mittelalter wechselte er
stufenweise sein Geschlecht, machte damit die gleiche Wandlung durch wie der
Heilige Geist, und wurde bekannt als Regina, Dame, Queen usw. Es ist nicht
bekannt, warum dies geschah. FRERET, ein Autor des 18. Jahrhunderts, der über
Schach schrieb, behauptete, eine Verwechslung der Wörter ‚Fierge’, französisch
für Firz, und ‚Vierge’ müsse stattgefunden haben. Weit allgemeiner wurde
angenommen, daß der französische Name für das Damespiel, dames, Anlaß für
die Umtaufe gab, da dies die einzige Figur war, in die sich der Bauer umwandeln
konnte sobald er die achte Reihe erreichte und er zuweilen auch ‚un pion damé’
genannt wurde. Etwa in der Mitte des 15. Jahrhunderts folgte dem
Geschlechtswandel auch ein enormer Machtzuwachs, sodaß diese Figur heute stärker
ist als irgendwelche zwei anderen zusammen. Wie auch immer die Wahrheit hierzu
aussehen mag, die von mir erwähnten linguistischen Vermutungen jedenfalls lassen
dem Psychoanalytiker das Ergebnis des Wandels klar werden: im Angriff auf den
Vater bietet die Mutter (=Dame) die größtmögliche Unterstützung.
Es ist an
dieser Stelle sicherlich die Bemerkung angebracht, daß die mathematische
Qualität des Spiels ihm eine besonders anal-sadistische
Natur verleiht. Die außerordentliche Reinheit und Exaktheit der richtigen Züge,
besonders in den Problemaufgaben, wird vereint mit unerbittlicher Forcierung in
späteren Stufen und kulminiert im gnadenlosen
dénouement.
Überragende Meisterschaft auf der einen Seite mißt sich mit auswegloser
Hilflosigkeit auf der anderen. Zweifellos ist es dieses anal-sadistische
Charakteristikum, das das Spiel so wohlgeeignet macht zur gleichzeitigen
Befriedigung sowohl der homosexuellen als auch der antagonistischen Aspekte der
Auseinandersetzung zwischen Sohn und Vater. Unter diesen Umständen wird es
verständlich, daß eine ernste Partie eine bedeutende Belastung für die
psychische Integrität darstellt und daß sie wahrscheinlich jede Unvollkommenheit
charakterlicher Entwicklung enthüllt. Alle Spiele sind dazu geeignet, von Zeit
zu Zeit durch unsportliches Verhalten Schaden zu nehmen, das heißt mittels einer
Sublimierung, die sich einer Regression zu ihrem asozialen Ursprung unterzieht;
im Schach ist die Spannung allerdings außergewöhnlich hoch und sie wird durch
den Umstand erhöht, daß ein besonders hoher Standard korrekten Benehmens
verlangt wird.
Es ist
interessant, diese psychologischen Erwägungen mit historischem Material zu
vergleichen, das Aussagen darüber enthält, in welcher Weise religiöse
Autoritäten das Spiel aufnahmen. VAN DER LINDE und MURRAY, die beiden größten
Autoritäten auf dem Gebiet der Schachgeschichte, behandeln mit Verständnis die
indische Überlieferung, die Buddhisten hätten Schach erfunden. Es ist
verständlich, daß die erste Erwähnung des Spiels in Zusammenhang mit dem
Bollwerk der Buddhisten steht. In der Vorstellung der Buddhisten sind Krieg und
Mord an Mitmenschen, gleich zu welchem Zweck, kriminelle Akte und die Strafe die
den Krieger in der nächsten Welt erwartet wird weit schlimmer sein, als die für
den einfachen Mord; deshalb, so die Legende, erfanden sie Schach als einen
Ersatz für den Krieg. Damit erschienen sie als Vorläufer von WILLIAM JAMES,
der den Vorschlag unterbreitete, dem Kriege ähnelnde Ersatzmittel einzuführen,
womit er ganz im Einklang mit der psychoanalytischen Lehre von den
Verschiebungen der Effekte stand. Ins gleiche Horn stößt ST. J. G. SCOTT, wenn
er eine burmesische Geschichte erzählt, in der eine Königin der Talaing
aus Liebe zu ihrem Gemahl das Spiel erfand um ihn durch diese Ablenkung vom
Krieg abzuhalten. Die ganze Geschichte erscheint dennoch ambivalent, weil
andererseits gleichfalls die Ansicht geäußert worden ist, Schach sei von einem
chinesischen Mandarin, HAN-SING, erfunden worden um seine im Winterlager
untergebrachten Soldaten zu erfreuen. Eine Legende aus Ceylon besagt, RAVAN, die
Gattin des Königs von Lanka hätte das Spiel erfunden um ihren Gemahl von der
Belagerung seiner Hauptstadt abzulenken. Andererseits verhängte um das Jahr 1000
ein sittenstrenger Regent Ägyptens, bekannt als MANSAR, ein Edikt, das Schach
verbot. Im Mittelalter wurde Schach weithin populär. Die kirchliche Haltung ihm
gegenüber scheint weitestgehend negativ gewesen zu sein. Die Statuten der Kirche
von Elna beispielsweise besagten, daß Geistliche, die Schach duldeten, ipso
facto zu exkommunizieren wären. Zum Ende des 12. Jahrhunderts verbot der
Bischof von Paris den Geistlichen sogar, in ihrem Haus ein Schachbrett
aufzubewahren; im Jahre 1212 verdammte das Konzil von Paris es vollständig; etwa
40 Jahre später verhängte der Hl. LUDWIG, der fromme König von Frankreich, eine
Strafe über jeden, der es wagte Schach zu spielen. Als JAN HUSS sich in
Gefangenschaft befand, bedauerte er Schach gespielt zu haben, da er sich damit
der Gefahr ausgesetzt hatte, jetzt das Opfer brutaler Gewalt zu werden.
Ich komme nun
zurück zu PAUL MORPHYS Problem und gebe zunächst einige Erläuterungen zu seinen
persönlichen Eigenschaften und einige Charakteristiken seines Spiels. Von seiner
Erscheinung war er klein, bloß 1,65 m groß, mit ungewöhnlich kleinen Händen und
Füßen, von schlanker, graziler Gestalt und ‚einem Gesicht wie ein junges, noch
nicht 20jähriges, Mädchen’ (F. M. EDGE). FALKBEER, der ihn kannte, bemerkte über
ihn: „Man würde ihn eher für einen Schuljungen in seinen Ferien halten als für
einen Schachmeister der den Atlantik überquerte zum ausschließlichen Zwecke,
einen großen Meister nach dem anderen, die größten Meister, die die Welt damals
kannte, zu besiegen.“ Er hatte ein anziehendes Auftreten und ein reizvolles
Lächeln. Sein Benehmen war auffallend bescheiden. Es ist überliefert, daß er
bloß zwei Herausforderungen an andere Spieler aussprach. Mit einer
beängstigenden Intuition wählte er zu diesen Ausnahmen die Herren STAUNTON und
HARRWITZ, die einen so unheilvollen Einfluß auf sein Leben nehmen sollten.
Selbst in der unangenehmsten Meinungsverschiedenheit, dies sei hier
vorangestellt, bewahrte er die größte Höflichkeit und Würde. Während des Spiels
war er ganz ungerührt und seine Augen waren starr aufs Brett gerichtet; seine
Gegner stellten fest, daß, sobald er vom Brett aufsah – was er ohne jeden Anflug
von Jubel in den Augen tat – , dies bedeutete, daß er die Stellung bereits bis
zum unvermeidlichen Ende vorausgerechnet hatte. Seine Geduld schien
unerschöpflich zu sein; EDGE, sein erster Biograph, berichtet, er hätte den
berühmten PAULSEN ein oder zwei Stunden über einen einzigen Zug nachdenken
sehen, während MORPHY ruhig wartend dasaß ohne das geringste Unbehagen zu
äußern. Er schien unempfänglich für Müdigkeit, und ich möchte nun eine
Begebenheit schildern, die sowohl seine Ausdauer belegt als auch zwei weitere
seiner Eigenschaften: sein erstaunliches Gedächtnis – welches er im Übrigen auch
für Musik besaß – und seine sinnliche Vorstellungskraft, die eine Eigenschaft
ist, die Schachspieler mit Musikern und Mathematikern gemein haben. Diese
Geschichte wird von EDGE, der damals als sein Sekretär tätig gewesen war,
erzählt und betrifft eine Vorstellung, die er als 21-Jähriger im Café de la
Régence in Paris, das damals das Mekka aller Schachspieler auf der Welt war,
gab. Er spielte acht Partien simultan ohne Ansicht des Brettes gegen starke
Gegner, die außerdem reichlich beratende Unterstützung durch eine anwesende
Menge sachkundiger Spieler erfuhren. Es dauerte sieben Stunden bis der erste von
ihnen besiegt wurde und der Wettkampf selbst dauerte zehn Stunden, während derer
MORPHY auf jeglichen Imbiß und sogar auf Wasser verzichtete. Zum Ende gab es
einen Vorfall schrecklicher Aufregung, als MORPHY größte Mühe hatte, sich der
Ovationen in den Straßen zu entledigen und ins Hotel zu flüchten. Dort schlief
er dann gut, aber um sieben Uhr morgens rief er seinen Sekretär, diktierte ihm
alle Züge jeder gespielten Partien und erörterte mit ihm mögliche Folgen
Hunderter hypothetischer Varianten. Man wird zustimmen müssen, daß bloß ein
Verstand, der mit außerordentlicher Leichtigkeit arbeitet, befähigt ist, eine
solch erstaunliche Leistung zu vollbringen. Dies war auch keineswegs eine
isolierte Leistung, die durch übermäßige Erregung veranlaßt worden wäre. Es gibt
nur wenige derart erschöpfende Beschäftigungen über Schach hinaus, und die
Anzahl derer, die sich drei oder vier Stunden lang konzentrieren können, ohne
die Belastung zu spüren, ist nicht sehr groß. Jedoch, von MORPHY ist bekannt,
daß er ununterbrochen von neun Uhr morgens bis Mitternacht an vielen
aufeinanderfolgenden Tagen spielte, wobei sein Spiel nicht im mindesten
schwächer wurde und er keinerlei Anzeichen von Müdigkeit zeigte. In Begriffen
der Psychoanalyse deutet dies auf eine besonders außergewöhnliche Stufe der
Sublimierung hin, denn eine psychologische Situation die einen solchen
Freiheitsraum ermöglicht, kann nur dann eintreten, wenn keine Gefahr für einen
unbewußten Konflikt oder ein Schuldgefühl besteht.
Es ist nicht
leicht, MORPHYS Qualitäten als Schachspieler in anderen als allgemeinen Worten
zu beschreiben, wenn man keine Kenntnis der Schachtechnik voraussetzen möchte.
Ich hoffe, daß die Verallgemeinerungen, die ich im weiteren wagen werde, in
bestimmten Maße als zuverlässig angenommen werden; wir besitzen zu allen
Ereignissen reichlich Daten, zu denen wir Verallgemeinerungen machen können,
denn es haben sich etwa 400 Partien MORPHYS erhalten, und eine ausgedehnte
Literatur, in der nachfolgende Autoritäten kritische Anmerkungen zu den
einzelnen Zügen machten, ist erwachsen.
Vorab sei
mitgeteilt, daß es verschiedene Schachstile gibt, die teils vom Temperament und
Ziel des Spielers abhängen und teils von den Bedingungen unter denen er spielt.
Um es etwas gröber auszudrücken: Es hängt davon ab, ob jemand mehr Wert aufs
Gewinnenwollen oder aufs Verlustvermeiden legt. In Turnieren beispielsweise, bei
denen Niederlagen schwer bestraft werden, kann es sich auszahlen, auf wenige
Siege und viele Remisen zu spielen als auf mehr Siege, aber gleichzeitig auf das
Risiko mehrer Niederlagen einzugehen. Diese beiden Extreme sind vertreten durch
einen vernichtenden aber riskanten Angriff einerseits und ein ermüdendes,
passives Einmauern andererseits. Natürlich vereint der ideale Spieler das
jeweils Beste beider Haltungen in sich. Eine zeitlang stärkt er seine Kräfte,
weniger aus defensiven Erwägungen, sondern vielmehr um in die stärkste
Aufstellung zu gelangen, die ihm Angriff verspricht. Ein Spieler mag in beiden
Aktivitäten auf der Höhe sein, die Stärkung seiner Position mag aber auch bloß
defensiven Charakter haben, dann wird jede Möglichkeit zum Angriff eher als
purer Zufall auftreten. Im Schach gibt es – wenn wir das gegenwärtige
„hyper-moderne“ Spiel beiseite lassen – zwei wohlbekannte Stile, bekannt als das
kombinatorische und das positionelle Spiel, die von manchen auch als
übereinstimmend mit dem romantischen und klassischen Temperament bezeichnet
werden. In dem Zeitabschnitt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, etwa der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts, gab es bloß das erstgenannte, das letztgenannte
ist tatsächlich erst das Produkt der letzten 50 Jahre. Der Hauptunterschied
zwischen diesen beiden Methoden, zumindest in ihren ausgeprägtesten Formen,
könnte veranschaulicht werden anhand der Gegenüberstellung eines geschickt
vorgetragenen Angriffs in einer Schlacht und einer langwierigen Belagerung. Das
Ziel der kombinatorischen Methode ist es, eine fachkundige Gruppierung seiner
Figuren zu finden, die einen wohlgeordneten Angriff auf den gegnerischen König
erlaubt, während das der positionellen Methode ein mehr vorsichtiges – letztlich
aber vernünftigeres – ist: nämlich das stufenweise Aufbauen einer sicheren
Stellung und das Ausnutzen der leisesten Schwäche in der gegnerischen Stellung,
wo auch immer diese auftreten mag.
Zweifellos besaß MORPHY in höchstem Maße die Gaben, die einen Meister des
kombinatorischen Spiels auszeichnen, nämlich Voraussicht, Rechenkraft und die
Fähigkeit, die gegnerischen Absichten zu erraten. Einige seiner Partien sind in
dieser Hinsicht Meisterwerke, denen nur selten gleich getan werden konnte, und
tatsächlich ist der weitverbreitete Eindruck unter Schachspielern der, daß er
einen ausgeprägt stürmischen Angriffsstil hatte. Gewiß würde man nun erwarten,
daß jemand, der über solche Gaben verfügte und dessen Leistungen sich bereits in
einem derart jungen Alter einstellten, seine Erfolge einem ungewöhnlichen Genie
mit ausgeprägten Qualitäten hinsichtlich Intuition und Abenteuerlust, die die
Jugend stets anspricht, verdanke. Allerdings ist es nun eine interessante
Tatsache, und zwar eine, die helles Licht auf die Psychologie MORPHYS wirft, daß
er weit über diesen Stil hinausgriff, und faktisch als der Pionier des
positionellen Stils rangiert, obwohl es STEINITZ war, der später als erster die
Prinzipien desselben entwickelte. Es war ein glücklicher Zufall, daß der einzige
Spieler in der Geschichte, der MORPHYS Genie im kombinatorischen Spiel
gleichkommen konnte, auf der Höhe seiner Karriere war als er sich MORPHY zum
Kampf stellte: ANDERSSEN, der bis dahin als bester Spieler der Welt und damit
praktisch als Weltmeister galt, obwohl dieser Titel formal erst eine Dekade
später eingeführt wurde. Über die beiden Männer sagt MURRAY: „Beides sind
Spieler mit seltener Phantasie, ihrem Spiel kam niemand gleich an brillantem
Stil, Schönheit der Ideen und Tiefe der Anlage. In MORPHYS Fall glänzten diese
Fähigkeiten als Folge seiner bloßen Genialität auf, bei ANDERSSEN als Resultat
langer Praxis und Studien.“ In seinem Buch Die
neuen Ideen im Schachspiel
erklärte RÉTI
in erhellender Weise, daß MORPHYS
Sieg über ANDERSSEN
weniger dank größerer Brillanz im eben erwähnten Sinne zustande kam, sondern
dank dessen, daß er seine Methode der Brillanz auf die Grundlagen reiferen
positionellen Spiels stellte. Es muß eine bemerkenswerte Szene gewesen sein zu
beobachten, wie dieser schlanke Jüngling den großen, stämmigen, in seinen
Vierzigern stehenden Teutonen durch reiferes und tieferes Verstehen besiegte und
nicht in der traditionellen Weise des jungen Helden, der einen Giganten mittels
kühner Phantasie übermannte, denn gerade in dieser Hinsicht waren sich die
beiden ebenbürtig und unübertrefflich. Das Interesse an dieser Beobachtung liegt
für unseren Zweck darin, daß sie ein Anzeichen dafür liefert, daß Schach in MORPHYS
Verständnis eine reine Erwachsenenbeschäftigung sein müsse und der erzielte
Erfolg nur die Folge der ernsthaften Beschäftigung eines erwachsenen Mannes und
nicht des aufmüpfigen Ehrgeizes eines Jungen sein könne. Ich werde später noch
erwähnen, daß die Erschütterung, die er in dieser Auffassung erfuhr, einer der
Faktoren war, die zu seiner mentalen Katastrophe führten.
MORPHY
war in so hohem Maße Meister in allen Aspekten des Spiels und so frei von
Eigenheiten und individuellen Besonderheiten in seinem Stil, daß es nicht
einfach ist, eine besondere Charakteristik herauszustellen. Es ist in der Tat
wahr, daß Schach, wie alle Spiele, übersättigt ist mit unbewußtem Symbolismus.
Man könnte beispielsweise die Geschicklichkeit kommentieren, die er in Angriffen
von hinten auf den König zeigte, oder im Separieren des gegnerischen
Königspaars; letzteres ist, nebenbei erwähnt, illustriert durch die überhaupt
erste seiner aufgezeichneten Partien, die er gegen seinen Vater spielte. Aber
solche Details sind für unsere Zwecke belanglos, denn schachliche Überlegenheit
beruht eher auf der Synthese außerordentlicher Fähigkeiten als auf dem Geschick
in irgendeiner besonderen List oder Methode. Sorgfältige Erwägung des Gesamten
von MORPHYS
Spielweise führt, wie ich glaube, zu der unbestreitbaren Schlußfolgerung, daß
ihr herausragendes Charakteristikum eine geradezu unglaubliche höchste
Zuversicht war. Er wußte, als ob dies das natürlichste und einfachste wäre,
daß er zum Siegen verpflichtet war und handelte aufs ruhigste entsprechend
diesem Wissen. Als die Amerikaner, die ihn spielen sahen, prophezeiten, daß er
(in gleicher Weise wie ANDREA
DEL
SARTO
zu RAPHAEL
sagte) ihnen „den Schweiß auf die Stirn beschert“, höhnten die europäischen
Spieler und sahen in diesen Ankündigungen bloß gewöhnliches amerikanisches
Geschwätz und die einzige Frage, die ihren Sinn beschäftigte war, ob es die
Sache wert sei, ihre Spitzenspieler gegen diesen Jugendlichen antreten zu
lassen. Für jeden, der weiß wieviel eifrige Betätigung und Erfahrung
erforderlich sind um zu einem gewissen Spielstärkegrad im Schach zu gelangen,
könnte nichts vollkommen unwahrscheinlicher sein als daß ein Anfänger, und dies
war PAUL
MORPHY,
der sich auf diesen mühseligen Pfad begab, eine derartige Karriere in Europa
haben könnte, wie sie es schließlich wurde. In aller Gelassenheit und
unerschütterlicher Zuversicht kündigte er seine künftigen Siege vor der Abfahrt
aus seiner Heimatstadt sogar an. Solche Anmaßung könnte begründeterweise als
Größenwahn ausgelegt werden, wenn nicht die heikle Tatsache bestehen würde, daß
dies vollkommen begründet war. Nach hause zurückgekehrt, weit entfernt von
Stolzesröte, bemerkte er, keineswegs so Ordentliches geleistet zu haben, wie er
eigentlich sollte; in gewissem Sinne traf dies auch durchaus zu: Als er einige
Male trotz Erkrankung spielte, machte er sich einiger schwacher Züge schuldig,
die unter seinem normalen Niveau lagen, was ihn sogar einige Partien zu kosten
kam. Es überrascht nicht, daß sein Spiel, ausgestattet mit solchem
Selbstvertrauen in seine Stärke, gekennzeichnet war durch Mut und sogar
Dreistigkeit in seinen Zügen, sodaß sich zunächst der Eindruck von übertriebener
Abenteuerlust einstellte, vielleicht sogar von riskantem Wagemut, ehe dann die
Sicherheit in seiner Berechnung wahrnehmbar wurde. Seine Furchtlosigkeit war
natürlich bestechender, wenn er es mit relativ schwächeren Spielern zu tun
bekam. Hier konnte er mir sichtbarer Rücksichtslosigkeit vorgehen,
verschwenderisch eine Figur nach der anderen wegschleudern, bis dann in einer
unerwarteten Wendung seine ihm verbliebene kleine Armee plötzlich den coup de
grâce gewann; bei einer solchen Gelegenheit gelang ihm einmal die
außerordentliche Leistung, mit der Ausführung der Rochade matt zu setzen. Seine
Kühnheit und sein Verständnis für die Wichtigkeit des Positionsgefühls beim
Schachspiel äußern sich auch in zwei weiteren wohlbekannten Charakteristiken
seiner: seine Hochschätzung der frühzeitigen und kontinuierlichen
Figurenentwicklung und seine Bereitschaft zu Opfern für eine bessere
Figurenstellung. Es gibt eine Geschichte, vielleicht unecht, die besagt, daß er
als Kind so bemüht gewesen sei, seine Figuren vorwärts zu bringen, daß er die
Bauern als ein Ärgernis empfand, das er so schnell wie möglich zu beseitigen
trachtete: was für ein Unterschied doch zum großen PHILIDOR,
der in den Bauern die Seele des Schachs sah! Es ist unter allen Umständen recht
passend, daß mit dem Namen ‚MORPHY-Eröffnung’
im Schach folgender Plan getauft wurde: Was als MUZIO-Eröffnung
bezeichnet wird, ist charakterisiert durch einen kühnen Angriff, in dem ein
Springer im fünften Zuge geopfert wird um einen Positionsvorteil als
Kompensation zu erhalten. In der MORPHY-Eröffnung
folgt Weiß ebenfalls zunächst dieser Taktik, opfert aber außerdem noch einen
Läufer, so daß diese Eröffnung auch manchmal als ‚Doppel-MUZIO’
bezeichnet wird.
Es sind nur sehr wenige Menschen zu finden, die über genügend Selbstvertrauen in
ihre Angriffskunst verfügen um direkt zu Beginn so große Materialopfer zu wagen.
Sogar die nach ihm benannte Verteidigung, die MORPHY-Verteidigung
der Spanischen Partie,
eine so nützliche, daß sie in über zwanzig mit Namen versehene Varianten
ausgearbeitet worden ist, ist die aggressivste der zahlreichen Verteidigungen in
dieser Eröffnung.
Das Schachgefühl, falls man diesen Begriff gebrauchen möchte,
war MORPHY
weit mehr angeboren als anerzogen. Er las eine ganze Mange, gab aber nach der
Lektüre jedes Buch sofort zurück. Er sagte selbst, daß kein Autor für ihn von
Wichtigkeit war und daß er „erstaunt war, zu sehen, daß einige Positionen und
Lösungen als neuartig angegeben wurden (bestimmte Züge, die zu bestimmten
Ergebnissen führen, etc.), da er selbst längst die gleichen Schlußfolgerungen
gezogen hatte, allerdings als notwendige Konsequenzen“ (EDGE).
MACDONNELL,
der sein Spiel in London sah, schrieb später darüber in seinen Schach
Lebens-Bildern (Chess Life-Pictures): „Ich sah mit Lust, wie er
jedesmal den richtigen Zug augenblicklich erkannte und bloß darum abwartete um
teils dem Gegner Respekt zu erweisen, teils um sich seiner Korrektheit zu
versichern, sich sozusagen doppelt zu versichern und sich selbst daran zu
gewöhnen, unter allen Umständen eine ernsthafte Haltung zu wahren.“ Die folgende
Geschichte legt die eigentliche Frage nach der Methode dar, mittels welcher
geistige Berechnung überhaupt vonstatten geht. Im berühmten 17. Zug seiner
Vierspringerspiel-Partie gegen PAULSEN
am 8. November 1857 bot MORPHY
seine Dame zum Tausch gegen den Läufer seines Gegners an. Natürlich argwöhnte PAULSEN
eine Falle und nahm aufs sorgfältigste alle Möglichkeiten in Augenschein.
Nachdem er über eine Stunde über der Stellung gegrübelt hatte und keine Falle
entdeckte, nahm er das Opfer an und wurde elf Züge später zur Aufgabe gezwungen.
Jahre später fertigte STEINITZ
eine komplette Analyse der Position an und schloß, daß die Möglichkeiten, die
dem Opfer folgten, zu zahlreich und zu kompliziert gewesen wären, als daß ein
menschliches Gehirn in der Lage wäre, diese abzusehen. Es fragte übrigens einer
der Zuschauer MORPHY
sofort nach der Partie, ob er vom besagten Zug bis zum Ende hatte durchrechnen
können; auf seine Frage bekam er folgende rätselhafte Antwort: „Ich wußte, daß
es PAULSEN
eine Menge Probleme bereiten würde.“ Zweifellos hatte STEINITZ
in seinen
Schlußfolgerungen
recht, soweit das Bewußtsein
angesprochen ist, aber man muß sich fragen dürfen, ob das sogenannte intuitive
Schach nicht eine besondere vor-bewußte Rechenkraft voraussetzt. Die
Experimente, die MILNE
BRAMWELL
ausführte,
belegen, daß die unbewußte Kapazität für arithmetische Berechnungen, durch
Hypnose getestet, bei weitem die bewußte Kapazität übertrifft, und dasselbe mag
sehr gut auch auf das Berechnen von Schachzügen zutreffen.
Wir dürfen nun
annehmen, daß diese bemerkenswerte Verquickung von Können und Selbstvertrauen
nichts anderes als ein direkter Vertreter der Hauptströmung der Libido war, dazu
bestimmt, die besten Lösungen aller Konflikte, auch im tiefsten Verlauf der
Persönlichkeit, zu finden. Es bleibt nun zu folgern, daß jede Störung einer so
unabdingbaren Ausdrucksmöglichkeit der Persönlichkeit Veranlassung geben würde,
seine Integrität in große Gefahr zu bringen; und dies belegten auch in der Tat
die Ereignisse. Unsere Kenntnis der unbewußten Motive des Schachspielens sagt
uns, daß das einzige was es repräsentiert, der Wunsch ist, den Vater in einer
akzeptablen Weise zu überwältigen. Für MORPHY gab es drei essentielle
Bedingungen, die notwendig waren um diese Akzeptierbarkeit zu schaffen: daß
besagte Tat in freundschaftlicher Weise angenommen wird; daß sie ehrenwerten
Motiven zugeschrieben wird und daß sie angesehen wird als eine ernsthafte
Beschäftigung Erwachsener. Wir werden sehen, daß jede dieser Bedingungen auf
heftigste verletzt wurde während seines schicksalhaften Besuchs in Europa, und
wir werden versuchen, die seelischen Folgen aufzuspüren. Zweifellos ist es
bedeutsam, daß MORPHYS erhebende Odyssee in die höheren Reiche des Schachs
gerade ein Jahr nach dem – unerwartet plötzlichen – Tod seines Vaters begann,
welcher ein großer Schock für ihn gewesen ist. Wir möchten vermuten, daß seine
glänzende Sublimierungsleistung, ähnlich SHAKESPEARES Hamlet und FREUDS
Traumdeutung,
eine Reaktion auf dieses kritische Ereignis war.
Ich werde jetzt
die kritische Phase in MORPHYS Leben detaillierter ins Auge fassen und sehe mich
als erstes dazu genötigt, diejenigen unter Ihnen, die mit der Schachgeschichte
nicht vertraut sind, in Kenntnis über einige der führenden Persönlichkeiten
jener Zeit zu setzen. In diesem Zusammenhang sind sechs Personen zu erwähnen:
vier von ihnen wurden freundschaftliche Bewunderer MORPHYS, die beiden anderen
bereiteten ihm ein psychologisches Problem, dem er nicht gerecht wurde.
Der zeitlich
erste in dieser Reihe war LOEWENTHAL, mit dem MORPHY bereits erfolgreich spielte
als er noch ein Kind war. LOEWENTHAL machte weitere Fortschritte seitdem und
gewann auf dem Birminghamer Turnier, das während MORPHYS Englandbesuch
vonstatten ging – an dem MORPHY aber nicht teilnahm –, den ersten Preis, obwohl
auch STAUNTON und SAINT-AMANT unter den Teilnehmern waren. In einem Wettkampf,
den man zwischen den beiden arrangierte, schlug MORPHY ihn deutlich und
LOEWENTHAL wurde ein verläßlicher Freund und Bewunderer, der in der
unglücklichen Kontroverse, von der jetzt die Rede sein wird, auf seiner Seite
stand. Er sagte vorher, daß die Schachwelt MORPHY, sobald seine Partien im Druck
vorliegen würden – eine Aufgabe, die LOEWENTHAL später selbst erfolgreich
besorgte –, ihn als den besten aller lebenden und nicht mehr lebenden
Schachspieler ansehen würde. Die Einsätze im LOEWENTHAL-Match betrugen je 100 ₤
von beiden Seiten. Nachdem er gewonnen hatte, beschenkte MORPHY LOEWENTHAL, der
gerade ein neues Haus bezog, mit einer Möbeleinrichtung im Werte von 120 ₤. Wir
werden noch wiederholt sehen, wie penibel MORPHY alle Belange des Geldes nahm.
Bevor er Amerika verlassen hatte, bot ihm der Schachklub von New Orleans an, ihm
durch eine Geldspende die Teilnahme am Birminghamer Turnier zu ermöglichen, was
er aber mit der Begründung, kein Berufsspieler zu sein, ablehnte. Als nächstes
kommt PAULSEN, ein Amerikaner, damals berühmt für seine staunenswerten
Blindsimultanvorstellungen und später für zwei Wettkampsiege über ANDERSSEN,
sowie für seine wichtigen Beiträge zur Schachtheorie. Er war MORPHYS einziger
ernsthafter Konkurrent beim New Yorker Turnier und, nach Durchsicht einer Reihe
seiner publizierten Partien, prophezeite er daß MORPHY ihn schlagen würde; kurz
vor dem Turnier spielten sie drei Blindpartien, von denen MORPHY zwei gewann und
eine remisierte. PAULSEN wurde gleichfalls ein ergebener Freund MORPHYS.
SAINT-AMANT war der damals führende Spieler Frankreichs. Er spielte keine
Einzelpartie gegen MORPHY, verlor aber fünf und remisierte zwei von sieben
Konsultationspartien gegen ihn. Auch er wurde ein glühender Bewunderer und sagte
über sein Blindspiel, es ließe die Gebeine PHILIDORS und LA BOURDONNAIS’ in
ihren Gräbern klappern, zweifellos das schönste Kompliment das ein Franzose
machen konnte. Dem genialen ANDERSSEN sind wir bereits begegnet. Er war der
beste lebende Spieler und wurde allgemein als Weltmeister angesehen, bis er
einige Jahre später von STEINITZ besiegt wurde; er errang an allen zwölf
Turnieren, an denen er teilnahm, einen Preis und wurde erster in sieben von
ihnen. MONGREDIEN, der Präsident des Londoner Schachklubs, sagte über ihn, er
sei „ – ausgenommen MORPHY – der geistvollste und ritterlichste Spieler, dem ich
jemals begegnete“, und die Art und Weise in der er mit MORPHY Umgang pflegte,
bestätigt diese Einschätzung. Obwohl seine Kollegen den größtmöglichen Druck auf
ihn ausübten und versuchten, ihn daran zu hindern, sein deutsches Prestige in
die Waagschale zu werfen und im Ausland gegen einen Jüngling anzutreten, der
über keinerlei öffentliches Ansehen verfügte, und trotzdem er keine Gelegenheit
hatte, sich vorher einzuspielen, suchte ANDERSSEN keinerlei Ausflüchte sondern
reiste nach Paris um sein Schicksal aus MORPHYS Händen zu empfangen. Als man ihn
hinterher dafür tadelte, daß er nicht so brillant spielte wie in seiner
berühmten Partie gegen DUFRESNE, gab er die selbstlose Antwort: „MORPHY ließ
mich nicht.“
MORPHYS
Verhältnis zu diesen vier Männern kontrastierte aufs traurigste mit den
Erfahrungen, die er mit den beiden machte, die uns nun interessieren. Der
wichtigere dieser beiden war STAUNTON, und um seine Bedeutung für MORPHY zu
ermessen, ist es nötig, ein Wort über die Position zu verlieren, die er einnahm.
Er war ein Mann mit weit höherem Ansehen, als es seine Turnierergebnisse
annehmen lassen würden. Es ist zwar richtig, daß er nach seinen Siegen über
SAINT-AMANT, HORWITZ und HARRWITZ in den Vierzigern, sich als den führenden
Spieler in der Welt betrachten durfte, doch er war nicht in der Lage, diese
Position zu halten; so wurde er, beispielsweise, bei den Turnieren London 1851
und Birmingham 1858 geschlagen. Er war allerdings ein großer Analytiker; sein
Standard-Lehrbuch zusammen mit seiner Position als einem der ersten
Schachherausgeber, machten ihn zum Wortführer der englischen, wenn nicht gar der
europäischen Schachwelt. In der Mitte des letzten Jahrhunderts war England die
bei weitem führende Nation im Schach, und dies trug wohl zu den Gründen bei, die
MORPHY veranlaßten, in STAUNTON den am meisten gewünschten Gegner zu sehen; es
war der Wunsch mit STAUNTON zu spielen, der sein Hauptmotiv für die Überquerung
des Atlantiks ausmachte. In psychoanalytischer Sprache würden wir hier davon
sprechen wollen, daß STAUNTON das herausragende Vater-Imago
darstellte und daß für MORPHY ein Sieg über ihn einem Testfall seiner eigenen
Schachfähigkeit gleichkam, und unbewußt noch manchem anderen nebenbei. Ein
Beweisstück existiert noch, welches zeigt, wie wenig rezent seine Wahl des
Vater-Imagos gewesen ist. Im Alter von 15 Jahren wurde MORPHY mit einer
Ausgabe der Partiensammlung vom Internationalen Turnier 1851, dessen Sekretär
STAUNTON gewesen war, beschenkt. Eigenhändig schrieb er auf die Titelseite: „Von
Herrn H. STAUNTON, dem Autor des Schachhandbuchs, Chess-Player’s
Companion, etc. (und einigen verteufelt schlechten Partien)“. Nach MORPHYS
Sieg im New Yorker Turnier debattierten einige Enthusiasten über die
Möglichkeit, daß ein europäischer Schachmeister nach Amerika käme um mit ihm zu
spielen. Als STAUNTON davon erfuhr, publizierte er einen mißbilligenden Absatz
in seiner wöchentlichen Schachkolumne, anmerkend, daß „die besten Schachspieler
in Europa keine Schachprofis sind und anderen, ernsthafteren Berufen nachgehen.“
Die Andeutung, MORPHYS Schach sei entweder ein jugendlicher Zeitvertreib oder
ein Mittel zum Gelderwerb waren beides Unterstellungen die ihn sofort verletzt
haben müssen, da es genügend Belege für seine krankhafte Verletzbarkeit
bezüglich beider Anspielungen gibt. Seine Freunde in New Orleans haben
nichtsdestotrotz eine Herausforderung an STAUNTON gesandt – er möge nach Amerika
kommen –, die er, nicht unerwartet, ablehnte, aber nebenbei, in einer leicht
deutbaren Andeutung bemerkte, daß er im Falle eines Kommens MORPHYS nach Europa
zur Verfügung stehe. Vier Monate später überquerte MORPHY den Atlantik und
wollte, unmittelbar nachdem ihm STAUNTON vorgestellt worden ist, eine Partie mit
ihm spielen. STAUNTON schützte eine Verpflichtung vor und ließ ein derart
unhöfliches Benehmen folgen, welches bloß mit Begriffen aus der
Neurosenforschung erklärbar ist; tatsächlich sagte man ihm nach, er leide an
etwas ähnlichem wie „nervöser Reizbarkeit“. Drei Monate lang, während seines
Aufenthaltes in England und danach, bemühte sich MORPHY, in würdevollster Weise,
um einen Wettkampf, worauf STAUNTON stets mit einer Reihe von Ausflüchten,
Aufschüben, gebrochenen Versprechungen und Ausreden von der Art antwortete, daß
sein Gehirn „zu sehr mit wichtigeren Verpflichtungen in Anspruch genommen ist“ –
was ihn freilich nicht hinderte, sich am Birminghamer Turnier zu beteiligen, das
im gleichen Monat stattfand. Enttäuscht in seinen Hoffnungen, legte MORPHY den
gesamten Sachverhalt Lord LYTTELTON, dem Präsidenten des Britischen
Schachverbandes, vor, worauf dieser sein Verständnis aussprach; und die Sache
bleib darauf beruhen. Inzwischen fuhr STAUNTON in seiner Schachkolumne damit
fort, ein Feuer der Kritik an dem Mann, dem er beständig aus dem Weg ging, zu
entfachen: er mißbilligte sein Spiel, machte Andeutungen, er sei ein
Geldabenteurer und dergleichen. Ein Satz aus MORPHYS letztem Brief an ihn sollte
zitiert werden: „Erlauben Sie mir zu wiederholen was ich schon zahllose Male in
jeder Schachgesellschaft, die mir die Ehre erwies, ihr beitreten zu dürfen,
sagte: daß ich kein professioneller Spieler bin und daß ich niemals wünschte,
aus den Fähigkeiten, die mir eigen sind ein Mittel zu pekuniärer Verbesserung zu
machen.“
Diese ganze Episode führte zu einem erbitterten Streit in der Schachwelt, in der
die große Mehrheit MORPHY unterstützte, und die nachfolgende Ansicht war
einstimmig die, daß STAUNTONS Benehmen seiner nicht wert wäre. Die Wirkung auf
MORPHY zeigte sich unmittelbar als ein starker Abscheu gegenüber dem Schach. Wie
SERGEANT, MORPHYS letzter und bester Biograph schreibt, wurde „MORPHY krank von
den Schachtaktiken – denen außerhalb des Brettes. Ist dies verwunderlich?“
Gegen Ende
dieser Episode setzte MORPHY über nach Paris, wo er sofort auf HARRWITZ, le
roi de la Régence, zuging. Auch dieser Gentleman steht in keinem
freundlichen Licht in seinen Beziehungen zu MORPHY, die gekennzeichnet waren
durch krankhafte Eitelkeit und das Fehlen von Ritterlichkeit (SERGEANT). Wir
brauchen nicht auf die erbärmlichen Einzelheiten, die in ihrer Vollständigkeit
von EDGE geschildert wurden, einzugehen, aber der Ausgang war, daß HARRWITZ sich
aus dem Wettkampf zurückzog nachdem er entscheidend zurücklag. Zunächst weigerte
sich MORPHY die Gewinnsumme, 290 Francs, zu akzeptieren, nahm sie aber doch an,
nachdem ihm nahegelegt wurde, daß verschiedene Leute Geld verlieren würden,
falls sein Sieg nicht in dieser Weise offiziell besiegelt worden ist, um die
Summe dann zur Deckung der Reisekosten ANDERSSENS nach Paris zu verwenden.
MORPHYS Neurose steigerte sich hiernach und wurde bloß zeitweise unterbrochen
durch die angenehme Episode des Wettkampfs mit ANDERSSEN, in dem ein letztes
Aufflackern seines Schachfiebers zu sehen war.
Etwas sollte
nun gesagt werden über die Aufnahme, die MORPHYS Erfolge fanden, denn sie war
von einer solchen Art, daß die Frage auftaucht, ob sein späterer Zusammenbruch
nicht beeinflußt war durch seine Zugehörigkeit zu dem Typ, den FREUD beschrieben
hat als Die am Erfolge scheitern. Ich erwähnte bereits die Szene im Café
de la Régence als MORPHY die Gelegenheit wahrnahm und in einer brillanten
tour de force acht starke Spieler in einem Blindsimultan besiegte; es ging
derart turbulent zu, daß Soldaten in der Annahme hinzurannten, eine neue
Revolution breche aus. MORPHY wurde zum Löwen der Pariser Gesellschaft, wurde
überallhin eingeladen, erlaubte sich die Höflichkeit, von Herzoginnen und
Prinzessinnen besiegt zu werden und verließ schließlich Frankreich aufs
prächtigste ruhmbedeckt. Der Höhepunkt war ein Festbankett auf dem ihm seine
Büste, angefertigt von einem berühmten Bildhauer, bekrönt mit einem
Lorbeerkranz, überreicht wurde. Die Aufnahme bei seiner Rückkehr in New York, wo
sich patriotische Leidenschaft mit anderen Enthusiasmen mischte, kann man sich
bestens vorstellen. Allerorten spürte man, daß dieses das erste Mal in der
Geschichte war, daß ein Amerikaner sich als nicht bloß ebenbürtig, sondern sogar
allen Vertretern seines Fachs, das man von den alten Ländern übernahm, als
überlegen erwies; so trug also auch MORPHY eine Elle zur Gestalt der
Amerikanischen Zivilisation bei. Während seiner Anwesenheit bei einer großen
Ansprache in der Kapelle der Universität wurde er mit einer Ehrengabe, bestehend
aus einem Schachbrett mit Feldern aus Perlmutt und Ebenholz und Figuren aus Gold
und Silber, beschenkt; ebenso erhielt er eine Golduhr, deren Ziffern ersetzt
wurden durch farbige Schachfiguren. Ein Zwischenfall, der sich bei dieser
Überreichung ereignete, sei erwähnt, da er MORPHYS Empfindlichkeit
veranschaulicht. Oberst MEAD, der Vorsitzende des Empfangskomitees, sprach in
seiner Rede von Schach als Beruf und wies auf MORPHY als seinen geistvollsten
Vertreter hin. „MORPHY legte nun dagegen, als Berufsspieler – auch bloß implizit
– charakterisiert zu werden, Einspruch ein und er tat dies in so verärgerter
Weise, daß Oberst MEAD in große Bestürzung geriet. Seine Kränkung, ihm zugefügt
zu einer so unpassenden Gelegenheit, war dermaßen groß, daß Oberst MEAD seine
weitere Mitarbeit an der Veranstaltung zu MORPHYS Ehren einstellte“ (BUCK). Im
Union Club von New York wurde er mit einem silbernen Lorbeerkranz beschenkt.
Darauf reiste er nach Boston, wo ihm zu Ehren ein Bankett organisiert wurde, an
dem, unter anderen, AGASSIZ,
OLIVER WENDELL HOLMES,
LONGFELLOW
und LOWELL
anwesend waren; in einer Rede während dieses Banketts machte QUINCEY die witzige
Bemerkung: „MORPHY ist großartiger als CAESAR, denn er kam und siegte ohne zu
sehen.“ Kurz darauf wurde er mit einer goldenen Krone in Boston beschenkt.
Schmeichelei
solchen Ausmaßes, ausgegossen auf einen jungen Mann von 21 Jahren, hat
unvermeidlich zur Folge, daß seine psychische Fassungskraft einer enormen
Belastung ausgesetzt wird; und man darf sich hier die Frage stellen, ob dies
nicht auch eine Rolle spielte bei der Tragödie die dem folgte. In diesem
Zusammenhang möchte ich nun eine interessante Stelle aus der Trauerrede
zitieren, die Jahre später von MORPHYS Jugendfreund MAURIAN gehalten wurde.
MAURIAN schreibt den Abscheu gegenüber Schach – welchen er, nebenbei angemerkt,
in keine Verbindung setzt zu der folgenden Geistesstörung – der Vollständigkeit
der MORPHYSCHEN Erfolge zu, doch in ganz umgekehrtem Sinne, wie wir ihn gerade
angaben. Er schreibt: „PAUL MORPHY war niemals so leidenschaftlich versessen, so
übermäßig dem Schach ergeben, wie es allgemein geglaubt wird. Eine
vertrauensvolle Bekanntschaft und lange Beobachtung versetzt uns in die Lage,
dies förmlich festzustellen. Seine einzige Hingabe an das Spiel, wenn man dies
so ausdrücken darf, lag in seinem Ehrgeiz, den besten Spielern und großen
Meistern dieses Landes und Europas zu begegnen und sie zu schlagen. Er fühlte
seine enorme Stärke und er zweifelte keinen Moment über den Ausgang.
Tatsächlich sagte er uns, im Privaten und in bescheidener Form, dennoch mit der
gewißesten Zuversicht, vor seiner ersten Reise nach Europa seinen sicheren
Erfolg voraus. Als er dann zurückgekehrt war, drückte er die Überzeugung aus, er
hätte schwach und voreilig gespielt – daß es keinem seiner Gegner so gut hätte
ergehen dürfen, wie es tatsächlich geschah. Aber nachdem dieser eine Ehrgeiz
gestillt wurde, schien er das Interesse an dem Spiel verloren zu haben.“
Bevor ich den
Versuch wage, die soeben aufgetauchte Frage zu beantworten, halte ich es für das
beste, die Geschichte selbst abzuschließen und etwas über die spätere mentale
Entwicklung zu berichten. In der Absicht, sich dem Rechtsberuf zu widmen, über
den er ein exzellentes Wissen hatte, ließ sich MORPHY in New Orleans nieder. Ihm
wurde begreiflich, daß sein ihm nun unwillkommener Ruhm als Schachspieler die
Leute davon abhielt, ihn als Juristen ernst zu nehmen, und diese Ungerechtigkeit
setzte seiner psychischen Verfaßtheit stark zu. BUCK, der bei seiner
Zusammenstellung der Geschichte der späten Jahre MORPHYS die Unterstützung von
dessen Verwandten hatte, gibt an, daß „er sich in eine wohlhabende und
attraktive junge Dame in New Orleans verliebt hatte und daraufhin einen
gemeinsamen Freund informierte, der diesen Punkt auch bei der Dame zur Sprache
brachte; aber sie höhnte über die Idee, ‚einen bloßen Schachspieler’ zu
heiraten“.
Etwa ein oder
zwei Jahre nachdem er sich in dem was er für seinen ernsthaften dauernden Beruf
hielt, niedergelassen hatte, brach der Bürgerkrieg
aus und MORPHY sah sich mit der Aussicht eines echten Krieges konfrontiert, was
aufs schärfste mit seiner Bemühung kontrastierte, eine friedvolle Beschäftigung
als Ersatz für seinen Zeitvertreib mit Pseudokriegen zu finden.
Seine Reaktion war charakteristisch für einen Menschen, der seine psychische
Stärke durch die Umwandlung feindseliger Absichten in freundliche bezog: er
eilte nach Richmond und ersuchte – inmitten von Feindseligkeiten – eine
diplomatische Lösung. Dies wurde abgelehnt, und bald nach seiner Rückkehr in
seine Heimatstadt New Orleans, wurde diese durch Unionstruppen eingenommen. Die
Familie der MORPHYS flüchtete auf einem spanischen Kriegsschiff nach Kuba, von
dort, über Havanna, nach Cádiz und dann Paris. Er verbrachte ein Jahr in Paris
und fuhr zurück nach Havanna, wo er blieb bis der Krieg beendet war.
Schon zu dieser
Zeit konnte seine psychische Verfassung überhaupt nicht mehr zufriedenstellend
gewesen sein, denn schon ein paar Jahre nach der Rückkehr nach New Orleans
überredete ihn seine Mutter, achtzehn Monate in Paris zu verbringen – seinem
dritten Besuch dort – , in der Hoffnung, daß ein Wechsel der Umgebung ihn
wiederherstellen würde. Seine Aversion gegen Schach war mittlerweile so
vollständig, daß er die Nähe der Orte seiner früheren Triumphe mied.
Lange zuvor
schon erhärteten sich die unmißverständlichen Anzeichen der Paranoia. Er fühlte
sich von Leuten verfolgt, die danach trachteten, sein Leben unerträglich zu
machen. Sein Wahn konzentrierte sich auf den Gatten seiner älteren Schwester,
der Vermögensverwalter des väterlichen Nachlasses war und von dem er glaubte, er
wolle ihn seines Erbteils berauben. Er forderte ihn zum Duell, und strengte
darauf einen Prozeß gegen ihn an, wobei er Jahre damit verbrachte, sich auf
diesen Fall vorzubereiten; vor Gericht wurde schnell ersichtlich, daß die
Anklagen haltlos waren. Er fürchtete außerdem, daß Menschen, besonders sein
Schwager, ihn vergiften wollten und weigerte sich eine zeitlang, Essen aus den
Händen anderer als seiner Mutter oder seiner (jüngeren, unverheirateten)
Schwester anzunehmen. Ein weiterer Wahn war der, daß sein Schwager mit einem
vertrauten Freund, BINDER, konspiriere um seine Kleidungsstücke, auf die er sehr
eingebildet war, zu zerstören und ihn umzubringen; bei einer Gelegenheit rief er
den letztgenannten in dessen Büro und vergriff sich an ihm. Er neigte dazu, den
Gang zu stoppen und auf jedes schöne Gesicht auf der Straße zu starren, was ich
weiblicher Identifikation zuschreiben möchte. Er war ebenfalls ein
leidenschaftlicher Liebhaber von Blumen. Ich werde jetzt eine Angewohnheit aus
dieser Zeit zitieren, auf die ich, warum auch immer, kein Licht werfen kann.
Über einen bestimmten Zeitraum, gemäß einer Aussage seiner Nichte, hatte er die
Manie, die Veranda rauf und runter zu schreiten und dabei folgende Worte zu
deklamieren: „Il plantera la bannière de Castille sur les murs de Madrid au cri
de Ville gagnée, et le petit Roi s’en ira tout penaud“.
Es klingt wie ein Zitat, aber, falls dies zutrifft, bin ich nicht in der Lage es
ausfindig zu machen oder die Anspielung zu erklären. Er hatte die Lebensweise
angenommen, täglich, pünktlich zur Mittagsstunde und aufs feinste herausgeputzt,
einen Spaziergang zu unternehmen. Zurückgekehrt ruhte er bis zum Abend, an dem
er die Oper aufsuchte, dabei keine einzige Aufführung versäumend. Er wollte
niemanden außer seiner Mutter sehen und es versetzte ihn in Ärger, falls seine
Mutter es unternahm, selbst nahe Freunde ins Haus einzuladen. Zwei Jahre vor
seinem Tod wurde er um Mitarbeit an einem geplanten biographischen Werk, das
Berühmtheiten Louisianas, auch sein Leben, enthalten sollte, gebeten. Er
antwortete mit einem entrüsteten Schreiben des Inhalts, daß sein Vater, Richter
ALONZO MORPHY, bei seinem Tode die Summe von 146.162 Dollar und 54 Cent
hinterließ während er selbst keinem Beruf nachgegangen sei und nichts mit
Biographien zu tun hätte. Beständig sprach er vom Vermögen des Vaters und die
bloße Erwähnung des Schachs reichte aus, ihn zu irritieren.
Das Problem,
das wir uns zu Beginn stellten ist: in welcher Beziehung steht MORPHYS
Schachkarriere zu seiner späteren psychischen Störung? SERGEANT bemüht sich
nachzuweisen, daß die bloße Beschäftigung mit Schach nicht verantwortlich sein
kann, und jeder medizinische und psychologische Sachkenner kann diese Ansicht
nur bestätigen. Sein Resümee der Pathogenese der Störung ist so einleuchtend,
daß es eine vollständige Zitierung verdient: „Erstens hatte MORPHY einigen Grund
sich abgestoßen zu fühlen, weniger vom Schach als vielmehr von den
Schachmeistern, deren Charakter sich dermaßen von seinem eigenen unterschied. Er
machte sich auf den Weg, sehr jung, spendabel, übermütig, würdigte, eigenem
Bekunden nach, nicht Ehrgeiz sondern den guten Ruf, traf aber nicht auf
ritterliche Gleichgesinnte sondern auf gewundene Füllfederakrobaten, Verleumder
und Schachgauner. Sicherlich, er traf auch auf sehr ehrbare Herren, solche wie
ANDERSSEN, LOEWENTHAL und die Mehrheit der führenden Amateure in London und
Paris. Aber die Hauptwunden, die die andere Sorte ihm schlug, heilten nicht so
einfach. Zweitens hielt sich MORPHY frei von jeglichem Makel (ob er dies nun zu
recht oder zu unrecht so betrachtete) des Schachprofessionalismus, obwohl er als
ein Berufsspieler angesehen, gar angesprochen, wurde. Und abschließend, MORPHY
war ehrgeizig in dem Beruf, den er sich fürs Leben wählte, und bloß eine
unglückliche Verkettung von Umständen ließ ihn darin versagen und ihn dem Schach
die Schuld dafür geben. Diese enttäuschte Bestrebung war sicherlich der Grund
für MORPHYS unglückliches Schicksal. (...) Eine überempfindliche Natur wie die
seine es war, war nicht dazu imstande, diesen Belastungen zu widerstehen.“ Wie
sehr sich MORPHY bemühte, die ihm zugefügten Wunden vor sich selbst zu verbergen
kann aus der folgenden Passage seiner Rede, gehalten anläßlich seiner Rückkehr
in New York, herausgelesen werden: „Über meine Europareise will ich nur das eine
sagen, daß sie nämlich in nahezu jeder Hinsicht angenehm war. Von allen Gegnern,
denen ich in friedlichen Zweikämpfen auf den schwarzweißen Feldern begegnet bin,
behalte ich eine lebendige und liebenswürdige Erinnerung. Sie begegneten mir
galant, ritterlich und ehrenwert; sie erwiesen sich als wahre Verehrer des
königlichen Spiels.“
Lassen Sie mich das Problem auf eine andere
Weise formulieren. Wurde MORPHYS Geistesstörung durch seine außerordentlichen
Erfolge oder durch sein Versagen und seine Enttäuschung herbeigeführt? War seine
Situation vergleichbar der von BROWNINGS Pictor Ignotus,
dessen Erringung der höchsten Berühmtheit ihn zu folgendem Aufschrei nötigte:
„Der Gedanke wuchs mit Schrecken: ‚Es war so rasend
teuer!’“
Sprach er wie ANDREA
zu sich selbst:
„Allzu heftig wächst das Leben, golden und nicht grau,
und ich bin die schwachsichtige Fledermaus, die die Sonne nicht verlockt
von diesem Gehöft, dessen vier Wände die Welt machen“?
Zog er sich aus der Welt zurück mit diesem schnöden Trost:
„Zumindest verkehrt kein Krämer in meinem Herzen“?
Formuliert in
einer mehr psychoanalytischen Sprache: erschreckte MORPHY sich über seine eigene
Anmaßung nachdem das Licht der Öffentlichkeit auf ihn geworfen wurde? FREUD
machte darauf aufmerksam, daß Menschen, die unter dem Druck zu großen Erfolges
zusammenbrechen, diesen nur in der Vorstellung ertragen können, nicht aber in
der Realität. Den Vater im Traum zu kastrieren ist eine vollkommen andere Sache
als dies in der Realität zu tun. Die reale Situation provoziert die unbewußte
Schuld in ihrer vollen Stärke, und die Strafe kann der geistige Zusammenbruch
sein.
Ich denke
nicht, daß hier eine vollständige Erklärung liegen kann. Wir müssen uns in
Erinnerung rufen, daß MORPHY in seinem dringendsten Ziel nicht erfolgreich war,
sondern versagte. Wir sahen, in welcher Weise STAUNTON für ihn zum Erz-Imago
wurde, aber daß er es nicht fertig brachte ihn ans Brett zu bewegen. Es war
alles in allem sehr gut, sich selbst bewiesen zu haben, daß man der beste
Spieler der Welt war, auch war die Wahrscheinlichkeit, selbst STAUNTON würde
geschlagen worden sein, wohlbegründet. Aber es verbleibt die kalte Tatsache, daß
dieser Erz-Gegner sich ihm entzog. Der schreckliche Vater war nicht bloß
weiterhin auf freiem Fuße, sondern äußerte auch unmißverständliche Zeichen der
Feindschaft. MORPHYS Ziel, mit seiner unterdrückten Feindschaft gegen den Vater
– und der Furcht des Vaters vor ihm – umzugehen, indem er sie in ein
freundschaftliches homosexuelles Verhältnis umwandelte, scheiterte. Die folgende
Überlegung gibt, wie ich glaube, einen Hinweis darauf, daß MORPHY selbst sich
teilweise dieses Versagens bezüglich seines Zieles bewußt war. Als er nach New
York zurückkehrte, erklärte er, gegen keinen Amerikaner mehr spielen zu wollen,
außer mit Vorgabe, und dies war zweifellos durch die gegebenen Umstände
gerechtfertigt. Aber nachdem er, wenige Wochen später, in die Sicherheit seines
Heimes in New Orleans eingekehrt war, sandte er eine Herausforderung an die
Welt, gegen jeden unter Vorgabe von Zug und Bauer spielen zu wollen; der einzige
Fall in seiner gesamten Schachkarriere, in dem er seine Kräfte möglicherweise
überschätzte.
Ich lese dies als einen Hinweis auf psychologische Kompensation für den
eigentlichen Sinn des Versagens, wobei die Angst diese ins Unbewußte verschob.
Es gab
allerdings noch weiteres als dies. Als STAUNTON ihm aus dem Weg ging, tat er
dies auf eine Weise, die einer sensiblen Person, wie es die MORPHYS zweifellos
war, suggerieren mußte, daß bereits seine Absicht ein verwerfliches und
unehrenhaftes Tun war. Wir wissen, daß psychische Stabilität wesentlich auf
moralischer Stabilität beruht, daß psychische Stabilität nur so lange
gewährleistet ist, wie Schuldlosigkeit obwaltet. Es ist unmöglich, daß MORPHY
die Kapazitäten, über die er verfügte, hätte ausspielen können, wenn nicht sein
Talent und seine psychische Funktion sich frei fühlen dürften, vollkommen
konzentriert den gesetzten Aufgaben nachgehen zu können. Aber dies konnte nur so
lange der Fall sein, wie er von der Möglichkeit, daß die Gegenkräfte, die in
seinem Unbewußten aufgerührt wurden, entlastet war. Er war auf das Wohlwollen
von allem angewiesen, was dies bewirken könnte. Ich habe schon früher
ausgeführt, wie unnormal empfindlich er auf jeden Wink reagierte, seine
Absichten könnten in unfreundlicher Weise aufgenommen werden, d. h. daß sie
aufgenommen werden könnten, als wären sie selbst unfreundlich; auf jede
Andeutung, sie entbehrten eines echten Antriebes und wären vor allem befleckt
von geldgierigen Motiven; und schließlich auf jede Haltung, die Verachtung für
seine jugendliche Natur verriet.
STAUNTON verletzte ihn bitterlich in allen drei Hinsichten. Die Art und Weise
wie er ihn behandelte war sicherlich das Gegenteil von freundlich – es ist kaum
eine Übertreibung, wenn man sie als skurril bezeichnet; er warf ihm quasi vor,
er sei ein mittelloser Abenteurer; und er mied ihn mit der Ausrede, er hätte
ernsthaftere, d. h. erwachsene, Dinge zu erledigen. Angesichts dieser
Beschuldigungen verlor MORPHY den Mut, er gab auf und verließ den verruchten
Pfad der Schachkarriere. Es war, als hätte der Vater die bösen Absichten
demaskiert und würde nun im Gegenzug eine ähnlich feindselige Haltung gegen ihn
einnehmen. Was als ein unschuldiger und löblicher Ausdruck seiner Persönlichkeit
erschien, zeigte sich nun als der kindlichste und gemeinste Wunsch, der
unbewußte Impuls, auf den Vater einen sexuellen Anschlag zu verüben und ihn
zugleich vollständig zu verstümmeln: mit einem Wort: ihn ‚mattzusetzen’, dies
sowohl in persischer wie in deutscher Bedeutung des Wortes. Er unterwarf sich
dem tatsächlichen Wunsch seines Vaters und begann im erwachsenen Beruf des
Juristen zu praktizieren, verwarf gleichzeitig die, wie ihm gesagt wurde,
kindische Beschäftigung mit dem Schach.
Aber es war zu spät: seine ‚Sünden’ verfolgten ihn. In den beiden Dingen, die
die Männerwelt umfaßt, einem ernstgenommenen Berufsleben unter Männern und der
Liebe der Frauen, verfolgte und hintertrieb ihn seine Schachvergangenheit. Er
war niemals imstande, seinen ‚Sünden’ aus der Jugend zu entfliehen und seinen
Platz in der Welt der Männer einzunehmen. Es ist kaum verwunderlich, daß seine
Aufgabe des Schachs zunehmend vollständiger wurde, wenn er schon den bloßen
Namen des Spiels verabscheute. Die einzige Zuflucht, die ihm blieb, die Last
seiner Schuld zu bewältigen, war die Projektion. In dem Wahn, vergiftet oder
beraubt zu werden, erkennen wir auf seinen Schwager projizierte oral- und
anal-sadistische Phantasien. Seine homosexuelle Freundlichkeit zu Männern brach
zusammen, und der Antagonismus, der diese unterstützte, lag entblößt da. Dies
richtete sich in Richtung seines Schwagers, offensichtlich ein Ersatz für den
Bruder, während die letzte aus seinem Leben uns mitgeteilte Anekdote die
Anhänglichkeit an und die Verehrung für den Vater, dem das Privileg ‚Geld zu
machen’ gebührte, belegt.
Vielleicht läßt
sich bereits eine abschließende Folgerung aus der Betrachtung dieser tragischen
Geschichte ziehen. Es scheint, als könnte ein Anhaltspunkt zur wohlbekannten
Verbundenheit von Genialität und psychischer Instabilität geliefert werden. Gut
möglich, daß MORPHYS Fall ein allgemeingültiger ist. Genialität ist offenbar die
Fähigkeit, mittels stärkster, auch bloß zeitweiliger, Konzentration
ungewöhnliche Fähigkeiten anzuwenden. Ich würde behaupten, daß dies auf der
Gegenseite auf einer besonderen Fähigkeit, Bedingungen zu erkennen unter denen
das unbewußte Schuldgefühl in einer kompletten Schwebe gehalten werden kann,
beruht. Zweifellos kann dies in Zusammenhang gesetzt werden mit der
wohlbekannten Strenge, der Ernsthaftigkeit und der Reinheit des künstlerischen
Bewußtseins. Es wird allerdings erworben auf Kosten der psychischen Verfaßtheit,
die abhängig ist vom Wohlwollen jeglicher Störung dieser unverzichtbaren
Bedingungen. Dies scheint mir das Geheimnis der ‚künstlerischen Empfindlichkeit’
zu sein.
Diese
Geschichte bietet sich auch zur Diskussion einiger wichtiger psychoanalytischer
Anschauungen, für deren Skizzierung mir kaum noch Zeit verbleibt.
Es wird aufgefallen sein, daß ich – der Einfachheit
zuliebe – immerfort auf MORPHYS Gaben als auf ein Anzeichen seiner Fähigkeit zur
Sublimierung hingewiesen habe, und zurecht wird man nun fragen, ob dies nur die
Beschreibung eines verdeckten Weges zur Befriedigung von feindlichen, d. h.
vatermörderischen, Impulsen ist. In Beantwortung dieser Frage möchte ich
zunächst zugeben, daß die Impulse hinter dem Spiel letztendlich von gemischter
Natur sind, daß aber der essentielle Prozeß mir libidinös zu sein scheint. Ich
begreife, daß die vatermörderischen Impulse ‚gebunden’ sind an eine erotische
Besetzung, tatsächlich eine homosexuelle, und daß diese ihrerseits sublimiert
worden ist. Der enorme Nutzen des Verlaufs des psychischen Befindens MORPHYS
wird offensichtlich aus den oben erwähnten Schlußfolgerungen, und ich nehme ihn
als ein Beispiel für ein wichtiges allgemeines Gesetz, nämlich, daß der Prozeß
der Sublimierung eine defensive Funktion hat.
Durch das Freisetzen der Energie des Es
über einen abgelenkten Weg, insbesondere durch die Transformierung einer
sexualisierten Aggressivität, wird das Ich gegen die Gefahren beschützt, die wir
aus dem Produkt exzessiver Akkumulation dieser Energie kennen.
Schließlich ist es von Wert klarzustellen, daß wenn
jemand klinisch vom ‚Zusammenbruch der Sublimierung’ spricht, er in Wirklichkeit
die Einstellung ihrer defensiven Funktion meint. MORPHY konnte sowohl vor als
auch nach seinem psychischen Scheitern gut Schach spielen, wie durch seine
Gelegenheitspartien gegen MAURIAN belegt wird; in den meisten dieser Fälle,
vielleicht auch in allen, bleibt die letztlich durch den Sublimierungsprozeß
erlangte Befähigung selbst intakt. Was verloren gegangen ist, ist die Fähigkeit
zur Nutzung des Talentes zum Schutze gegen die überbordenden Impulse des Es, und
genau dies ist es, was die Patienten fürchten, wenn sie die Angst davor
ausdrücken, „die Psychoanalyse nehme ihnen ihre Sublimierungen weg“.
Anm. d. Üb.: Hier der komplette Text der Partie: PAULSEN-MORPHY,
New York (m/6) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lb5 Lc5 5.0–0 0–0 6.Sxe5 Te8
7.Sxc6 dxc6 8.Lc4 b5 9.Le2 Sxe4 10.Sxe4 Txe4 11.Lf3 Te6 12.c3? Dd3 13.b4 Lb6
14.a4 bxa4 15.Dxa4 Ld7 16.Ta2? (16.Da6!) Tae8 17.Da6 Dxf3! 18.gxf3 Tg6+
19.Kh1 Lh3 20.Td1 Lg2+ 21.Kg1 Lxf3+ 22.Kf1 Lg2+ 23.Kg1 Lh3+ 24.Kh1 Lxf2
25.Df1 Lxf1 26.Txf1 Te2 27.Ta1 Th6 28.d4 Le3 0:1. Nach MARÓCZY,
S. 45-46.














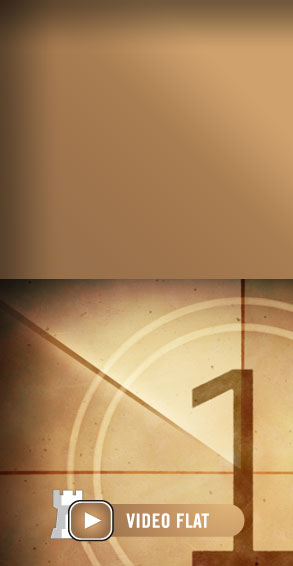
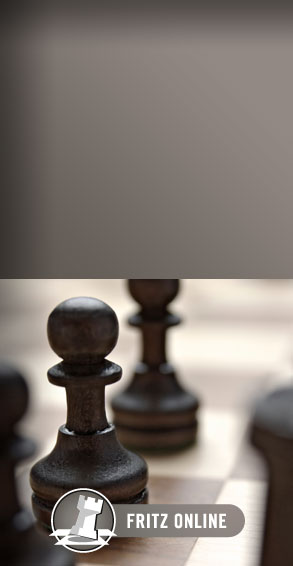


 PAUL MORPHY wurde am 22. Juni 1837 in New Orleans
geboren; er hatte eine sechseinhalb Jahre ältere und eine zweieinviertel Jahre
jüngere Schwester sowie einen zweieinhalb Jahre älteren Bruder.
PAUL MORPHY wurde am 22. Juni 1837 in New Orleans
geboren; er hatte eine sechseinhalb Jahre ältere und eine zweieinviertel Jahre
jüngere Schwester sowie einen zweieinhalb Jahre älteren Bruder.




