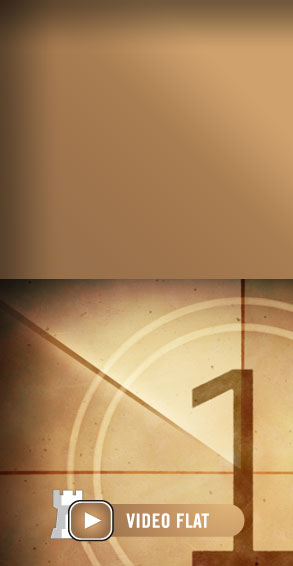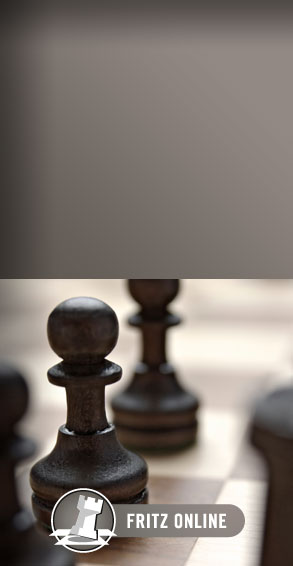Es ist Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr. Im Innenhof eines zwölfstöckigen Wiener Gemeindebaus herrscht eine ungewöhnliche und gespannte Stille. Zwei Jungen, die allen Nachbarn als laut tobende Fußballer bekannt sind, sitzen plötzlich einander schweigend und konzentriert gegenüber – die Augen fest auf das schwarzweiße Brett zwischen ihnen gerichtet. Am Nachbarbrett beugt sich ein älterer Herr mit verschränkten Armen über seine Partie und nickt anerkennend, als seine junge muslimische Gegnerin den Springer zieht und ihm ein Familienschach präsentiert. Im Hintergrund sortiert eine Frau Teegebäck, während vom Trainer ein weiteres Brett aufgebaut wird, um dort zwei Kindern die unterschiedlichen Zugweisen der Schachfiguren zu erklären.

Schachtraining in der Donaustadt, bei Regenwetter wird versucht, in Räume auszuweichen. | Foto: Christian Dusek
Willkommen bei einer der vielen lebendigen Schachszene des Projekts „Nachbarschaftliche Schachpartie“ des Projektträgers „Wohnpartner Wien“ – hier reichen die Züge weit über das Brett hinaus ...
Wohnpartner Wien – Brücken bauen im sozialen Gefüge
Wohnpartner ist eine 150 Mitarbeiter beschäftigende Initiative der Stadt Wien zur Förderung des guten Zusammenlebens in den städtischen Gemeindebauten mit etwa 220.000 Wohneinheiten, in denen fast eine halbe Million Menschen wohnt. Das Projekt geht über klassische soziale Arbeit hinaus: Es setzt auf Dialog, Beteiligung und Gemeinschaft, dort wo oftmals die Menschen bestenfalls aneinander vorbeileben und schlechtestenfalls dauerhaft in Konflikten miteinander verstrickt sind. Das können Konflikte sein, die durch Lärm in den Wohnungen oder den Gemeinschaftsbereichen wie Fluren oder Innenhöfen herrühren oder aber Konflikte, die kulturell oder religiös bedingt sind. Oft existieren solche Unstimmigkeit über lange Zeit und einfach nur, weil nicht miteinander kommuniziert wird oder aus sprachlichen Gründen gar nicht miteinander gesprochen werden kann.
Die bei Wohnpartner Beschäftigten arbeiten in den 23 Wiener Stadtbezirken. Sie bieten Beratung, Nachbarschaftsinitiativen und vielfältige Projekte zur sozialen Integration an. Ziel dabei ist es stets, die Bewohner zu aktivieren, um für sich selbst ein respektvolles und solidarisches Miteinander im Alltag mit den anderen Menschen zu ermöglichen. Herkunft, Alter, Bildung oder Lebensweise spielen dabei entweder keine Rolle oder werden sogar gezielt zur Förderung der Kommunikation eingesetzt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf kreativen Angeboten, die Kommunikation und gegenseitiges Verständnis stärken. Und genau hier kommt das Schachspiel ins Spiel.
Ein Brett für alle – Schach als Brücke zwischen Generationen
Denn was zunächst ungewöhnlich klingen mag, ist längst gelebte Realität: Schach als Mittel der sozialen Arbeit. Seit 2010 läuft bei Wohnpartner Region Nord (Donaustadt) ein bemerkenswertes Schachprojekt, das vom Wohnpartner-Mitarbeiter und Schachspieler Christian Srienz konzipiert wurde. Insbesondere gelang es dem FIDE-Meister innerhalb der Anfangszeit, seine überwiegend nicht schachspielenden Kollegen zu überzeugen und an Bord des Projekts zu holen. Seine Erfahrung mit einem Schachprojekt im Jugendzentrum diente ihm dabei als wertvolle Expertise.
 Der erste Schachausflug in einen Gemeindebau 2010 mit drei wohnpartner-Mitarbeitern | Foto: wohnpartner Team 22
Der erste Schachausflug in einen Gemeindebau 2010 mit drei wohnpartner-Mitarbeitern | Foto: wohnpartner Team 22
Was nach erfolgreicher Überzeugungsarbeit als kleines Angebot begann, hat sich rasch zu einem etablierten Bestandteil des Wohnpartner-Angebots entwickelt. Entscheidend bei der Konzipierung war die Mitwirkung der aus Ex-Jugoslawien stammenden Kroatin Calija Snjezana, die nach dem Vorbild der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo, wo auf öffentlichen Plätzen stets Schach gespielt wird, ähnliches für eine bessere Kommunikation in Wien mitgestalten wollte.
Doch was ist der besondere Reiz des Projekts der nachbarschaftlichen Schachpartie? „Schach ist generationsübergreifend, kulturenverbindend und gleichermaßen herausfordernd wie beruhigend. Es fordert Konzentration, fördert Fairness und Respekt – und bringt Menschen miteinander ins Gespräch“, fasst Srienz zusammen und legt zum Beispiel großen Wert darauf, dass sich die Spielpartner vor und nach dem Spiel die Hand geben.

Auch ältere Bewohner nutzen die Gelegenheit, wieder einmal zu spielen. | Foto: Christian Dusek.
Wenig überraschend, dass auch die Teilnehmer an den meist eineinhalb bis zweistündigen Veranstaltungen begeistert sind und schnell nicht nur zusammen spielen, sondern auch über die nachbarschaftliche Partie hinaus ins Gespräch kommen. „Beim Schach sind wir alle gleich. Es zählt nicht, wie alt du bist oder woher du kommst – nur, wie du denkst“, erzählt ein pensionierter Bewohner, der regelmäßig an den Spielnachmittagen teilnimmt. Hier wird nicht nur ausgetauscht, wo und wann man das Spiel erlernt, wann man das letzte Mal gespielt hat, hier geht es oft auch um ganz private Dinge und einen Austausch mit (noch) fremden Menschen, mit denen man vielleicht schon seit Jahren Wand an Wand wohnt, ohne sich näher gekommen zu sein.
Ein Spiel – viele Geschichten
Das Schachprojekt findet inzwischen regelmäßig an mehreren Standorten Wiens statt. Die Zielgruppe ist bunt gemischt: Kinder, Jugendliche, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, neugierige Nachbarn. Einige kommen, um das Spiel zu lernen. Andere bringen Erfahrung mit und freuen sich über neue Gegner. Wieder andere schauen überrascht aus dem Fenster, wenn es plötzlich ruhig wird und die fußballspielenden, sich dabei oft anschreienden Kinder auf einmal gedankenverloren und geradezu stumm am Schachbrett gegenüber sitzen.

Nicht nur Fußball wird auf den Grünflächen der Wohnanlagen gespielt, auch Schach. |
Foto: wohnpartner Team 22
„Magische Stimmung“
Besonders stolz ist das Team auf die zahlreichen jungen Teilnehmer, die über das Spiel erstmals Zugang zu strukturiertem Denken, Disziplin und strategischem Handeln erhalten. Die Wohnpartner-Mitarbeiterin Sarah Maienschein, die bei den Anfängen des Projektes als eine der ersten Schachtrainerinnen dabei war und bis heute Nachbarschaftliche Schachpartien als wohnpartner-Mitarbeiterin begleitet, hatte Srienz zuvor im Wiener Schachverein Tschaturanga kennengelernt und beobachtet immer wieder beeindruckt: „Kinder, die beim Schach lernen, sich zu konzentrieren und vorauszudenken, übertragen diese Fähigkeiten auch auf andere Lebensbereiche. Man sieht förmlich, wie sich ihr Selbstbewusstsein entwickelt. Es fasziniert mich, diese geradezu magische Stimmung mitzuerleben.“

Schachtraining – hier exklusiv für Mädchen und junge Frauen im Grätzl(=Stadtteil)-Zentrum Kaisermühlen. | Foto: Christian Dusek
Mehr als ein Spiel – Schach als Lebensschule
Das Projekt geht weit über reine Spielangebote hinaus. Regelmäßig finden Turniere statt, die sowohl Spannung als auch Stolz in die Gemeindebauten bringen. Bei diesen Veranstaltungen sitzen Anfänger neben versierten Spielern, Großeltern neben Jugendlichen – eine soziale Durchmischung, wie man sie sich oft nur wünschen kann.
Darüber hinaus gibt es Schnuppereinheiten, Workshops, Kooperationen mit Schulen sowie ein spezielles Schachtraining für Fortgeschrittene. Manche Spielnachmittage werden mit kleinen Festen kombiniert – mit Musik, Essen und offenen Türen für alle. Zu den Höhepunkten gehören Simultanauftritte zu denen beispielsweise die ukrainischen Weltklassespielerinnen Anna und Mariya Muzychuk oder die traurigerweise 2019 verstorbene österreichische Nationalspielerin Eva Moser gehörten – übrigens auch ein Beitrag dazu, das Vorurteil, Schach sei nur etwas für Männer, zu entkräften. Die Wiener Landesmeisterin des Jahres 2011, Sarah Maienschein, berichtet dazu aus eigener Erfahrung: „Wenn ich als Organisatorin mit den Kindern spielen möchte, schauen viele komisch, weil sie mit einem Mann als Trainer rechnen. Wenn ich dann aber erzähle, dass ich Landesmeisterin war, möchten die Jungs gegen mich gewinnen und die Mädchen möchten auch solche Erfolge anstreben.“

Die sympathische Marija Muzychuk mit Chesswoman und Chessman; aufgenommen beim ersten Alfreda-Hausner-Schachfestival 2022. | Foto: Christian Dusek
Natürlich sind diese Veranstaltungen keine Trainingslager, die solche Erfolge ermöglichen. Sie könnten aber der erste Schritt nicht nur für eine bessere Nachbarschaft, sondern auch in Richtung Vereinsmitgliedschaft sein. „Leider haben wir das aber noch nicht hinbekommen, die Teilnehmer in größerer Zahl in die Vereine zu locken“, bedauert Srienz diesen kleinen Wermutstropfen, der gegenüber dem großen Erfolg im Sinne des eigentlichen Projektziels aber zu vernachlässigen ist. Hin und wieder gibt es diese Ausnahmen aber doch:
„Ich habe früher nie gedacht, dass ich mal Turniere spiele“, sagt ein zwölfjähriges Mädchen mit leuchtenden Augen. „Jetzt übe ich sogar mit meinem Papa.“
Damit das vielleicht bald vermehrt in Vereinsstrukturen stattfindet, gründete sich der „Betriebsschachklub Lokomotive Wohnservice – Dynamo wohnpartner“. Er soll im Geiste der Arbeitersportvereine der 1920er- und 1930er-Jahre herkunftsübergreifend und soziale Klassen überwindend sportliches Miteinander fördern. Die inzwischen 20 Mitglieder unterstützen – man könnte sagen: logischerweise – immer wieder das Projekt „Nachbarschaftliche Schachpartie“. So investieren sie laut Srienz „viel, um die Lust am Schach zu erhalten und zu fördern“.
Schachkultur als Teil der Stadtkultur
Inzwischen hat sich das Projekt auch über die Grenzen der Donaustadt hinaus einen Namen gemacht. Es wurde in Fachkreisen als innovatives Beispiel für niederschwellige Bildungsarbeit und soziale Integration im urbanen Raum anerkannt, bei dem Schach als „gemeinsame Sprache“ vorhandene Sprachbarrieren überwindet. Die „Nachbarschaftliche Schachpartie“ dient als ein gelungenes Zusammenspiel von Spiel und sozialer Vision, das auch kulturelle Unterschiede zu überbrücken hilft.

Falls Tische fehlen wird auch auf den Bänken gespielt, Donaustadtstraße 30. | Foto: wohnpartner Team 22
Doch für Srienz bleibt der schönste Moment immer noch der, wenn zwei Menschen, die sich vorher fremd waren, plötzlich gemeinsam über eine Schachstellung grübeln. „Manchmal entstehen aus einer Partie echte Freundschaften“, sagt er. „Und das ist mehr wert als jede gewonnene Partie.“
Dafür lohnen sich die eingesetzten finanziellen Mittel der Stadt allemal und es bleibt zu hoffen, dass diese trotz immer knapper werdender Ressourcen auch künftig zur Verfügung stehen. Denn ohne die geht es laut der beiden treibenden Kräfte hinter dem Projekt nicht. Denn schließlich sind mindestens stets zwei Mitarbeiter mit vor Ort, begleitet von einem oder mehreren professionellen und – wie Srienz betont „fair bezahlten“ – Trainer. Zur Standardausrüstung gehört ein Rollkoffer mit Stehtisch, fünf kompletten Spielsätzen sowie Infomaterial vom Wiener Landesverband, der das Projekt unterstützt sowie bei Bedarf Demobrett und/oder Freilandschachausrüstung. Bei größeren Veranstaltung können aber weitere Mitarbeiter und Helfer, Zelte, Kinderangebote etc. hinzukommen. Auch die Kombination mit anderen Projekten der Wohnpartnerinitiative hat sich bereits bewährt. So können die Kinder Schach spielen, während die Eltern im Rahmen von SIBU (Soziale Information, Beratung und Unterstützung) beraten werden, wie sie etwa Behördengänge erledigen können und was in den komplizierten Formularen einzutragen ist.
Ein solches Projekt lässt sich freilich nur realisieren, wenn es langfristig angelegt werden kann. Nur so war es möglich, die herben Rückschläge durch die Versammlungsverbote während der Coronazeit zu verkraften. Inzwischen ist man wieder auf einem guten Weg, die jährliche, teils dreistellige Veranstaltungszahl aus Vorpandemiezeiten zu erreichen. Neben den mehreren Tausend überwiegend begeisterten Teilnehmern zeigen Anfragen aus beispielsweise Graz und auch aus dem Ausland, was für einen wichtigen Nerv die Wohnpartner mit diesem tollen Projekt getroffen haben. Wenig überraschend, wenn auch schade, dass diese Anfrage mangels verlässlicher finanzieller Mittel bislang nicht dauerhaft in Projekte umgemünzt werden konnten.

Schach im Hof, Chessman mit einem Spielset, das für ein Mädchenschachprojekt angeschafft wurde. | Foto: Christian Dusek
Schlusszug: Die Kraft des Spiels
Was bleibt, sind eindrucksvolle Bilder, wie zum Beispiel: Ein einfacher Holztisch, zwei Stühle, ein Schachbrett – und die Begegnung zweier Menschen. Im Projekt Wohnpartner ist Schach nicht nur ein Spiel. Es ist ein Werkzeug für Verständigung, ein Raum für Würde, ein Ort für kleine und große Erfolge. Es zeigt, dass Gemeinschaft da entsteht, wo Menschen einander zuhören – selbst wenn sie dabei schweigen.
Oder wie ein langjähriger Teilnehmer es ausdrückt: „Am Schachbrett bin ich nicht alt, nicht arm, nicht fremd. Ich bin einfach nur Spieler. Und das ist ein gutes Gefühl.“