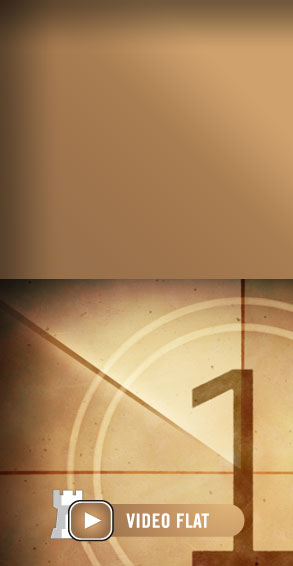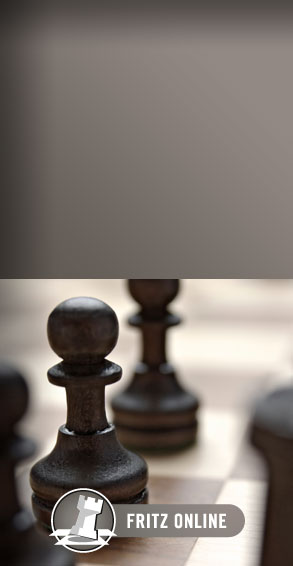Die von Kim Schu und Dr. Nils Haller an der Gutenberg Universität von Mainz online durchgeführte Studie "Cheating and Doping in Chess – A Survey among 1,924 German Club Players using the Randomized Response Technique“ liefert ein erschreckendes Ergebnis. Die knapp 2000 Teilnehmer, Schachspieler auf Vereinsniveau, gaben Auskunft darüber, ob sie beim Schach am Brett ("over the Board", OTB-Schach) oder und/oder beim Online-Schach schon einmal betrogen haben und ob sie zur Verbesserung ihrer Ergebnisse verbotene Doping-Mittel, also Mittel, die auf der Liste der verbotenen Substanzen der Anti-Doping-Agentur WADA aufgeführt sind, eingenommen haben.
In der Studie wurden ganz unterschiedliche Methoden des Betrugs im Schach abgefragt. Im Online-Schach war der häufigste Betrug die Teilnahme an fiktiven Wettbewerben (vermutlich zur Steigerung der Wertungszahl).
Weitere Betrugsmethoden sind:
- Ratschläge von Dritten einholen (9,2% der Teilnehmer im Online-Schach, 1,4% im OTB-Schach)
- Das Konto eines anderen Spielers benutzen (7,7% im Online-Schach)
- Elektronische Geräte benutzen (Online 3,1% bzw. 4,1%, OTB 0,4%)
- Ergebnisabsprachen (Online 0,9%, OTB 4,3%)
In Bezug auf die Einnahme von Medikamenten zur Leistungssteigerung (Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit oder zur Verhinderung von Ermüdung) gaben 5,1% der Teilnehmer an, solche Mittel zur Verbesserung ihrer Ergebnisse eingenommen zu haben.
Kim Schu und Dr. Nils Haller differenzierten die Ergebnisse nicht nur nach OTB-Schach und Online-Schach, sondern auch nach dem Alter der Teilnehmer und nach der Bedenkzeit der Partien.
André Schulz
Highlights
1924 wurden deutsche Vereinsschachspieler mittels direkter Fragen und der Randomized Response Technique befragt.
Die geschätzte 12-Monats-Prävalenz betrug 7,1 % für Betrug beim Brettschach, 6,2 % für Betrug beim Onlineschach und 5,1 % für kognitives Doping.
Die Häufigkeit des Betrugs wird möglicherweise durch Faktoren wie Fähigkeitsniveau, Alter und Spielmodus beeinflusst.
Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit maßgeschneiderter Anti-Cheating-Richtlinien im Schach, um die Integrität des Spiels zu gewährleisten.
Die Studie „Cheating and Doping in Chess – A Survey among 1,924 German Club Players using the Randomized Response Technique“ wurde im Fachjournal Performance Enhancement & Health veröffentlicht.
Schummeln im Schach – eine Studie unter 1.924 Vereinsschachspielern
Kim Schu (schu@uni-mainz.de)
Dr. Nils Haller (nhaller@uni-mainz.de)
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Link zur englischsprachigen Originalversion der Studie
Aufbau der Studie
Im Jahr 2024 führten die Wissenschaftler Kim Schu und Dr. Nils Haller von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eine umfangreiche Umfrage unter deutschen Vereinsschachspielern durch, um das Ausmaß von Betrug und kognitivem Doping im Schachsport zu ermitteln. Hintergrund war die zunehmende Sorge in der Schachwelt über betrügerisches Verhalten, insbesondere im Zuge technischer Entwicklungen und der wachsenden Beliebtheit von Online-Schach.
Die Erhebung (durchgeführt von April bis Juni 2024) richtete sich an aktive Vereinsschachspieler in Deutschland. Insgesamt nahmen 1.924 Personen (ca. 2% aller Vereinsspieler in Deutschland) an der Untersuchung teil. Darunter überwiegend Amateurspieler (899 Spieler*innen aus der Bezirksliga oder Kreisliga/ Kreisklasse & 792 Spieler*innen aus der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga oder Landesliga), sowie insgesamt 56 Spieler*innen aus der 1. oder 2. Bundesliga. Hinsichtlich der Spielstärke lag die Elo von 80 % der befragten Vereinsspieler*innen zwischen 1.600 und 2.200 Punkten.
Die Befragung erfolgte online und war vollständig anonym. Um ehrliche Angaben zu sensiblen Themen wie Betrug oder Doping zu ermöglichen, kam neben direkten Fragen auch die sogenannte Randomized-Response-Technik (RRT) zum Einsatz. Dabei geben die Teilnehmenden ihre Antwort auf eine harmlose oder sensible Frage nach einem Zufallsprinzip – ohne dass erkennbar ist, auf welche der beiden sie tatsächlich antworten. Dadurch können die Angaben nicht mehr einzelnen Personen zugeordnet werden, was eine höhere Ehrlichkeit begünstigen und realistischere Zahlen zu sensiblen Fragen ermöglichen soll.
Ergebnisse
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Betrug und kognitives Doping auch im deutschen Vereinsschach kein Randphänomen sind. Die geschätzte 12-Monats-Prävalenz für unerlaubte Hilfe durch Engines oder andere Informationsquellen lag bei 7,1 % im OTB-Schach und bei 6,2 % im Online-Schach. Anders ausgedrückt: Schätzungsweise 7,1 % der OTB-Spieler und 6,2 % der Online-Spieler haben innerhalb eines Jahres mindestens ein Mal in einer gewerteten Schachpartie betrogen. Besonders auffällig war, dass jüngere Spieler häufiger im Online-Schach betrogen haben als ältere (10 % vs. 2,7 %). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass jüngere Spieler mit digitalen Tools und Technologien vertrauter sind als ältere Personen, was ihnen das Betrügen zugänglicher machen könnte.
Hinsichtlich OTB-Schach haben Spieler, die bevorzugt lange OTB-Partien (Rapid oder Standard) spielen, häufiger geschummelt (10,5 %) als Spieler von kürzeren Formaten, wie Bullet oder Blitz (4,2 %). Dies könnte daran liegen, dass die längere Bedenkzeit mehr Möglichkeiten bietet, das Brett unter verschiedenen Vorwänden zu verlassen, um externe Hilfe in Anspruch nehmen zu können (z. B. ein verstecktes elektronisches Gerät auf der Toilette oder Ratschläge von einer dritten Person in einem unüberwachten Bereich).
Der Anteil der Spieler*innen, die verbotene leistungssteigernde Mittel eingenommen haben (kognitives Doping), wurde auf 5,1 % geschätzt. Doping war seltener bei Spieler*innen mit geringerer Spielstärke (2,3 %). Dies könnte daran liegen, dass diese Gruppe geringere Anreize und Motivation haben zu betrügen, da sie nicht durch die hohen Preisgelder, Prestige und den Wettbewerbsdruck bei hochrangigen Turnieren unter Druck gesetzt werden. Ältere Spieler (> 50 Jahre) wiesen ebenfalls eine leicht geringere Prävalenz auf (4,3 %), was möglicherweise auf stärkere ethische Überzeugungen („Etikette“) oder Bedenken hinsichtlich gesundheitlicher Risiken und Nebenwirkungen der Substanzen zurückzuführen sein kann.
Neben den RRT-Fragen wurden auch direkte Fragen gestellt, um die speziellen Methoden des Betrugs zu erforschen. Hier zeigte sich, dass 4,3 % der OTB-Spieler angaben, sich im Voraus mit dem Gegner auf ein Spielergebnis verständigt zu haben – eine Form der Spielmanipulation. Im Online-Schach räumten 9,2 % ein, sich während der Partie von Dritten beraten lassen zu haben.
Auch die Verwendung erlaubter leistungssteigernder Mittel wie Koffein wurde untersucht. 47,2 % der OTB-Spieler und 32,6 % der Online-Spieler gaben an, im vergangenen Jahr gezielt Kaffee, Energy-Drinks oder ähnliche legale Substanzen zur Steigerung der Konzentration eingenommen zu haben.
Ausblick
Die Ergebnisse der Studie liefern wichtige Erkenntnisse, um Risiken für Betrug und kognitives Doping im Schach besser zu erkennen und gezielt Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.
Die Autoren haben darauf aufbauend bereits eine zweite Studie abgeschlossen, in der das Vorkommen konkreter Anti-Cheating-Präventionsmaßnahmen bei Schachwettkämpfen anhand einer umfangreichen Befragung unter Vereinsschachspieler*innen untersucht wurde. Ergänzend dazu wurden zahlreiche Expert*innen – darunter Vertreter*innen des DSB, Schiedsrichter*innen sowie Staffelleiter*innen – interviewt. Ziel war es, fundierte Einblicke in bestehende Vorkehrungen zu gewinnen und die Entwicklung und Implementierung wirksamer Anti-Cheating-Strategien im organisierten Schachsport zu analysieren. Die Ergebnisse der Studie sollen Ende des Jahres 2025 veröffentlicht werden.
Zu den Methoden und Ergebnissen der Studie...