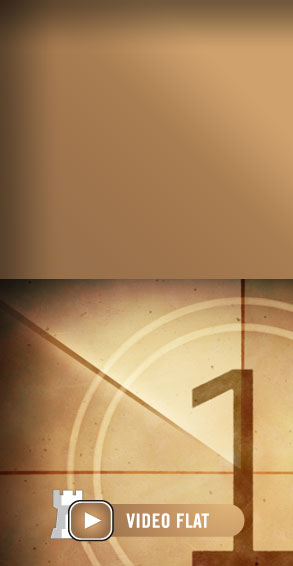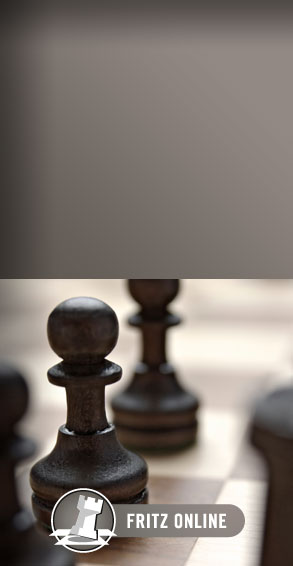MAGISCHE
SCHACH-ERREGUNG
Stefan Zweigs berühmte „Schachnovelle“ als Theaterstück
- kann das gut gehen?
Der Hamburger Regisseur Peter Kühn zeigte mit seiner
gelungenen Inszenierung am Altonaer Theater, wie man statt langer, deskriptiver
Passagen der Novelle mit dramatischen Effekten die düstere Vision einer
Bedrohung durch barbarische, monomanische Fachidioten eindringlich vermitteln
kann
Von Peter Münder

Auf dem Transatlantikdampfer von New York nach Buenos
Aires versammelt sich eine kleine Gruppe von Zuschauern um ein Paar am
Schachbrett. Der passionierte Schachspieler Dr. Friedrich Hartl, der sich hier
mit seiner am Brett dilettierenden Frau auf dem Deck öffentlich zur Schau
stellt, will damit den mitreisenden Schachweltmeister Miro Czentovic ködern: Der
wird die Partie vielleicht verfolgen und dann könnte man ihn möglicherweise zu
einem interessanten Duell herausfordern, so hofft er. Doch so einfach geht seine
Strategie nicht auf- erst der millionenschwere schottische Ölmagnat McConnor
macht es mit seiner 250 Dollar-Spende möglich, dass sich der ebenso eitle wie
arrogante Schachmeister zum Spielen einer Partie herablässt. Der homo ludens
kommt also auf seine Kosten, für abwechslungsreiche Stunden wäre also gesorgt,
wenn da nicht der nervöse, angespannt wirkende Dr. Bertram wäre, der zufällig
mitbekommt, wie die kleine Schachtruppe ihr Match gegen den ungehobelten
Czentovic zu verlieren droht. Bertram interveniert mit einem
fiebrig-dramatischen Auftritt, der ihn sofort als hochkarätigen Experten, aber
auch als überdrehten Außenseiter kennzeichnet: „Wenn Sie jetzt den Bauern auf
C1 in eine Dame verwandeln, schlägt er sofort mit dem Läufer, Sie nehmen mit dem
Springer zurück. Aber inzwischen geht er mit seinem Freibauern nach D7, bedroht
Ihren Turm, und auch wenn Sie mit dem Springer Schach bieten, verlieren Sie und
sind nach neun bis zehn Zügen erledigt. Es ist beinahe dieselbe Konstellation,
wie sie Aljechin gegen Bogoljubow 1922 im Pistyaner Großturnier initiiert hat“.
In der Rolle des Bertram glänzt der junge Ole Schlosshauer: Mit der
manisch-dynamischen Kraft eines Klaus Kinski kann er überzeugend das
Widersprüchliche dieser zerrissenen Figur hervorheben: Schach als Therapie für
den in Isolationshaft einsitzenden Gestapo-Häftling, aber auch als
nervenzersetzendes Gift, das ihn beinah in die Schizophrenie trieb. Wenn
Schlosshauer seinen Kopf über dem Brett ganz dicht an die Stirn seines Gegners
bewegt und diesen mit dem starren Ego-Zertrümmer-Blick eines Kasparow oder Bobby
Fischer anstarrt, dann spürt man, mit welcher Intensität sich dieser
Schauspieler in die Rolle des vom Schach Besessenen hineinversetzt. „Diese meine
Glückszeit“ nennt Bertram ja die Zeit, da er sich mit Tartakowers Schachpartien
beschäftigen konnte. Die dann aber auch zur magischen „Schach-Erregung“ mit
bedenklichen persönlichkeitsverändernden Auswirkungen mutierte.

So entwickelt sich das harmlose Gruppenspiel gegen den
dumpfbackigen Balkan-Meister Czentovic zur knallharten Konfrontation zwischen
Bertram und Czentovic. Der Wiener Kulturträger Bertram hatte in der Gestapo-Haft
einen Band mit 150 Meisterpartien von Tartakower im Vorzimmer des
Untersuchungsrichters aus einer Manteltasche stehlen und sich beim Nachspielen
der Partien die hohe Kunst des königlichen Spiels aneignen können. Er verdankt
dem Schach das Überleben in der Haft, während Czentovic, dieser „maulfaule
Bauernbursche“, der von „ordinärer Habgier“ besessen ist, das Spiel als
monomanischer „Schachautomat“ betreibt, um eine möglichst hohe Rendite
einzufahren. Diesen eiskalten Kalkulator spielt Oliver Schulz- als gelungenes
Abziehbild eines nur auf sich fixierten Roboters, der zu jeder Form der
Kommunikation unfähig ist und die Welt nur noch durch das Raster der 64
Schachfelder und über das Knistern der Dollarscheine wahrnehmen kann.
Auf diese Duell-Situation hatte Stefan Zweig seine 1941
veröffentlichte „Schachnovelle“ zugespitzt. Er selbst hatte ja, nachdem er vor
den Nazis über London und New Haven 1941 ins brasilianische Petropolis geflohen
war, in düsteren Vorahnungen den Untergang des Abendlandes durch solche von
Kultur völlig unbeleckten Typen befürchtet und sich dann 1942 in Petropolis
das Leben genommen. Stefan Zweig war übrigens passionierter Schachspieler und
spielte schon in seiner frühen Salzburger Zeit regelmäßig; in den letzten
Monaten vor seinem Freitod hatte er sich mit der Schach-Thematik beschäftigt,
weil er hoffte, mit geistigen Waffen sei die barbarische Herrschaft brutaler
Gewalt vielleicht doch noch zu besiegen. Doch angesichts des offenbar kaum zu
bremsenden Siegeszugs des Faschismus um 1940 resignierte er schließlich und
bezeichnete die Thematik der „Schachnovelle“ als „zu abstrakt für das große
Publikum“.


Diese resignative Spenglersche „Untergang- des-
Abendlandes“- Stimmung kommt in der Inszenierung von Peter Kühn, die auf einer
Bühnenbearbeitung von Helmut Peschina basiert, notgedrungen zu kurz. Kühn
betont die dramatischen Effekte dieses Schachduells, die von Zweig angerissene
politische Dimension eines Kulturkampfes ignoriert er, um stattdessen die
Konflikte auf den Beziehungsebenen zu polarisieren. Die in der Novelle leicht
ermüdenden Rückblenden und narrativen Einschübe mit der Vorgeschichte Bertrams
verkürzen sich hier zu plötzlichen Volten, die aus unverdächtigen, ruhigen
Gesprächssituationen abrupt in exaltierte Affekte übergehen. Bertrams Neurose
offenbart sich, dramatisch sehr effektvoll mit Gefängnis-Impressionen
inszeniert, fast in jeder Situation- sie ist eben immer präsent und nie richtig
therapiert worden. Da Oliver Schulz nicht nur den Czentovic, sondern auch den
Gestapo-Wärter spielt, der Bertram in der Haft tyrannisiert, wird die
Konfrontation dieser beiden Figuren folgerichtig und eindrucksvoll bis zum
Schachkampf auf die Spitze getrieben.


Das Stahlgerüst, das die Bühne total dominiert, ist
schlüssig als Ozeandampfer-Kulisse und als Gefängnis-Labyrinth der Gestapo
angelegt. Irritierend wirken allerdings die langen, gebetsmühlenartig
wiederholten Verhör-Dialoge, die zu Endlos-Schleifen werden. Merkwürdig auch,
dass alle Männer mit den gleichen mausgrauen Anzügen ausstaffiert waren. Der
skurrile Schotte McConnor hatte immerhin eine rote Blume im mausgrauen
Knopfloch, doch die graue, an die „Momo“-Zeitmänner erinnernde HO-Kluft wurde
weder den differenziert vorgeführten Figuren, noch den beiden völlig
entgegengesetzten Kontrahenten dieses Stücks gerecht, die das Schachduell ja
auch als Überlebenskampf verstehen. Aber das sind Petitessen am Rande, das
Inszenierungskonzept ist schlüssig und begeisternd.
Spannend und sehr informativ verlief nach der Vorstellung
die Diskussion mit den beiden Hauptdarstellern Ole Schlosshauer und Oliver
Schulz, die von der Dramaturgie-Assistentin Anke Kell souverän moderiert wurde. Die
„Schachnovelle“, so sieht es das Schauspieler-Team, sei heute eher als
Kommunikations-Konflikt zwischen Individuum und Gruppe zu interpretieren:
Bertram warne davor, als Schach-Experte überschätzt zu werden, er wolle sich ja
eigentlich dem als Entertainment gedachten Schach-Duell verweigern- doch niemand
höre ihm zu. Diese Unfähigkeit (oder die Weigerung), anderen zuzuhören, sei eben
das aktuelle Problem unserer Zeit.
Diese rasante, hochdramatische Inszenierung wurde begeistert bejubelt- selbst
die vom Stück faszinierten Schulklassen, die hier vielleicht befürchtet hatten,
zum Schulfunk-Abhören verdonnert zu sein, gaben während der Vorstellung keinen
Mucks von sich. Diese Bühnen-Rarität ist jedenfalls sehr zu empfehlen – nicht
nur Schachspielern.
Fotos: Pressfotos Joachim Hiltmann
SCHACHNOVELLE
nach dem Roman von Stefan Zweig - Bühnenbearbeitung von Helmut Peschina
Premiere: 26. Oktober, Vorstellungen bis 23. November
Regie: Peter Kühn • Bühne: Zoltan Labas • Kostüm: Christine Merz
Mit: Klaus Falkhausen • Jürgen Hoppe • Joachim Lautenbach • Elena Meißner •
Ulrich Meyer-Horsch • Hans-Jörg Schernthaner • Ole Schloßhauer • Oliver Schulz
„Schachnovelle“ im Altonaer Theater, Hamburg, Museumsstr. 17, Tel. 399 05 870
31.10 20 Uhr, 1.11. 20 Uhr, 5.11. 19 Uhr, 6.-8.11. 20 Uhr, 9., 12., 11. 19 Uhr,
13.-15. 11. 20 Uhr, 19.11. 19 Uhr, 20.11. 20 Uhr