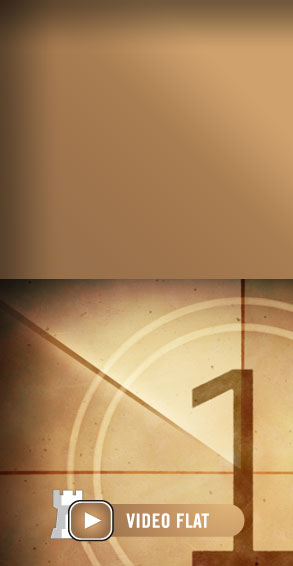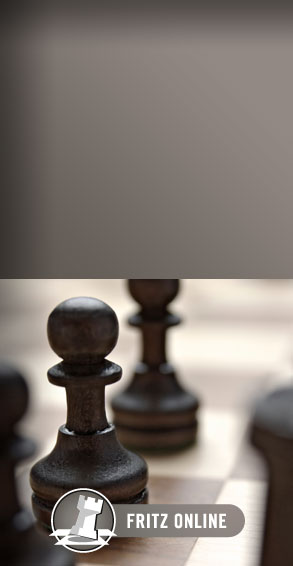Diskussion: Doping im Schach
In seinem Beitrag "Von der Willkür der Dopingkontrollen" hat Robert Hübner sich
gegen Dopingkontrollen im Schach ausgesprochen, Argumente für die Sinnlosigkeit
derselben im Schach dargestellt und auf den unangemessenen Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte durch die Kontrollen hingewiesen. Als Reaktion auf den
Beitrag erhielten wir Hinweise von Lesern auf evtl. Möglichkeiten zum Doping
auch im Schach mit Hilfe von konzentrationsfördernden Mitteln. GM Gerald
Hertneck begrüßt explizit die Dopingkontrollen im Schach und sieht in modernen
Designermedikamenten zur Steigerung der Hirnleistung durchaus eine Bedrohung für
den Schachsport. Wir laden daher zur Diskussion ein: Gibt es
(leistungsförderndes) Doping im Schach? Ist Doping im Schach zumindest denkbar?
Sind die Dopingproben im Schach sinnvoll oder überflüssig? War es richtig vom
Deutschen Schachbund, sich dem Anti-Doping-Code der NADA zu unterwerfen oder
hätte der DSB mehr um seine Sonderstellung kämpfen sollen, auch auf die Gefahr
hin, von der Sportförderung ausgeschlossen zu werden? Bitte schicken Sie uns
ihre Meinung zu diesen Fragen und weiteren Aspekten des Themenkreises. Nach
Abschluss der Diskussion verlosen wir unter allen Einsendern drei Ausgaben des
ChessBase Magazins Nr. 123 mit original Autogramm von Weltmeister Viswanathan
Anand. Schicken Sie ihre Zuschrift an
andreschulz@chessbase.com
Leserbriefe
Veröffentlichung vom 6.1.2009
Der lesenswerte Beitrag von Harald Balló hat mir u. a. deutlich gemacht, dass
die Debatte um die Frage, ob durch Doping beim Schach eine Leistungssteigerung
möglich ist, letztlich am Thema vorbeigeht. Balló legt unter Nr. 2 seiner
Ausführungen (Seite 4 der pdf-Datei) dar, dass die Leistungssteigerung gar nicht
Bestandteil der Doping-Definition der WADA (World Anti-Doping Agency) sei. Balló
hat Recht: Im WADC (World Anti-Doping Code) heißt es unter Nr. 2.2.1:
"Es ist nicht
entscheidend, ob die Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen
Methode leistungssteigernd wirkt oder nicht. Es ist ausreichend, dass der
verbotene Wirkstoff oder die verbotene Methode angewendet wurde oder ihre
Anwendung versucht wurde, um einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen zu
begehen."
Hieraus und aus den weiteren Bestimmungen des WADC geht hervor:
Doping ist nicht die Einnahme leistungssteigernder Substanzen. Doping ist
vielmehr der Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, und die besagen
zusammengefasst im Wesentlichen: Ein Verstoß liegt vor bei Anwendung eines auf
der Dopingliste aufgeführten Wirkstoffs oder beim Versuch, sich einer
entsprechenden Kontrolle zu entziehen.
Das heißt: Das von den Befürwortern von Dopingverboten und -kontrollen im Schach
häufig angeführte und sicherlich auch populärste Argument, es gehe um Fairness
im Wettkampf, indem verhindert wird, dass sich Spieler ungerechtfertigte
Vorteile verschaffen, ist bei Licht betrachtet ein Scheinargument. Auch die
Einnahme eines Wirkstoffs, der unstreitig keine Leistungssteigerung hervorrufen
kann, ist Doping, wenn der Wirkstoff in der Dopingliste aufgeführt ist.
Dies wird bestätigt durch die in Nr. 4.3 des WDAC niedergelegten Kriterien für
das Verbot eines Wirkstoffs: Es müssen von den drei Kriterien - a)
Leistungssteigerungspotential, b) Gesundheitsrisiko und c) Verstoß gegen den
Sportsgeist - lediglich zwei erfüllt sein, damit ein Wirkstoff verboten werden
kann. Da die Definition (genauer gesagt: Umschreibung) des "Sportsgeistes" im
WDAC u. a. Werte wie "Gesundheit" und "Anerkennung von Regeln und Gesetzen"
enthält, kann praktisch jede Substanz, die nach Auffassung der WADA
gesundheitsgefährdendes Potential hat, auf die Dopingliste gesetzt werden. Zudem
gibt es keine Möglichkeit, sich darauf zu berufen, ein Wirkstoff sei zu Unrecht
auf die Dopingliste gesetzt worden. In Nr. 4.3.3 des WDAC heißt es nämlich:
"Die
Festlegung der WADA von verbotenen Wirkstoffen und verbotenen Methoden in der
Liste verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden ist verbindlich und kann
weder von Athleten noch von anderen Personen mit der Begründung angefochten
werden, dass es sich bei dem Wirkstoff bzw. der Methode nicht um ein
Maskierungsmittel handelt oder dass der Wirkstoff bzw. die Methode nicht das
Potenzial haben, die Leistung zu steigern, dass sie kein Gesundheitsrisiko
darstellen oder gegen den Sportsgeist verstoßen."
Zu Deutsch: Alles, was die
WADA verbietet, ist verboten. Und es gibt keine Möglichkeit, sich dagegen zu
wehren. Wenn die WADA beschließt, dass Leute, die rauchen, Kaffee oder Alkohol
trinken oder Schokolade essen, keine "richtigen Sportler" sind und deswegen bei
Sportwettkämpfen nichts zu suchen haben, dann dürfen auch Schachspieler, die
derlei Verwerfliches tun, nicht mehr in Ligen und DWZ/ELO-gewerteten Turnieren
mitspielen, wenn sich der DSB den Regeln der WADA unterwirft.
Ich bleibe dabei: Die Funktionäre des DSB haben kein Recht, uns im
DSB organisierten und Beiträge zahlenden - also das Einkommen der hauptamtlichen
Funktionäre finanzierenden - Schachspielern direkt oder indirekt vorzuschreiben,
wie wir zu leben haben. Erst recht ist der DSB nicht dazu befugt, die
Schachspieler einer Gesundheitsdiktatur der WADA auszuliefern. Die WADA ist
eine Organisation, die von uns Schachspielern nicht ansatzweise demokratisch
legitimiert ist und die festgelegt hat, dass ihre Verbote von niemandem
überprüft werden können. Die Unterwerfung unter den WADC verstößt mithin gegen
elementarste Grundsätze von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wer seine
Mitmenschen darüber belehren will, was gesund ist und was nicht, mag Arzt,
Ernährungsberater oder Missionar werden. Als Schachfunktionäre sind solche Leute
fehl am Platz. Von einem DSB-Funktionär erwarte ich, dass er sich für die Rechte
der Schachspieler einsetzt und nicht gegen uns Spieler arbeitet. Und wenn (was
kaum glaubhaft ist) die Bereitstellung staatlicher Fördermittel (deren Höhe die
Dopingverbot-Befürworter, die sich hierauf berufen, in der Chessbase-Diskussion nicht
einmal überschlägig angegeben haben) wirklich davon abhängen sollte, dass wir
uns der Willkür der WADA unterwerfen, dann müssen wir eben auf diese Mittel
verzichten.
Kleiner Denkanstoß zum Schluss: Wenn es um "Gesundheitsvorsorge" geht, ist
es dann nicht der beste Rat, überhaupt kein Turnierschach mehr zu spielen?
Ernsthaftes Schachspielen ist (wie übrigens auch die meisten Sportarten,
insbesondere im Bereich des Leistungssports) ganz bestimmt nicht "gesund"; man
sitzt stundenlang am Brett und der Körper wird infolge des psychischen Drucks
extrem beansprucht, ohne dass man sich bewegt.
Matthias Budzyn
Diskussion „Doping im Schach“ bei ChessBase 27.12.2008
In der aktuellen Doping-Diskussion melde ich mich noch
einmal zu Wort, weil die meisten der vorliegenden Beiträge sich nicht zum
entscheidenden Punkt äußern und insofern am Thema vorbeigehen.
Zuerst ein kurzer Rückblick. Als die Diskussion über
Doping-Kontrollen im DSB vor 2007 in den offiziellen Gremien des DSB begann,
wurden inhaltlich die gleichen Argumente vorgetragen, wie wir sie jetzt in den
Leserbriefen lesen können. Dies führte zu der Haltung, erst einmal abzuwarten,
vielleicht käme man ja um Doping-Kontrollen herum, weil im Schach doch gar kein
Doping möglich sei. Keiner unserer Ärzte hat damals z.B. auf das auf der Liste
verbotener Substanzen stehende Methylphenidat (Ritalin) hingewiesen, obwohl die
Problematik in den Schulen seit Jahren bekannt ist.
Dies ging so lange gut, bis der erste Landesverband seinem
Landessportbund Rechenschaft über die Doping-Bekämpfung ablegen musste. Abwarten
war nun nicht länger möglich. Als wir das Problem auf Bundesebene erörterten,
sprach sich eine klare Mehrheit dafür aus, es nicht den einzelnen
Landesverbänden zu überlassen, jeweils eigene Regelungen zu erarbeiten, sondern
eine bundeseinheitliche Lösung anzustreben. Inzwischen ist das wegen des Drucks
des Bundesinnenministeriums und des DOSB auch kaum noch anders möglich.
Es wird stets betont, dass die Landesverbände Hessen und
Bayern (als einzige) der Einführung von Doping-Kontrollen nicht zugestimmt
haben. Das ist nur insofern richtig, als dies für die Präsidenten dieser
Landesverbände gilt. Ich kenne Spitzenfunktionäre aus diesen beiden
Landesverbänden, die genau der entgegen gesetzten Meinung sind. Dies weist für
mich auf ein Grundübel des Deutschen Schachbundes hin, nämlich auf die fehlende
Diskussionskultur, die ein moderner Sportverband benötigt, wenn er sich
weiterentwickeln will. Das unschuldige „wir wollen doch nur Schach spielen“, das
mich seit den ersten Anfängen begleitet, wird künftig nicht mehr reichen, wenn
man z.B. den Mitgliederbestand halten und vielleicht sogar eine noch bessere
Rolle im Weltschach spielen will. Insofern bezweifle ich, dass die
Verweigerungshaltung in der Doping-Frage in den genannten Landesverbänden
mehrheitstauglich ist. Andererseits haben auch die Befürworter längst nicht alle
die Diskussion mit ihren Mitgliedern geführt, so dass uns noch Überraschungen
bevorstehen könnten.
Die inzwischen geklärte Frage, welchen spezifischen Status
der Deutsche Schachbund innerhalb des organisierten Sports künftig erhalten
solle, ist ein weiteres Problem, das dazukam und inhaltlich mit dem Doping-Thema
zusammenhängt, aber es hat auch eigene Dimensionen.
Das Kernproblem ist für mich die strategische Ausrichtung
des DSB in den kommenden Jahren. Im März 2007 fand in Eisenach eine Tagung
statt, die sich dieses Problems annehmen sollte. Leider befindet sich der
Strategieprozess nach vielversprechenden Anfängen momentan in einer Sackgasse.
Damals wurde angeregt, die Strategiediskussion in die Basis zu tragen und
beginnend mit den Vereinen die Erneuerung des DSB von unten nach oben anzugehen.
Die Mitglieder könnten sich dann z.B. dazu äußern, ob sie weiter im
organisierten Sport verbleiben oder eine Neuorientierung anstreben wollen.
Ob es jemals zu einer solchen Diskussion kommen wird, ist zweifelhaft. Im
Moment muss sich jeder verantwortlich handelnde Funktionär an den Gegebenheiten
orientieren. Diese besagen ganz einfach: Wer sich nicht aktiv an den
Doping-Kontrollen beteiligt, riskiert den Ausschluss aus der Förderung. Für den
DSB würde das kurzfristig wahrscheinlich bedeuten, dass durch Streichung von
Zuschüssen und geförderten Stellen mehr als 1 € pro Mitglied fehlen, die durch
eine Beitragserhöhung wieder hereingeholt werden müssten, wenn man den
Leistungsstand erhalten will. Zwar sind die WM und die Olympiade inzwischen über
die Bühne gegangen, aber es wäre fraglich, ob vergleichbare Veranstaltungen
künftig noch gefördert werden. Besonders naiv wäre es zu glauben, dass der DSB
beim Ausscheren aus der Sportorganisation mehr Sponsorengelder einwerben könnte
als bisher. Auf jeden Fall müsste vor einem Ausscheren ein Alternativkonzept
her, damit man in der Übergangsphase überleben könnte.
Wenn man also die Unterwerfung unter die Anti-Doping-Politik des DOSB
ablehnt, was ich durchaus nachvollziehen kann, dann spielt man Vabanque
mit der Zukunft des DSB. Der in diesem Zusammenhang häufig gehörte Vorwurf, die
Funktionäre seien nur hinter dem „schnöden Mammon“ her, ist eine Beleidigung für
alle Ehrenamtlichen, die ihre Zeit und ihr Geld einsetzen, um die finanzielle
Basis des Deutschen Schachbundes zu sichern, von der letzten Endes die
Gesamtheit aller Schachspieler profitiert.
Herbert Bastian
Präsident des saarländischen Schachverbandes
Mit Aufmerksamkeit verfolge ich die Diskussion um das Thema
Doping auf der ChessBase-Website. Da die Diskussion so sehr polemisiert wird,
möchte ich gerne von Seiten unseres Verbandes folgende Fakten klarstellen:
1. Geld von Sportorganisationen
Schach ist in den meisten der FIDE zugehörigen Föderationen als Sport anerkannt
UND bekommt von den nationalen Sportorganisation sehr viel Geld für
Leistungssport und Jugendarbeit. In diesem Sinne sind alle entsprechenden
Bestimmungen des Sports einzuhalten, es sein denn Schach will aus der
Sportfamilie austreten und auf die entsprechenden Förderungen für den
Schachsport verzichten. Hier gibt es keinen Mittelweg, weil die
Anti-Doping-Bestimmungen in vielen Länder sogar den Status von Bundesgesetzen
haben.
2. Doping im Schach
Es ist nicht wesentlich, ob es für den Schachsport leistungssteigernde Mittel
gibt oder nicht. Wesentlich ist, dass niemand gezwungen sein soll solche Mittel
zu nehmen um in seinem Sport erfolgreich sein zu können. Wenn Doping in einer
Sportart kein oder nur ein kleines Problem ist, dann sollte es für seine
Vertreter auch kein Problem sein dies hin und wieder nachzuweisen. Schach hat
bei den Anti-Doping-Agenturen den niedrigsten Prioritätslevel. Daher kommt es
sehr selten zu Kontrollen. Probleme gibt es bisher nur, wenn Sportler/innen die
Kontrolle verweigern.
3. Gesundheitsgefährdung von Doping
Oft und gerne wird für den Schachsport eine Ausnahme gefordert. Welchen Sinn
sollte aber eine solche Ausnahme machen, die es erlaubt im Schachsport
gesundheitsschädigende Medikamente zu nehmen, die zudem keine
leistungssteigernde Wirkung haben? Bei der ganzen Diskussion darf man nie
vergessen, dass die Einnahme von Dopingmitteln teils dramatische Auswirkungen
auf die Gesundheit der Sportler/innen hat. Will man die Jugend zum Sport
bringen, dann ist es wichtig und richtig den Sport sauber zu halben und dies
auch zu beweisen.
4. Ausnahmegenehmigungen
Wer aus gesundheitlichen Gründen zur Einnahme von Medikamenten gezwungen ist,
bekommt als Leistungssportler (Kaderspieler) eine entsprechende
Ausnahmegenehmigung. Doping Kontrollen finden erfahrungsgemäß nur bei
Kaderspieler/innen statt bzw. bei hohen Meisterschaften (Welt-, Europa-,
Staatsmeisterschaften). Es braucht also niemand aufhören Schach zu spielen.
5. Vorbild Spitzensportler
Die Spitzensportler im Schach sollten sich ihrer Vorbildwirkung bewußt sein. Die
Argumentationskette Schach sei kein Sport ist kontraproduktiv. Fakt ist, dass
nur Mittel aus der Sportförderung eine sinnvolle Arbeit im Leistungs- und
Jugendschach erlauben. Dies auf das Spiel setzen zu wollen wegen ein paar
Alibikontrollen pro Jahr scheint uns eine sehr kurzsichtige Denkweise. Das
Argument des Eingriffs in die Privatsphäre ist viel strapaziert und sachlich
auch richtig. Aber dieser Eingriff trifft auf alle Sportarten zu und trifft uns
zudem in vielen anderen Lebensbereichen. Zum Glück gibt es Vorbilder wie Anand,
der kein Problem hat sich einer Kontrolle zu unterziehen und stets auch den
Sportaspekt des Schachs betont. Mögen seinem Beispiel viele folgen.
Mit sportlichen Grüßen,
Walter Kastner
Generalsekretär des Österreichischen Schachverbandes
*Gleichberechtigung für Fernschachspieler !*
Bei der Diskussion um Doping im Schach habe ich den Eindruck, daß die
Fernschachspieler - wie meistens - einfach übersehen werden. Die
Fernschachspieler sind auch Mitglied des Schachbundes.
Für die Akzeptanz einer Tätigkeit als Sportart ist es bekannterweise ein
wichtiges Kriterium, ob gedopt werden kann.
Die Nutzung von Computern und Schachsoftware hat keinen bedrohlichen Einfluss
auf die Entwicklung des Fernschachsports. Anders sieht es aus hinsichtlich der
Leistungsverbesserung durch die Einnahme von Anabolika. Von dieser Seite droht
offensichtlich die Gefahr. Also erwarte ich, daß auch die
Fernschachnationalmannschaft bei den Testen der NADA oder WADA nicht weiterhin
ignoriert wird. Ich wäre an dem Ergebnis interessiert, ob beispielsweise der
Schachpräsident und Nationalmannschaftsmitglied Prof. Dr. Robert von Weizsäcker
durch Einnahme muskelbildender Präparate seine Spielstärke im Fernschach
verbessert hat.
Gerhard Schmidt
Auch wenn ich in letzter Zeit scheinbar nur noch Links
schicke, möchte ich Ihnen diesen letzten nicht vorenthalten. Quasi zum Thema
"legales Gehirndoping" :-)
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,597556,00.html
Ansonsten muss ich zur laufenden Diskussion anmerken,
dass einige Beiträge aus meiner Sicht ziemlich engstirnig sind bzw. einfach
nicht offen genug für neue Entwicklungen. Ich bin nicht der (in der Diskussion
häufig geäußerten) Meinung, dass die Wirksamkeit von Doping im Schach erst
nachgewiesen sein muss, um Regeln gegen Doping einzuführen.
Vielmehr geht die Vermutung bereits jetzt dahin, dass
solches Doping bereits jetzt möglich ist, und das genügt mir. Natürlich sind
Doping-Kontrollen lästig, keine Frage, aber wie viel Prozent der Spieler werden
denn davon betroffen sein? Vermutlich weniger als ein Promille.
Insofern verstehe ich auch nicht, wieso sich normale
Vereinsspieler darüber echauffieren.
Gut hat mir die Argumentation gefallen, wonach sich die
Schachspieler entscheiden müssen: entweder sie wollen, dass Schach als Sport
anerkannt ist (mit den damit verbundenen Vor- und Nachteilen), aber dann müssen
sie sich auch den aus mancher Sicht "entwürdigenden" Dopingregeln unterwerfen.
Oder sie verzichten auf diesen Status, aber dann wird Schach in seiner Struktur
noch "ehrenamtlicher" als ohnehin schon, und das sehe ich gerade als Manko, dass
die ganze deutsche Schachorganisation "mangels Masse" mehr oder weniger auf das
Ehrenamt fokussiert ist. Nichts gegen das großartige Engagement der
Ehrenamtlichen, aber wenn wir die letzten vom Innenministerium geförderten
Stellen auch noch aufgeben, dann gute Nacht schöne Schachwelt!
Man kann es natürlich auch ganz anders sehen: nachdem
man im modernen Schach ohnehin andauernd betrogen wird, und sei es nur durch
ausgefeilte, zum Teil bis über den 20. Zug hinausreichende Vorbereitungen am
heimischen PC oder Notebook, durch "variantenreiche"
Unterhaltungen während der Partie oder durch mitlaufende
Engines, ist es ja beinahe schon egal geworden, ob man auch noch sein Gehirn
dopt... Aber dann gibt man wirklich das letzte Quäntchen an Fairness-Kontrolle
auf.
Glücklicherweise scheint mir, dass Doping bei den
wichtigsten Spielstärkefaktoren machtlos ist, nämlich Talent und Erfahrung.
Insofern kann Neurodoping aus meiner Sicht nur einen Teil der schachlichen
Kompetenz verbessern, nämlich aus meiner Sicht die Fähigkeit zur
Variantenberechnung und die Konzentrationsfähigkeit über die volle
Partiedistanz. Dass ein "Wachmacher"-Präparat hier keine Wirkung erzeugen
sollte, erscheint mir völlig abwegig, auch wenn es dutzende Male in der
Diskussion bezweifelt wird. Dabei spielt natürlich der Faktor der Nebenwirkungen
eine große Rolle. Ein Medikament, das in erster Linie euphorisierend wirkt, ist
als Dopingmittel natürlich ungeeignet, weil es die im Schach notwendige
Objektivität herabsetzt.
Noch ein Gedanke zum Schluss: wenn wirklich durch
Einnahme von Modafinil oder anderen Substanzen Prüfungsergebnisse verbessert
werden, wieso sollte dies nicht auf das Schach übertragbar sein? Auch bei
Prüfungen zählt Konzentration und abstraktes Denken, allgemein gesagt: ein
wacher Geist. Ich sehe hier keinen Unterschied zur Situation am Brett!
Gerald Hertneck
Die
ganze Diskussion über Doping im Schach ist doch grotesk und überflüssig und nur
Vorwand für speziell monetäre Interessen einer Kreise.
Wie
entstand sie und wem nützt sie? Dies sind die entscheidenden Fragen. Es dürfte
wohl so sein, dass einige Schachfunktionäre gern an Geld für die Sportförderung
kommen wollten und somit mußte Schach zu Sport erklärt werden. Einfacher wäre es
zu argumentieren, dass Schach auf geistig, psychischem Gebiet zumindest das
leistet, was Sport in physischer Hinsicht tut und somit ein eigenes Fördergeld
beansprucht und entprechende Maßnahmen wie z. B. in östlichen Ländern seit
Jahrzehnten.
Der
Nutzen liegt also bei Funktionären in der Geldgewinnung und vor allem bei der
"Dopingmafia", also Dopingärzten, Labors und alles was daran hängt. Für diese
wird es ein Riesengeschäft, wenn sich alle Schachspieler Dopingtests unterziehen
müssten. Deshalb findet jetzt auch verstärkt in den Medien, ausgehend von diesen
Gruppen und sicherlich auch vom Fidepräsidenten, der seine Hände ja bei alen
dubiosen Geschäften im Spiel hat,eine große Aktion statt, die Menschheit davon
zu überzeugen, dass Schach ein Sport sei und die meisten fallen tatsächlich
darauf herein.
Zu
allem Überfluss soll es noch als olympische Disziplin erklärt werden. Man stelle
sich diesen Blödsinn einmal bildlich vor: die Sportler reisen an mit ihren
Trainingsgeräten (Fußballschuhen, Hockeyschläger, Degen, Säbel, usw), bereiten
sich körperlich auf die Wettkämpfe vor, wärmen sich vor den Kämpfen lange auf
und erbringen dann körperliche Höchstleistungen in Laufen, Schwimmen,usw. Jeder
kann sich alles gut vorstellen. Nun kommen die Schachspieler mit laptops, ruhen
sich erst einmal aus, gehen gemütlich spazieren, rauchen ein Zgarettchen und
trinken ein Bier, vor den Runden legen sie sich erst einmal 1 Stündchen hin, um
sich bei dem anschließenden fünf- oder sechsstündigen Sitzen nicht zu
überanstrengen.
Jeder normale Mensch, der sich dies einmal vorstellt, wird doch jeden für
verrückt erklären müssen, der Schach für Sport hält. So wird Schach auch schon
immer als Gegenteil von Sport in allen Bevölkerungsschichten und allen Ländern
angesehen. Jeden den man fragt, ob Schach ein Sport sei und der nicht mit der
verwirrenden manipulativen Diskussion vertraut ist, wird lachen und klar nein
sagen .
Selbst GM betreiben Sport wie Fußball, Tischtennis, Joggen, usw als Ausgleich
für ihre sitzende antisportliche Tätigkeit, um fit zu bleiben für ihre schweren
geistigen Anstrengungen, die selbstverständlich auch Auswirkungen auf den Körper
haben und daher eine gewisse körperliche Kondition erfordern. Dies trifft aber
auch z.B. auf Managertätigkeit zu oder auf jemanden der längere Zeit geistig
arbeitet, vielleicht stundenlang Kreuzworträtsel löst, was ja auch als
"Denksport" bezeichnet wird. Auch langes Computerspielen strengt körperlich
an. Niemand käme auf die Idee, hier von Sport zu sprechen.
Primär wird beim Schach der Geist und die Psyche gefordert, die im Körper starke
Ermüdungserscheinungen auslösen. Umgekehrt lösen starke körperlich Anstrengungen
auch psychische Erschöpfung aus und Sportler sind oft nach starken körperlichen
Belastungen wochenlang ausgebrannt und leiden teilweise sogar unter Depressionen
und Antriebslosigkeit.
Mein Aufruf an alle Verantwortlichen für diesen Unsinn: bitte denkt nach und
lasst uns Schachspieler ganz einfach wieder Schachspielen und dies ohne Verdruss
genießen wie schon seit hunderten von Jahren. Schach ist wirklich ein
wunderbares Spiel, das schon viele Freude und Freunde geschaffen hat und sollte
nicht durch die Profitgier gewisser einflußreicher Leute im
"Schachestablishment" in Mißkredit gebracht werden und uns die Lust, Freude und
Laune daran nehmen. Schach ist definitiv kein Sport im korrekten Sinne der
Bedeutung des Worte Sport.
Klaus Künitz
Auch ich möchte mich an der Diskussion „Doping im Schach“
beteiligen und auf einen Bereich aufmerksam machen, der m.E. bisher noch zu kurz
gekommen ist, durch die Ausführungen von Herrn Balló u.U. aber eine gewisse
Brisanz beinhaltet: Die Kontrollierbarkeit des Sportlers!
In einem zweiten Abschnitt möchte ich den Themenkomplex „Verweigerung einer
Dopingkontrolle“ anhand von Fragen an den DSB näher beleuchten.
Zu 1.) Kontrollierbarkeit des Sportlers/Spielers
Wie bitte stellt sich der DSB die Kontrollierbarkeit von 100.000 Sportlern vor?
Sollen alle Spieler, die an Mannschaftswettbewerben teilnehmen, ein
entsprechendes Tagebuch führen und Auslandsreisen anmelden? Wie viele Sportler
machen sich dann durch ihre Anmeldungen verdächtig, da diese evtl. sehr
kurzfristig erfolgt sind? Hat hier überhaupt irgendjemand daran gedacht, dass es
hier nicht um Sportler, sondern um Amateurspieler geht, die „nebenbei“ auch
einen Beruf haben und u.U. extrem kurzfristig auf Auslandsreise gehen müssen
(oh, das ist kein Trainingslager!)?
Wie kann es angehen, dass sich keiner im DLV für meine Reisetätigkeit
interessiert, obwohl ich an offiziellen (Lauf-)Veranstaltungen bis hin zum
Marathon teilnehme, mir jedoch nun gemäß der Zusammenfassung von Herrn Balló
eben exakt eine solche Pflicht durch meine Teilnahme an Mannschaftskämpfen beim
Schach droht?
Entweder wird hier auf Chessbase (von wem auch immer) ein riesiger Popanz
aufgebauscht, hinter dem nichts, aber auch rein gar nichts steht und auch nichts
stehen kann. Oder der DSB verpflichtet sich hier in lächerlicher Weise zu einer
Vorgehensweise, die nicht einmal in den von Doping bedrohten (oder soll man
sagen „verseuchten“?) Sportarten durchgeführt wird.
Daher bitte ich hier um konkrete Aufklärung seitens des DSB (Herren Balló, Bedau,
…):
1.) Wer ist mit der Personengruppe gemeint, für die Herr Bedau eine
Kontrollschlüssel von 0,3 zugestanden hat? Die Gruppe derjenigen Sportler, mit
denen Einzelvereinbarungen getroffen wurden oder alle Spieler, die an
Mannschaftskämpfen teilnehmen? Eben nur für diejenige Gruppe (so jedenfalls mein
bisheriger Informationsstand) ist die Kontrollierbarkeit außerhalb des
Wettkampfes überhaupt relevant.
2.) Wie will der DSB die Kontrollierbarkeit von Amateurspielern handhaben?
3.) Ist es notwendig, dass ich als Schachspieler in Zukunft meine Reisetätigkeit
anmelden muss? Wenn ja, ab welcher Liga? Muss ich mit einer Sperre rechnen, wenn
ich die üblichen Vorwarnzeiten regelmäßig NICHT einhalte?
4.) Gibt es für unangemeldete bzw. sehr kurzfristig angesetzte (Auslands-)Reisen
ebenfalls eine „Standard-Entschuldigung“, die ich mitführen oder dem DSB in
regelmäßigen Abständen vorlegen muss – sozusagen analog der vom Arzt
ausgestellten Atteste für Krankheiten, die die Einnahme von Dopingmitteln
erlauben – erstellt durch meinen Arbeitgeber? Darf sich ein Selbständiger diese
Entschuldigung dann selbst erstellen? In welchen Statuten ist das geregelt?
Ich hoffe, die Fragen 2.) – 4.) sind aufgrund der „richtigen“ Antwort auf Frage
1.) irrelevant.
Zu 2.) Verweigerung von Dopingkontrollen
Bisher habe ich für mich die Frage nach Dopingtests wie folgt beantwortet:
So unangenehm Dopingkontrollen sein mögen, wenn ich als Amateur an
entsprechenden Veranstaltungen teilnehme, muss ich damit rechnen, dass ich
kontrolliert werde, wenn ich das nicht will, muss ich den Veranstaltungen fern
bleiben. Soweit ich mich auf DLV-Veranstaltungen befinde, habe ich mich damit
abgefunden.
Dies erscheint mir jedoch für Veranstaltungen des DSB eher fragwürdig:
Warum soll ich mich einem Dopingtest unterziehen, wenn Herr Ivanchuk als Profi
(!!) diesen auf einer Olympiade (!!!) UNGESTRAFT (!!!!) verweigern darf und sich
darüber nicht einmal irgendjemand in der FIDE aufregt? Veranstalter war doch der
DSB, oder? Welche Maßnahmen hat der DSB bisher unternommen:
Ist Herr Ivanchuk von jeglichen Veranstaltungen des DSB in Zukunft
ausgeschlossen?
In wie fern haben Sie bisher Druck auf die FIDE ausgeübt, Herrn Ivanchuk zu
sperren?
Wie stehen Sie nun zu Turnieren mit Teilnahme von deutschen Spielern, an denen
auch Herr Ivanchuk starten wird?
Wie stehen Sie zu Spielern, die an Turnieren teilgenommen haben oder teilnehmen
werden, an denen auch Herr Ivanchuk NACH
seiner verweigerten Dopingprobe teilgenommen hat oder teilnehmen wird? Dürfen
diese in Zukunft noch an Veranstaltungen des
DSB teilnehmen?
Die Antworten auf diese Fragen stellen m.E. einen Lackmustest für Ihre
Ernsthaftigkeit (und Sinnhaftigkeit) bei der Einführung von Dopingproben dar.
Keine Antwort ist auch eine Antwort! Nehmen Sie Stellung! Nur eines Vorweg: Ein
Rückzug auf rechtliche Winkelzüge der Art „anderer Verband“, „keine Einflußnahme
möglich“, „keine rechtliche Verpflichtung gg. BMI“, „war doch vor dem 1.1.2009
und somit für Deutschland nicht relevant“, … wird Sie zumindest moralisch (evtl.
auch rechtlich - zumindest vor einem Zivilgericht – aber das mögen Anwälte
beurteilen) in eine äußerst schwierige Situation bringen, wenn Sie
Dopingverweigerer bei Amateurveranstaltungen sperren wollen.
Jürgen Feiler
Nicht die Wirksamkeit von
Intelligenzpillen u.ä. muss bewiesen werden, um Doping zu verbieten, sondern die
schädlichen Nebenwirkung. Nur die negativen Auswirkungen können ein Verbot
rechtfertigen, nicht die positiven.
Christian Vogel
In der Diskussion scheint mir eine gewisse Einigkeit darüber zu
herrschen, dass aktuell kein Weg des Doping bekannt ist, der über längere Zeit
funktioniert. Vor diesem Hintergrund stellt sich mir nicht die Frage danach, ob
die Fairness sichernde Dopingkontrollen gemacht werden sollen, es stellt sich
mir die Frage, ob ich Kontrollen über mich ergehen lassen will, die sinnlos
sind. Mit anderen Worten: Kontrollen darauf hin, ob ich elektronische
Hilfsmittel nutze, lasse ich mir gerne gefallen, sie sind ein Beitrag zur
Fairness im Schach. Weder die NADA, noch der DSB oder gar der DOSB haben zur
Zeit irgend eine Idee, wonach sie bei Schachspielern suchen wollen. Ändert sich
das, dann bin ich gerne bereit, mich kontrollieren zu lassen.
In diesem Sinn muss ich auch Herrn Bastian entgegenhalten, dass weniger die
Verweigerung das Thema ist, als vielmehr die Frage danach, ob eine Alternative
zu etwas sinnlosem überhaupt gesucht werden muss. Nicht diejenigen sind in der
Bringschuld, die nachfragen, ob hier das geprüft wird, was Sinn macht, sondern
die, die sagen, dass auf diesem Weg betrogen wird sollten zumindest in der Lage
sein, auch nur ein Beispiel anzugeben, wie sie diesen Betrug aufdecken wollen,
wie der Betrug überhaupt durchgeführt werden könnte. Ändert sich das, haben also
die ehrlichen Spieler die Gefahr vor Augen, Partien aufgrund von Doping statt
spielerischer Leistung zu verlieren, so ändert sich mit Sicherheit auch die
Akzeptanz der Kontrollen.
Solange dem aber nicht so ist, ist die Dopingkontrolle nicht mehr als ein
grundloser Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte.
Ralph Ottenburg
Mit einiger
Verwunderung nehme ich zur Kenntnis, dass selbst Mediziner bestreiten, dass beim
Schachwettkampf durch Medikamente Einfluss auf die Leistungsfähigkeit genommen
werden kann. Es dürfte einsichtig sein, dass zu einem erfolgreichen
Spiel/Schachwettkampf auch physische und psychische Stärke gehören, die durch
die Einnahme von Hilfsmitteln günstig im Sinne des Schachspielers beeinflusst
werden können.
So betrachtet
macht eine Dopingkontrolle Sinn.
Auf der anderen
Seite wird ein Schachspieler jedoch seine eigentliche Schachleistungsfähigkeit
hierdurch nicht steigern können. Noch gibt es keine Tabletten, die einem Wissen
in Eröffnung, Mittelspiel oder Endspiel verschaffen.Insoweit unterscheidet sich
Doping beim Schach wesentlich von anderen Sportarten, bei denen unmittelbar die
Leistungsfähigkeit im ausgeübten Sport gesteigert wird und damit der gedopte
Sportler verdeckt, dass er eigentlich schlechter als der ungedopte Kollege
ist. Durch Doping wird ein mittelmäßiger Schachspieler nicht besser als
ein besser ausgebildeter oder begabterer Spieler.
So betrachtet ist
m.E. schlicht pragmatisch abzuwägen, ob man hinnehmen will, dass ein
Schachspieler keinen Leistungsverlust durch Erschöpfung/Nervosität o.ä. erleidet
- also mit Hilfsmitteln seine volle Spielstärke bewahren kann - oder ob der
durch Verbot bedingte Leistungsverlust ein so wesentlicher Teil des
Schachwettkampfes ist, dass es im Sinne der Gerechtigkeit unerträglich wäre,
diese Hilfe zu dulden.
An dieser Stelle
neige ich bereits dazu, dass im Vordergrund die schachliche Stärke stehen sollte
- also vernachlässigt werden kann, ob jemand Wachmacher oder Beruhigungsmittel
nimmt.
Ein weiteres
Argument gegen Dopingproben sind die Bedeutung und die finanzielle Situation des
Schachs. Dopingproben kosten bekanntlich Geld und verursachen Umstände.
Sollen
tatsächlich nach Bundesligakämpfen mit weniger als 10 Zuschauern ( so am
vorletzten Spieltag an beiden Tagen in Dresden erlebt), Ärzte oder sonstiges
Hilfpersonal bestellt werden, die Urinproben nehmen? Muss dann demnächst die
Rückreise so gebucht werden, dass ein Spieler nach der Höchstspielzeit noch 2
Stunden für eine Dopingprobe besitzt. Muss der Heimverein in Zukunft noch in den
Etat die Kosten der Dopingproben einplanen - bei einer Liga, für die sich
mutmaßlich nur in tausenden zu zählende Liebhaber interessieren.
Eine lächerliche
Vorstellung !
So betrachtet
gibt es gleich eine Vielzahl von Argumenten gegen Dopingproben im Schach. Da
spielt es dann auch keine Rolle mehr, dass sowieso keine reale Chance besteht,
dass Schach olympisch wird.
Dr. Hans Joachim
Schneider
Mir wird in der jetzigen Diskussion das Doping zu sehr
als Kavaliersdelikt dargestellt, als ob es da nur um Fairness, was ja ein sehr
relativer Begriff ist, gehen würde. Für viel wichtiger halte ich aber die
Gesundheitlichen Gefahren.
Als ich im Sommer ein Thema für meine C-Trainer-Arbeit
gewählt habe, hätte da um ein Haar nicht "Bauernstrukturen" sondern "Doping und
Drogen unter besonderer Beachtung des Schachs" gewählt. Wegen des Aufwandes und
weil ich ja nicht immer auffallen muss, wurde letzteres verworfen. Es hätte jede
Menge Zeit für Recherche und Interviews bedeutet, obwohl ich sicher eine Menge
Sozialarbeiter, Ärzte und sogar Sportwissenschaftler kenne, ich also wahrlich
nicht bei 0 gestartet wäre. Ich bitte, meine vielen unbewiesenen Behauptungen zu
entschuldigen, hoffe aber, dass ich diese umgangssprachlich markiert habe.
Einige Gedanken
Der wissenschaftliche Ansatz wäre gewesen, dass der
Körper über Hormone gesteuert wird. Das bedeutet, dass zu jedem hormonellen
Stellrad im Körper mindestens ein Hemmer und ein Aktivator existiert somit ein
Gleichgewicht existiert. Die meisten Doping- und Drogensubstanzen verändern
dieses Gleichgewicht, sorgen also für eine Hormon(-gleichgewichts-)verschiebung.
Ich hätte mich in der Arbeit auf diesen Aspekt beschränkt und hätte andere
Wirkmechanismen nicht weiter untersucht. Beispielsweise hätte ich nicht
recherchiert, ob das gezielte Ausschalten von neuronalen Funktionen durch
niedrig dosierte Gifte wie Alkohol oder bestimmte Kräuter und Pilze im Endeffekt
auch auf Hormonverschiebungen projiziert werden könnte (wahrscheinlich nicht).
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Körper von
selbst in der Lage ist, ein vernünftiges Gleichgewicht zu wählen. Und weil eine
gute Leistungsfähigkeit des Gehirns sicherlich ein evolutionärer Vorteil ist,
muss es schwerwiegende Gründe geben, warum wir nicht noch besser denken können.
Meine Vermutung ist, dass wer an diesen Gleichgewichten
herumschraubt, ähnlich wie ein zu ehrgeiziger Autotuner eine Schädigung des
Mototor bzw. Denkorganes riskiert. Zusätzlich würde bei regelmäßiger
Dopingeinnahme das Hormongleichgewicht beim Absetzen unweigerlich in die andere
Richtung pendeln.
Entsprechend hätte ich mir in der Arbeit herausgenommen,
GM Timman für seine Aussage zu kritisieren, dass er "intelligenter machende
Mittel" sofort nehmen würde. Beispiele von Hormonverschiebungsmissbrauch in
anderen Sportarten sind schlimm genug. Ob es ehemalige DDR-Athletinnen mit
männlichen Körpern und Nierenversagen sind oder tot zusammengebrochene
aufgeputschte Radsportler in den 60ern und 70ern. Ein nicht ganz so dramatisches
ober sehr wohl abschreckendes Beispiel sind manche Fussballer der 80er Jahre.
Durch Captagon waren die Spieler 90 Minuten aggressiv und nicht müde zu
bekommen. Die Müdigkeit haben die dann die nächsten Tage über nachgeholt und
trotzdem wurde dadurch sicherlich auch der Körper geschädigt. Ein recht
harmloses Beispiel sind Lightprodukte, die natürlich auch zur Insulinproduktion
anregen und damit auf längere Sicht zu Eßstörungen führen können.
Im Schach kann ich mir 3 Bereiche vorstellen, in denen
man eventuell Nachhelfen könnte.
Anregung der Aktivierung bzw. Neubildung von
Gehirnzellen
Ich habe Artikel gelesen, in denen davon ausgegangen
wird, dass auch Gehirnzellen nachwachsen und gehe inzwischen auch selbst davon
aus. Eine Wachstumsstimulation sollte auf alle Fälle das Krebsrisiko steigern,
aber auch Wesensveränderungen durch seelische Krankheiten kann ich mir bei einem
solchen Eingriff (Aktivirung oder Neubildung) ins Gehirn gut vorstellen.
Depressionen bis hin zur Schizophrenie oder geistige
Umnachtung für ein paar Elopunkte riskieren? Ein grauenhafter Gedanke.
Steigerung der Aufmerksamkeit - das Gegenteil von
Betablockern
Normalerweise arbeiten alle Organe, auch das Gehirn,
weit unterhalb der möglichen Kapzität. Eine Eigenschaft von guten Sportlern war
es von jeher, im entscheidenden Moment mehr abrufen zu können. In
außergewöhnlichen Situationen, z.B. Notsituationen, ist jeder Körper
leistungsfähiger.
Diesen Modus im Sport künstlich zu unterdrücken kann
nicht gut sein. Es geht also darum, den Puls nicht künstlich wieder auf 120 oder
gar 80 zurückzufahren, sondern einen leistungsfähigen Körper zu haben, der mit
einem Puls von 160 oder gar 180 eine bestimmte Zeit umgehen kann. Ich könnte mir
vorstellen, dass es Mittel gibt, die bei der Adrenalinausschüttung im richtigen
Moment helfen. Hier sollte auf alle Fälle manipuliert werden können, dass man
künstlich aufmerksamer ist.
Steigerung der Kondition
Ich habe es selbst schon hinter mir, dass ich eine
gewonnene Stellung nicht nach Hause gespielt habe, weil ich konditionell
abgebaut habe. Meinen Gegnern ist das natürlich auch schon passiert, dass die
nach 4 Stunden regelrecht kollabiert sind.
Mir fallen dabei zuerst 2 verdächtige Größen, die bei
Mangel die Leistungsfähigkeit herabsetzen und die in fast jeder Sportart wichtig
sind.
Sauerstoff und Glukose. Sinkt der Sauerstoffgehalt,
findet keine saubere Verbrennung der Glukose mehr statt, habe ich irgendwann mal
gehört. Sollte dies ein Problem darstellen, könnte sogar EPO ein Mittel sein.
Bei einem halbwegs trainierten Menschen sollte aber die Sauerstoffaufnahme nicht
das schwächte Glied der Kette sein. Trotz allem hat man während einer
Schachpartie erhöhte Atemaktivität.
Bei der langen Zeit, die das Gehirn mit Energie versorgt
werden muss, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass man da manipulieren
kann. Aber ich vermute, dass auch hier kein Flaschenhals vorhanden sein muss.
Ein gut verstandener und trainierter Stoffwechseprozeß sollte in der Lage sein,
genug Energie bereitzustellen. Ein interessanter Anfang könnte z.B. hier liegen
(man beachte den ersten Satz :-) ):
http://www.dr-moosburger.at/pub/pub023.pdf
Dann bleibt als Flaschenhals also doch nur das Gehirn
(als beanspruchter Muskel) mit seinen anderen "Verbrauchsmaterialien". Sofern es
Substanzen gibt, die der Körper selbst bilden muss, wäre auch hier das Anstoßen
der Produktion durch das entsprechende Hormon denkbar. Man kann aber sicherlich
durch normales Training von Geist und Körper mit einfacher Nährstoffzuführung,
was ja legal ist und bleibt, auch ein sehr hohes Niveu erreichen.
Ausblick
Ich hoffe, dass das Thema Doping demnächst etwas
negativer dargestellt wird.
Jeder Mensch, der aus gesundheitlichen Gründen auf
Hormonpräparate angewiesen ist und sich damit beschäftigt hat, würde bestimmt
gerne darauf verzichten.
Und dann gibt es Leute, die sowas freiwillig ohne Grund
nehmen. Sowas sollte auf keinem Fall gesellschaftlich akzeptiert sein.
Dass man Dopingkontrollen trotzdem auf einem
vernünftigen durchdachten Niveau halten sollte, möchte ich auch noch erwähnen.
Um Manipulationen mit Fremd- oder älterem Eigenurin zu vermeiden, müssen die
Genitalien bei einer Dopingkontrolle weiträumig freigelegt werden die Sportler
werden beim Pinkeln natürlich beobachtet. Das ist schon für Leichtathleten, die
meist auch modeln könnten, ein sehr unangenehmer Vorgang. Was soll da ein Mann
oder eine Frau mit etwas Übergewicht und 40 Lenzen sagen?
Ein durchdachtes Konzept, das Kontrollen nicht ausufern
lässt, nur um dem IOC zu gefallen, ist gefragt. Aber Kontrollen und
gesellschaftliche Ächtung von Doping müssen meiner Ansicht nach sein.
Falk Petigk
Eine Immergrüne,
gespielt in Sperrejahren?
Vor der
Analyse ein Gefühlsausbruch:
Pharmakonzerne, freut euch nicht zu früh! Wahre Meisterinnen und Meister werden
sich zur Leistungssteigerung weder Eigenblut spritzen noch ambivalent wirkende
Stoffe einnehmen. Eher meiden sie künftig Verbrennungsmotoren und Feinstaub, als
dass sie den Versprechen des Neuro-Enhancing trauen.
Jene
Organisatoren, die ohne Verständigung mit den Aktiven, ja selbst ohne
hinreichende Klärung praktischer und juristischer Fragen die Dopingkontrolle ins
Schachleben einführen, möchte man an den Schultern packen und durchrütteln:
Welcher Teufel hat euch geritten? Statt der Öffentlichkeit das Wesen des
Schachs näher zu bringen, unterstellt ihr ohne Anlass eine reale Gefahr des
Wirkstoffbetrugs im Schachwettkampf und setzt die Würde eines Kulturzweigs aufs
Spiel! Und dann dreht einer von euch den Spieß um, spricht von
gesellschaftlichem Interesse und unterstellt Kritikern Individualismus! Dies
auch gegenüber einem so verdienstvollen Angehörigen des Deutschen Schachbundes
wie Großmeister Hübner, der auf einen gefährlichen Prozess in der Gesellschaft
aufmerksam macht. (Zumindest er darf eine Entschuldigung erwarten.)
Vielleicht das Erstaunlichste angesichts eines historischen Einschnittes: Obwohl
die Dopingkontrolle Anfang 2009 einsetzen soll, erhält die Schachwelt bisher
keine Erklärung zum Beschluss der jüngsten Hauptversammlung:
Wer hat
ihn gefordert? Wie wird er begründet? Welche Vorstellungen vom Schach liegen ihm
zugrunde?
Wurden
Hirnforscher und Ärzte konsultiert?
Geriet
der DSB in eine (vermeintliche) sportpolitische Zwangslage?
Welche
Argumente wurden auf der Hauptversammlung ausgetauscht?
Welchen
Aktivenkreis soll die Kontrolle betreffen? Wie weit greift sie in den Lebens-
und Arbeitsrhythmus und die Privatsphäre ein? Welche Strafe ist im Fall
verweigerter Unterwerfung vorgesehen? Wie ist zu verhindern, dass sich abstrakte
Rechtsprechung in Unrecht verkehrt?
Nun
besorgt, aber ohne Zorn zur Sache.
1.
Athletensport, Schach und die Olympischen Spiele
Wenn ich
es richtig verstehe, steht der DSB-Beschluss im Zusammenhang mit dem Bestreben
der gegenwärtigen FIDE-Führung, Schach zum Bestandteil der Olympischen
Sommerspiele zu machen. Unklar ist, inwieweit der Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) angesichts seiner Definition von Sport, die Schach ausschließt, diesen
Wunsch unterstützt. Wenn sich der IOC-Präsident, wie zu hören ist, distanziert
verhält, so meines Erachtens keineswegs nur aus organisatorischen Gründen.
Möglicherweise ist er mit Schach gut vertraut und achtet seine eigenständigen
Traditionen. Mit Sicherheit aber versteht Jacques Rogge, dass Schachkämpfe eine
andere Art des Kontaktes mit dem Publikum verlangen als athletische
Wettbewerbe. Da Schach ein viel tieferes, angestrengteres und anhaltenderes
Mitdenken fordert, eignet es sich wenig für bloßes Zuschauen und
Schau-Berichterstattung. Es mag durchaus interessant sein, die äußeren Regungen
der Partner am Brett zu beobachten. Entscheidend aber ist nun einmal das
Unsichtbare, das sich in ihren Köpfen abspielt und als Resultat in der
Figurenbewegung hervorscheint. Dieses äußerlich nicht allzu reizvolle
Geschehen bietet dem IOC kaum Chancen, den Vermarktungsgewinn der Olympischen
Spiele weiter zu steigern. Wenn die FIDE und angeschlossene Verbände dennoch
mit der Einführung von Dopingkontrollen Schach als reif für die Sommerspiele
erscheinen lassen möchten, so ist das mit großer Wahrscheinlichkeit vergebliche
Mühe.
Umso mehr,
als Athletensport und Schach unterschiedlichen Sinn haben. Dabei geht es
keineswegs nur um die verschiedene Gewichtung des körperlichen Einsatzes (auch
beim Schachkampf arbeitet der gesamte Organismus mit).
Leicht-
und Schwerathleten vollbringen außergewöhnliche Leistungen. Im Beifall
für ihre Rekorde feiert sich die Menschheit: Da unsere Fähigkeiten in vielerlei
Hinsicht den Möglichkeiten anderer Lebewesen nachstehen, stärken
grenzüberschreitende athletische Triumphe unser Selbstbewusstsein. Diese
Taten wie auch Leistungen in anderen athletischen Disziplinen (vielleicht mit
Ausnahme von Ansätzen der ballettnahen Eislaufkür) bedeuten allerdings nicht,
dass der Athletensport bleibende Werke schafft – man lese bitte nicht:
Werte.
Wenn
Siegbert Tarrasch feststellte: „Der eigentliche, feinste Reiz des Schachspiels
liegt darin, dass man dabei geistig produktiv ist“, so ist dieses Produktiv-Sein
wörtlich zu nehmen. Schachmeister schaffen Werke. Zug um Zug verzahnen die
miteinander kämpfenden Partner ihre Argumente zu einem reproduzierbaren Ganzen.
(In seinem schachlichen Testament „Wie Wanja Meister wurde“ vergleicht Emanuel
Lasker das Schachspiel mit dem Redestreit.) Das Werk kann zu „Abfall“
geraten. Aber oft erweist es sich, ungeschädigt von Blackouts, für tausende oder
Millionen Menschen als nachspielenswert. Und in Sternstunden entstehen
Meisterstücke, die noch Jahrhunderte später Genuss bereiten und begeistern,
seien es Shortstorys oder Dramen in fünf Akten.
Man mag
gewisse Analogien zwischen Schach und athletischen Zweikampf-Sportarten (Boxen,
Ringen) oder Mannschaftsspielen bemerken; Fussballreporter sprechen von
„Rochade“ und fälschlich von „Rasenschach“; man kennt den „Angriff auf beiden
Flanken“ und den „Durchbruch im Zentrum“ nicht nur beim Schach. Aber die
Gemeinsamkeiten berühren nicht den Wesenskern des Schachs. Sein werkschaffender
Aspekt warf bekanntlich sogar urheberrechtliche Fragen auf – siehe die erwähnte
Erzählung Laskers und Anläufe Hübners. Beim Athletensport war davon nie die
Rede; hier ist offenbar der Spielraum für Schöpfertum begrenzter. (Am weitesten
gespannt ist er wohl beim Turnen und bei Künstlerischer Gymnastik. Bei Ball- und
Puckspielen erscheint er manchem ungeachtet von Trainerintelligenz und Spielwitz
nervend eng.)
Mit dem
werkschaffenden Charakter des Schachs ist eine weitere Besonderheit verbunden.
Wie Athleten trainieren auch Schachmeisterinnen und -meister vor dem Wettkampf.
Aber sie tun mehr: sie forschen. Sie erschließen ständig neue Wege der
Auseinandersetzung auf den 64 Feldern – ein Ende ist vorerst nicht abzusehen.
Sie suchen Initiative versprechende Ideen für Eröffnung und Mittelspiel und
lösen ungeklärte Endspielfragen. Falls sportartspezifische Forschung das
Training der Athleten begleitet, so ist der Sportler hieran nicht
unbedingt persönlich beteiligt. Der ernsthafte Schachkämpfer befindet sich
hingegen in einem unablässigen Erkundungs- und Schöpfungsprozess, annähernd
vergleichbar mit dem Schaffensprozess eines Schriftstellers oder der Arbeit des
Wissenschaftlers. Dabei ist es zweitrangig, ob sich ein Großmeister auf Computer
und Helfer stützt – ohne eigenes Schöpfertum keine stimulierende Freude und kein
dauerhafter Erfolg.
(Dass neben
das beschriebene Erkunden – Hübner nennt es Problemlösen – in einem entwickelten
Land philosophische, kulturhistorische, pädagogische, trainingsmethodische und
medizinische Schachforschung tritt, versteht sich. Einen Einblick gewährte in
den 80er und 90er Jahren die Rubrik „Schachakademie“ der Zeitschrift „Schach“.)
Fazit:
Schachspieler und Athleten (weibliche Wortformen mitgedacht) mögen sich im
Olympischen Dorf gut vertragen, ein enges Beieinander beim Wettkampf aber
brächte vermutlich keiner Seite Gewinn. Auch dem Publikum nicht. Der Sinn ihrer
Betätigung und ihre Beziehung zum Publikum sind zu verschieden – sie leben nicht
auf demselben Stern und atmen nicht dieselbe Atmosphäre.
2. Ist
Schach Sport?
Auf einem
anderen Blatt steht die Frage, ob Schach Sport ist. Sie erledigt sich
natürlich nicht mit dem Verweis auf die DOSB-Definition. Mir gibt zu denken,
dass Lasker im erwähnten „Testament“ zu Schachfragen das Wort „Sport“ lediglich
im Kontext mit Athletik und einer Moskauer Örtlichkeit verwendet. Dennoch: Da
„Sport“ auch schlicht ein System von Wettkämpfen bedeutet, habe ich mich bisher
durchaus (auch) als „Schachsportler“ gefühlt und ansatzweise entsprechend
zu leben versucht.
Jacques
Mieses sah im Schach „nur dem Namen nach ein Spiel“: „in der Bedeutung seines
geistigen Inhalts ... erhebt es sich zur Höhe künstlerischer Betätigung.“ Er
begründete dies ähnlich wie Botwinnik im Essay „Ist Schach eine Kunst?“, die den
Gegenstand der (angenommenen) Schachkunst zu bestimmen suchte. Zugleich betonte
Mieses:
„Nun hat
das Schachspiel noch eine zweite Seite, und zwar eine solche, die mit der Kunst
gar nichts zu tun hat. Das Schach ist ein Kampfspiel; es gilt, einen Gegner zu
besiegen, und dieser Kampf muss natürlich durch gewisse Gesetze und Vorschriften
geregelt sein. Die Kämpfe der Schachmeister in der modernen Form der Turniere
und Matche haben daher notwendigerweise einen durchaus sportlichen Charakter
angenommen. Der Künstler kann arbeiten, wann und solange er dazu aufgelegt ist.
Der Schachmeister muß, gleichgiltig, ob in guter oder schlechter Verfassung, am
festgelegten Tag antreten und die ganze Partie hindurch in jeder Stunde eine
vorgeschriebene Anzahl von Zügen machen. Und wird er eher müde als sein Gegner,
so beweist dies nur, dass er weniger ,Stehvermögen’ als dieser besitzt, also
sportlich der Schwächere ist. Mit einem Wort: Das Schachspiel stellt eine
Vereinigung von Kunst und Geistessport dar.“ (Der hier zitierte, nach wie vor
aktuelle Artikel „Amateur und Berufsspieler im Schach“ ist nachlesbar bei H.
Wieteck: Meister Mieses. [...] Ludwigshafen 1993.)
Aus dieser
Sicht verdient Schach Sportförderung, und dies selbstverständlich auch
dann, wenn es seine eigene „Olympiade" behält.
3.
Müsste der Schachspieler gegnerische Stimulation fürchten?
Bleibt
noch die interessante Frage Robert Hübners: Muss ich es als unsportlich, als
Erschleichung eines unzulässigen Vorteils ansehen, wenn sich der Gegner in
möglichst gute Verfassung bringt? Er verneint die Frage, weil es ihm um die
Qualität der Partie zu tun ist und er aus ihr lernen möchte.
Ich stimme
ihm zu, vorausgesetzt, die benutzten Mittel und Verfahren dienen dauerhaft der
Gesundheit. Enhancer dürften kaum hierzu gehören. Wer sich’s leisten kann, nimmt
wie Kasparow Kaviar. Die Hauptsache ist freilich zurzeit, das Übel verbrauchter
Luft in Wettkampfstätten zu beenden. Wohlklimatisierte, augenfreundliche
Schach-Kulturhäuser in Deutschland, für Jung und Alt, Amateure wie
Berufsspieler, Mannschaftskämpfe und Turniere, für Außenstellen der
Schachakademie und für Foren zu Verbandsbeschlüssen – wäre das nicht eine Idee
fürs Krisenprogramm der Regierung?
Zum
Schluss ein Gruß von Leipzig nach Österreich. Vielleicht, liebe Frau Galambfaly,
wird dereinst ein Vermerk zu einem Partieabdruck an den Beginn des 21.
Jahrhunderts erinnern:
„Eine
immergrüne Partie, gespielt in Sperrejahren“.
Viel
Freude am Schach in kafkaesker Zeit! Das Spielen kann man ja niemandem
verbieten, und einer „Sauberen“ schon gar nicht!
Dr.
Gottfried Braun
Deutscher Seniorenmeister 1995
„Olympia mit Schach – Schach mit Dopingkontrollen?“ so betitelte
ich in SACHSENSPORT Nr. 02/2002 Teil 2 einer dreiteiligen Artikelserie in
Vorbereitung auf den Jubiläumskongress des DSB 125 Jahre nach dessen Gründung
1877 in Leipzig.
Doping im Schach hatte ich dabei eigentlich mehr als publikumswirksames Kuriosum
mit eingefügt, ohne im mindesten zu ahnen, dass es sich zu einem wirklich
ernsten Problem ausweiten könnte, noch nachdem alle Olympia-Illusionen zerstoben
sind. Letztere haben mit der Unterwerfung der FIDE unter die Doping-Regularien
des IOC für eine unliebsame Hinterlassenschaft gesorgt, die nunmehr zum
Störfaktor im normalen Spielbetriebsalltag zu werden droht.
Was die mögliche Wirksamkeit von „Hirndoping“ mittels Psychopharmaka angeht,
teile ich – auch in meinem besagten Artikel - den skeptischen Standpunkt von Dr.
Helmut Pfleger, der eine solche bezweifelt.
Mein heutiger Beitrag zum Thema zielt jedoch in eine ganz andere Richtung: Die
neuerdings immer wieder gern wiederholte Behauptung, ein wirksames Doping im
Schach sei während einer Schachpartie der unerlaubte Einsatz von Computern mit
leistungsfähigen Schachprogrammen bzw. der Zugriff auf deren Dateien, ist eine
oberflächliche Gedankenlosigkeit. Ein einmal in die Welt gesetzter Gedanke ist
bekanntlich nicht so leicht totzukriegen, wie falsch er auch sein möge.
Unerheblich ist dabei auch, wie prominent derjenige war oder ist, der dafür
verantwortlich zeichnet. Die Oberflächlichkeit besteht darin, das Mittel Doping
mit seinem gewünschten Zweck gleichzusetzen, der in einer unfairen (aber nicht
als solche erkennbaren!) Leistungssteigerung besteht.
Wohl ist es wahr, dass mit Computerhilfe während der Partie eine unfaire
Leistungssteigerung erzielt werden kann, aber Doping im Sinne der körperlichen
Eigenmanipulation wäre das längst noch nicht, sondern eben nur der Einsatz
unerlaubter Hilfsmittel! Oder wäre es etwa Doping, wenn ein Radsportler einen
miniaturisierten Hilfsmotor (z.B. auch noch mit einer unerschöpflichen
Atombatterie!) ins Tretlager seines Rennrades einbauen ließe, um steile Anstiege
besser bewältigen zu können? Oder wenn ein Hochspringer mit extrastarken und
künstlich federnden Schuhsohlen anträte, die einen spürbaren Zugewinn an
Sprunghöhe garantieren? Letzteres hat es schon gegeben, ebenso wie das verbotene
Vorheizen von Schlittenkufen, aber Doping wäre das alles eben nicht, wenn auch
im Wettkampf verboten, obschon als Trainingsgerät oder -methode nicht zu
verbieten! Genauso wie das Nachlesen in Schachbüchern während einer Partie schon
immer verboten war, zu Hause beim Training aber eher Pflicht ist.
Und hier komme ich zum Kern dieser Erkenntnis: Was im Sportwettkampf als Doping
verboten ist, ist dort auch im Training verboten, daher gibt es dort eben auch
Trainingskontrollen.
Wäre aber Computerhilfe Doping im Schach, müsste man es dann doch auch im
Training verbieten! Spätestens hier merkt doch wohl der letzte Leser, dass da
etwas aus dem Ruder zu laufen beginnt. Denn in der Endkonsequenz dieser absurden
Gedankenkette sollte dann wohl ChessBase seine Aktivitäten lieber ganz schnell
einstellen, ehe die Firma gar noch als vermeintliches oder mutmaßliches
Dopinglabor im Auftrag des Schachbundes von Staatsanwälten heimgesucht wird...
Für die Qualität des Weltschachs wäre dies zwar eine Katastrophe, aber nicht für
den IOC-Präsidenten und seine nationalen Erfüllungsgehilfen, sondern vielleicht
sogar ein weiterer Schritt in Richtung zum angestrebten „sauberen Sport“.
Die Klarstellung und gegenseitige Abgrenzung der Begriffe Doping, Einsatz
unerlaubter Hilfsmittel und unfaire Leistungssteigerung ist durchaus keine
Wortklauberei, sondern dient einem sehr praktischen Zweck. Auf die Frage von
Außenstehenden, ob es denn im Schach auch Doping gäbe, darf man als Schach- und
Sachkundiger eben nicht mit „Na ja, wenn...“ antworten, sondern wahrheitsgemäß
nur mit einem klaren „Nein! Gibt es nicht!“. Denn jegliches „Na ja, wenn ...“
oder auch „Ja, aber nur elektronisches Doping!“ würde doch nur die
Fortschreibung eines für den Schachsport gefährlichen Missverständnisses
bedeuten.
Solange es technisch noch nicht machbar ist, sich einen Mikrochip ins Hirn
implantieren zu lassen, der für starke Schachzüge sorgt, gibt es übrigens auch
noch kein „elektronisches Doping“ im Schach, möchte ich als Schlussbemerkung
noch anfügen.
Burkhard Starke
Herr Gerd Lorscheid schreibt: Man sollte mit den Dopingproben
bei den Senioren (WM) beginnen. Entweder ist dieser Herr ein Spaßvogel oder er
meint das ernst, dann ist sein Zynismus der älteren Generation gegenüber
unerträglich. Ich kenne keinen Senior (Schachspieler) in meinem Freundeskreis,
der nicht gegen z.B.: Zucker, Cholesterin, Blutdruck ect. nicht irgendein
Medikament nehmen muss. Die würden dann alle wegen Dopings überführt u. könnten
dann ihr liebstes Hobby nicht mehr tätigen. Solchen Meinungen gehört ernstlich
widersprochen.
Allen die mit Freude Schach spielen wünsche ich ein
frohes Fest u. ein Prosit 2009 ohne Belästigung von Dopingjägern.
Hubert Koller
Mit einen Lächeln
auf dem Gesicht lese ich die ganzen Beträge zum Thema Doping und Schach.
Hexenjagd? Man weiss nicht ob man lachen oder weinen soll. Denn ich sehe das
Problem nicht, wenn doch keiner Dopingsubstanzen im Schach braucht, warum hat er
dann Angst vor Kontrollen? Schach will als Sport anerkannt werden, dann sollen
sich diese "Sportler" doch bitte auch als solche sehen und verstehen und nicht
sofort eine Extrawurst gebraten bekommen wollen!
Witzig finde ich
auch folgendens :
"Auch der Fall
Ivanchuk sei kurios. Der Ukrainer wurde zur Dopingkontrolle eingeladen, nachdem
er gerade eine Partie verloren hatte. "Was wollte man ihm beweisen?", fragt Gerd
Lorscheid."
Dann frag ich
einfach mal zurück wie viele Silber-, Bronze- oder "keine"- Medaillengewinner
schon gedopt erwischt wurden? Doping ist keine Sieggarantie, da hat der Herr
Lorscheid wohl was falsch verstanden.
Jonas Hoffmann
In diesem Punkt möchte ich
mich der Meinung von Ludger Keitlinghaus anschließen, und somit Dopingkontrollen
im Schach eindeutig befürworten. Nur weil im Schach bisher, zumindest konnte es
nicht nachgewiesen werden, kein Gebrauch davon gemacht wurde, ist diese Maßnahme
nicht sinnlos.
Das Beispiel Kramnik macht gesamte Problematik, auch hinsichtlich der Defintion
von Herrn Dr. Hübner deutlich. In der 5. Partie der WM 2008 unterläuft besagtem
Kramnik mit 29. Sxd4 ein für einen Spieler von 2700+ grober Rechenfehler, der
auch von einem Kramnik-Befürworter Jan Gustafsson, kritisiert wurde. Sollte
nicht nur dieser Fehler sondern auch die meisten Patzer von Spielern mit einer ELO-Zahl
über 2500 auf physische Schwächen zurückzuführen sein, so beweist dies zum
einen, dass hier Doping im Gegensatz zum Radsport nicht zur Anwendung kam, zum
anderen dass bei Schachspielern erhebliche physische Defizite bestehen (Laktat-Werte),
die zu Fehlern wie in der 5. Partie der WM 2008 führen. Anands Verlustpartie bei
der WM 2008 ist der gleichen Kategorie zuzuordnen.
Vergleicht man vor diesem Hintergrund den WM-Kampf 2008, mit nachfolgender
Vertragsauflösung Kramniks mit seinem Manager (vielleicht wegen Bonn als
Austragungsort), mit dem WM-Kampf Kramnik-Topalov, so muss hier unter
Hübnerschen Dopingdefinition (elektronisches Doping, sprich Zuhilfenahme von
Computern) der Fall vielleicht einer erneuten Betrachtung unterzogen werden.
Denn ist Bonn geriet Kramnik bereits nach 6 Partien mit 0:3 in Rückstand und
machte während des gesamten Wettkampfs einen nahezu hilflosen Eindruck, obwohl
von den meisten Experten ein ausgeglichener Wettkampf erwartet wurde. In Elista
gegen Topalov sah es hingegen ganz anders aus, da nahm Kramnik sogar einen
kampflosen Verlust in Kauf.
Deshalb komme ich zu dem Ergebnis, dass die physischen Aspekte im Schach eine
größere Beachtung verdienen sollten, auch wenn die meisten Schachspieler dies
bisher dies bisher verneinen werden. Hier liegt ein Potential brach das bisher
nicht ausgeschöpft wurde, obwohl der DSB dies in seinem RTP ausdrücklich
erwähnt, da dort von Ausgleichssport die Rede ist.
Vielleicht sollte man
statt Dopingproben die Laktate-Werte von Schachbundesligaspielern nehmen, und
diese mit Leistungssportlern anderer Sportarten vergleichen, damit jedem
deutlich wird, ´wie groß die physischen Defizite von Schachspielern gegenüber
anderen Sportlern sind.
R. Suntrup
Chemisches Doping mit kleinen Leistungssteigerungen mag
es geben. Natuerlich ist das reine Definitionssache, denn Kaffee kann ja auch
munter machen (Neurodoping im Sinne einer Intelligenzsteigerung halte ich
allerdings fuer Science-fiction; der Artikel in der SZ ist m.E. wenig
ueberzeugend und sagt eigentlich nur aus, dass viele Leute in Panik zu
Medikamenten greifen, weil sie offenbar ueberfordert sind). Aber wenn man den
verbietet, sollte man dann das Kopf-unter-den-Wasserhahn-halten bei Muedigkeit
als physikalisches Doping bezeichnen, etc.? Natuerlich ist das Problem Doping
eher fuer das Profischach interessant. Allerdings spielen ja z.B. bei
Open-Turnieren auch Amateure gegen Profis und Halbprofis, so dass das ganze
verschwimmt. Der Fall Allwermann hat mir schon grosse Sorge bereitet, denn es
mag ganz viele von ihm geben, die sich nicht so daemlich anstellen und demnach
auch nicht so leicht zu ueberfuehren sind. Jeder, der auch nur ein wenig vom
Schach versteht, weiss, dass das Betruegen mit Computern viel realistischer ist
als mit irgendwelchen dubiosen Mitteln, die zweifelhaften Nutzen haben, aber
moeglicherweise die Gesundheit beeintraechtigen. Hier muss man wohl in Zukunft
mehr kontrollieren, was die Schachspieler ziemlich nerven und folglich das
Schachspiel auf Turnierniveau weniger attraktiv machen wird. Ich sehe dazu keine
Alternative, leider ... Ansonsten, denke ich, hat Matthias Budzyn Recht mit
seinen Ausfuehrungen.
Naja, vielleicht bleibt ja zumindest das Blitzschach sauber; da hat man fuer
Betruegereien mir dem Rechner einfach keine Zeit.
Jan Schoepe
Schach
unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Sportarten, in denen körperliche
Leistungen gefragt sind. Die von der NADA praktizierten Dopingtests bei
Schachspielern sind deshalb vollkommen unsinnig und geradezu lächerlich.
Fehlendes
Schachverständnis kann man nicht durch die Einnahme von Medikamenten plötzlich
erlangen. Die einzige Form von Doping, die beim Schach unterbunden werden muß,
ist der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln (Schachprogrammen). Dafür aber
sind die NADA-Dopingtests nicht ausgelegt.
Christoph
Schroeder, Hamburg
Veröffentlichung am 26.12.2008:
"Schachbund am Scheideweg" - die Dopingdiskussion
Auch über die Weihnachtsfeiertage hat die
Diskussion um den ab 1.1.2009 vom Schachbund eingeführten Anti-Doping-Code der
NADA die Schachfreunde bewegt. Einige weitere Leserbrief wurden eingesandt, in
denen verschiedene Aspekte des Themas ganz unterschiedlich beurteilt werden.
Grob unterteilt kann man drei Lager ausmachen: Manche Schachfreunde sind davon
überzeugt, dass Doping auch im Schach möglich ist. Sie glauben, dass
"Intelligenzpillen" - derzeit auch ein Modethema in den Medien - auch im Schach
leistungsfördernd einsetzbar wären. Dopingkontrollen seien daher notwendig und
richtig. Eine andere Gruppe hält das für Unsinn und beurteilt die
Dopingkontrollen, die ja gerade nicht auf "Intelligenzpillen", sondern vor allem
die klassischen Aufbaumittel für Kraft- und Ausdauersportler testen, als
überflüssigen Eingriff in die Privatsphäre. Eine dritte Gruppe möchte in Ruhe
Schach spielen, ganz egal ob Schach nun Sport ist oder nicht. Mit seinem sehr
ausführlichen und Beitrag "Schachbund am Scheideweg" , den wir wegen seines
Umfangs extra als pdf-Datei zum Anklicken anbieten, bringt Harald Balló viele
neue Sachinformationen in die Diskussion ein. Als Mediziner und Präsident des
hessischen Schachbundes hat Dr. Balló sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt
und war an der Entscheidungsfindung des Deutschen Schachbundes zumindest am
Rande beteiligt. Dr. Balló weist daraufhin, dass es keinerlei Nachweis für die
Wirksamkeit von "Intelligenzpillen" oder "Konzentrationspillen" im Schach gibt.
An der Art der Durchsetzung des Beschlusses im DSB übt er z.T. scharfe Kritik
und hält den Beschluss selbst für eine "charakterlose Erfüllungspolitik" zum
Nachteil der Mitglieder des DSB. Stattdessen hätte der DSB die Sonderrolle des
Schach innerhalb der Sportbewegung herausstellen sollen.
"Schachbund am Scheideweg"...