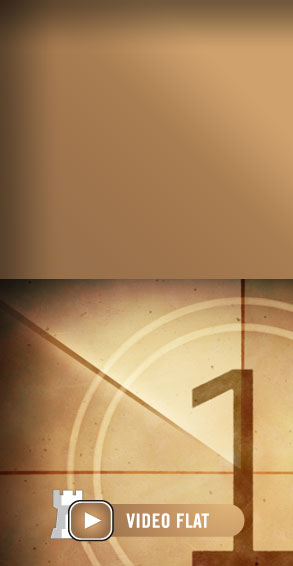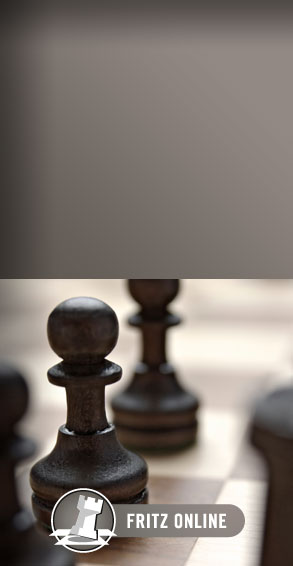Verdacht oder Verzweiflung
Nach 15 Partien lag Herausforderer Bobby Fischer beim Weltmeisterschaftskampf 1972 in Reykjavik gegen Boris Spassky weiter mit drei Punkten Vorsprung in Führung.

In Chess Life & Review vom Dezember 1972, S. 749, schrieb GM Svetozar Gligoric: "Als Spassky 1969 als Herausforderer Petrosians Titel holte, hatte er sich drei Monate lang vorbereitet. Beim Wettkampf gegen Fischer 1972 war er Titelverteidiger und bereitete sich acht Monate vor. Was sich hinter diesen Wochen harter Selbstdisziplin verbarg, wurde zu Beginn des Wettkampfs nicht ganz deutlich. Was ist passiert? Fischer vermied geschickt alle Varianten, die man von ihm erwarten konnte. Es gab keine vorbereitete Variante, die Spassky anwenden konnte. Denn Fischer spielte weder Grünfeld noch Königsindisch und mit Weiß hörte er sogar auf, mit seinem bis dahin so geliebten e-Bauern zu eröffnen. Der Titelverteidiger war in einer Wüste gelandet ohne zu wissen, in welche Richtung er gehen sollte..."
Minimale Vorteile
In Chess Life & Review vom Dezember 1972,Sp. 743, schreibt Robert Byrne über Partie 16:
 "Fischer entschied sich in der 16 Partie mit Weiß für das ruhige positionelle Fahrwasser der Barendregt-Variante im Abtauschspanier. Weiß schien dank des schwarzen Doppelbauern zunächst einen Endspielvorteil behaupten zu können, aber einmal mehr brachte Spassky eine interessante theoretische Neuerung, die ihm Gegenspiel brachte. Er erhielt einen Vorteil, der so minimal war, dass Fischer nicht davon abgehalten werden konnte, ein bekanntes Remis-Turmendspiel zu erzwingen, in dem ein weißer Bauer gegen zwei schwarze kämpfte.
"Fischer entschied sich in der 16 Partie mit Weiß für das ruhige positionelle Fahrwasser der Barendregt-Variante im Abtauschspanier. Weiß schien dank des schwarzen Doppelbauern zunächst einen Endspielvorteil behaupten zu können, aber einmal mehr brachte Spassky eine interessante theoretische Neuerung, die ihm Gegenspiel brachte. Er erhielt einen Vorteil, der so minimal war, dass Fischer nicht davon abgehalten werden konnte, ein bekanntes Remis-Turmendspiel zu erzwingen, in dem ein weißer Bauer gegen zwei schwarze kämpfte.
Die Partie hätte bereits im 24. Zug Remis gegeben werden können, aber Boris, der sich vielleicht darüber ärgerte, dass Bobby ihn gezwungen hatte, in der vorherigen Partie zur Wiederaufnahme der Hängepartie zu erscheinen, um sich die paar offensichtlichen Züge des Dauerschachs zeigen zu lassen, bestand darauf, das Spiel bis zum 60. Zug fortzusetzen. Tatsächlich wartete er, bis Bobby bereit war, den Abgabezug in den Umschlag zu stecken, bevor er Remis anbot."

[Event "Reykjavik World Championship (16)"] [Site "Reykjavik"] [Date "1972.08.20"] [Round "16"] [White "Fischer, Robert James"] [Black "Spassky, Boris Vasilievich"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C69"] [WhiteElo "2785"] [BlackElo "2660"] [Annotator "Byrne,Robert"] [PlyCount "120"] [EventDate "1972.07.11"] [EventType "match"] [EventRounds "21"] [EventCountry "ISL"] [SourceTitle "MainBase"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1999.07.01"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 {After all the violence of the previous game, Fischer is probably content to head for the tranquil channels of the Exchange Variation, the main theme of which is the exploitation of Black's doubled pawns in an endgame.} dxc6 5. O-O {The opening comes as no surprise to Spassky.} ({Almost a century ago, then World Champion Emanuel Lasker used to force the endgame immediately by} 5. d4 exd4 6. Qxd4 Qxd4 7. Nxd4 {In the last six years Fischer has preferred the Barendregt idea of castling first in order to give the plan potency by mobilizing a Rook.}) 5... f6 6. d4 Bg4 7. dxe5 Qxd1 8. Rxd1 fxe5 9. Rd3 {The Rook is somewhat awkwardly placed here, but White cannot work up any initiative as long as the King Knight remains pinned.} Bd6 10. Nbd2 Nf6 11. Nc4 {By this maneuver Fischer intends to exchange one of Black's strong Bishops, the chief feature of the defense.} Nxe4 12. Ncxe5 { Fischer improves on Bronstein's 12.Nfxe5, forcing Black to yield the Bishop pair at once without any repair of the doubled pawns.} Bxf3 ({Spassky Is unable to dispute the point by} 12... Bf5 $2 {since} 13. g4 $1 Be6 14. Re3 Nf6 15. Ng5 {leads to a decisive loss of material for Black.}) 13. Nxf3 O-O 14. Be3 {It looks now as though Fischer has everything that could be expected out of this type of opening. The White Kingside pawn majority is a clear advantage because the three pawns on the other wing are normally enough to blockade the Black pawn preponderance there, which are crippled by doubled pawns. And Fischer has eliminated the Queens and two sets of minor pieces, creating the simplified position in which such a structural superiority can be utilized.} b5 $1 {Striking back in an original and ingenious way, Spassky intends to throw the Queenside pawns forward, gaining space and putting on pressure to undouble the c-pawns.} 15. c4 $2 {Blocking with the c-pawn is the thematic way to counter such a plan, of course, but Spassky quickly proves it tactically unsound.} ({Best was} 15. Nd2 {for if} Nxd2 ({the retreat} 15... Nf6 {would permit a piece blockade with} 16. Nb3 {followed by either Nc5 or Bc5.}) ({ Spassky could have obtained considerable activity for his Bishop and Rooks by} 15... Nc5 16. Bxc5 ({not} 16. Rc3) 16... Bxc5 17. Ne4 Bb6 18. Re1 Rae8 19. Kf1 {and a fascinating struggle between dynamics and structure would have begun.}) 16. Rxd2 c5 17. c4 {would set up the blockade White wants.}) 15... Rab8 $1 { An unusual and strong continuation of the idea of his previous move by which White is saddled with the awkward task of finding a smooth defense for both the c and b-pawns.} 16. Rc1 {[#]Fischer's decision is to sacrifice a pawn, hoping to recover it later with positional advantage.} ({In any case, Black could not be denied effective counterplay, for if} 16. b3 Ba3 ({in order to answer} 16... bxc4 {by} 17. Rd4 $1) 17. Rd7 ({Perhaps} 17. Rad1 {is best:} bxc4 18. bxc4 Bd6 19. Rb3 Rxb3 20. axb3 Rb8 21. Rd3 a5 22. g3 {when the result will be a draw.}) 17... bxc4 18. bxc4 Bd6 $1 19. Bd4 Nf6 20. Bxf6 Rxf6 {and in the resulting position 21.c5 will free the Rook, but Black's strong Bishop gives him the endgame edge. Furthermore, the Black Rooks have such threats as R-e6-e7 and R-b4-a4 with great pressure.}) 16... bxc4 17. Rd4 ({If} 17. Rxc4 Rxb2 {and the Knight cannot be captured because of the threatening mate.}) 17... Rfe8 18. Nd2 (18. Rc2 c3 $1 19. bxc3 Rb1+ 20. Bc1 Ng5 $1 21. Rd1 Nxf3+ 22. gxf3 {gives Black the initiative and a clear advantage.}) 18... Nxd2 19. Rxd2 Re4 20. g3 {By removing backrank mate threats and preparing to bring his King strongly into play, Bobby ensures the draw.} Be5 21. Rcc2 Kf7 22. Kg2 Rxb2 $1 23. Kf3 ({The gain of a second pawn is only temporary.} 23. Rxb2 {is answered by} c3) 23... c3 24. Kxe4 cxd2 25. Rxd2 Rb5 {It is possible that White would be better after the exchange of Rooks, despite the pawn minus, because Black's extra pawn is doubled and weak. Spassky's move returns the pawn for a minute positional advantage.} 26. Rc2 Bd6 27. Rxc6 Ra5 28. Bf4 $1 { Fischer wisely sacrifices a pawn to bring about a standard drawn Rook-and-pawn ending,} ({because if} 28. Rc2 Ke6 {followed by ...Ra4+ would give White trouble.}) 28... Ra4+ 29. Kf3 Ra3+ 30. Ke4 Rxa2 31. Bxd6 cxd6 32. Rxd6 Rxf2 33. Rxa6 Rxh2 34. Kf3 {Now the game could have been given up as a draw, but since Fischer insists on playing everything out, Spassky decides to do the same today. Throughout the next 26 moves there was some tittering in the audience, which seemed amused at the spectacle of the two chess giants fooling around with an elementary position, like Frank Lloyd Wright playing in a sandbox.} Rd2 35. Ra7+ Kf6 36. Ra6+ Ke7 37. Ra7+ Rd7 38. Ra2 Ke6 39. Kg2 Re7 40. Kh3 Kf6 41. Ra6+ Re6 42. Ra5 h6 43. Ra2 Kf5 44. Rf2+ Kg5 45. Rf7 g6 46. Rf4 h5 47. Rf3 Rf6 48. Ra3 Re6 49. Rf3 Re4 50. Ra3 Kh6 51. Ra6 Re5 52. Kh4 Re4+ 53. Kh3 Re7 54. Kh4 Re5 55. Rb6 Kg7 56. Rb4 Kh6 57. Rb6 Re1 58. Kh3 Rh1+ 59. Kg2 Ra1 60. Kh3 Ra4 1/2-1/2
Partie 17 endet mit Zugwiederholung
In Chess Life & Review schreibt Robert Byrne:
"Fischer überraschte in der 17. Partie einmal mehr, indem er sich das erste Mal in seiner Karriere mit der Pirc-Robatsch-Variante verteidigte, der er immer schweren Schaden zugefügt hatte, wenn er mit Weiß spielte. Spassky, der unternehmungslustig gestimmt war, setzte mit einem gefährlichen Bauernopfer energisch fort und nahm die gegnerische Königstellung mit zwei starken Läufer ins Visier. Obwohl nicht klar war, ob der weiße Angriff zum Erfolg führen würde, entschied sich Fischer für ein Qualitätsopfer, um in ein Remisendspiel abzuwickeln. Doch wenn eine Seite Chancen hatte, zu gewinnen, dann war es Weiß, und deshalb kam es überraschend, dass sich Spassky kurz nach Wiederaufnahme der Hängepartie auf eine dreimalige Stellungswiederholung einließ. Hatte er die Zugwiederholung übersehen oder hatte er dem Remis bewusst zugestimmt? Ich kann nur sagen, dass er unglücklich aussah, als Hauptschiedsrichter Lothar Schmid die Zugwiederholung und das Remis bestätigte. Doch der Schaden war gering, denn Fischer hätte die Partie auch so ohne große Mühe Remis gehalten."
Hier ist die 17. Partie mit dem gekürzten Kommentar von Robert Byrne:

[Event "Reykjavik World Championship (17)"] [Site "Reykjavik"] [Date "1972.08.22"] [Round "17"] [White "Spassky, Boris Vasilievich"] [Black "Fischer, Robert James"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B09"] [WhiteElo "2660"] [BlackElo "2785"] [Annotator "Byrne,Robert"] [PlyCount "89"] [EventDate "1972.07.11"] [EventType "match"] [EventRounds "21"] [EventCountry "ISL"] [SourceTitle "MainBase"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1999.07.01"] 1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Nf6 4. f4 {In the past Spassky has usually preferred the quieter, more positional 4.Nf3 to the ambitious text move.} Bg7 5. Nf3 c5 { This move has long been considered dubious, although the present game may challenge that opinion.} ({By far the most popular continuation here is} 5... O-O 6. Bd3 Nc6 {which has held its own despite persistant attempts at refutation.}) 6. dxc5 Qa5 (6... dxc5 $2 7. Qxd8+ Kxd8 8. e5 {give White an all but decisive endgame advantage.}) 7. Bd3 ({White cannot reply} 7. cxd6 { because of the terrific counterplay resulting from} Nxe4) 7... Qxc5 8. Qe2 O-O 9. Be3 Qa5 {[#]} ({White can win a pawn by} 9... Qb4 $6 {since} 10. O-O-O $2 ({ However} 10. O-O Qxb2 11. Nb5 Ne8 12. e5 Qb4 13. Nxa7 {gets it back with advantage.}) 10... Nxe4 $1 11. Bxe4 Bxc3 12. bxc3 Qxe4 {is a lost game for White.}) 10. O-O Bg4 {This idea of Fischer's must be the best Black has, for the Bishop would be inoperative at d7, and at e6 just asking for f5.} 11. Rad1 $5 {Spassky is already getting set for a disputable pawn sacrifice,} ({but the simple} 11. a3 Bxf3 12. Qxf3 {guarantees White a small edge.}) 11... Nc6 12. Bc4 Nh5 $1 {While running after a pqwn this way involves great risk, it really cannot be avioded, since a quiet continuation would only allow White to build up his Kingside attach at no cost at all.} 13. Bb3 Bxc3 14. bxc3 Qxc3 15. f5 Nf6 {[#]It's no secret that Spassky has dangerous attacking chances with two powerful Bishops bearing down on the Black King position and the possibility of opening the f-file for his Rooks as well.} 16. h3 Bxf3 17. Qxf3 Na5 18. Rd3 Qc7 19. Bh6 Nxb3 20. cxb3 ({All that} 20. Bxf8 $2 {would accomplish is simplification useful for Black after} Nc5 21. Bh6 Nxd3) 20... Qc5+ 21. Kh1 Qe5 $6 {[#]There is some risk of Black losing now because he gets only one pawn for the Exchange in the coming endgame.} 22. Bxf8 Rxf8 23. Re3 Rc8 24. fxg6 $2 {It was better to leave the f-pawn on the board and play Qf4 at once. Then it might be possible to operate with some threat of f6 in the endgame which comes up in five moves.} hxg6 25. Qf4 {There is no longer any reason for White to maintain a middle game situation, since his pieces are tied down to the defense of the e-pawn, while Fischer has the only open file.} Qxf4 26. Rxf4 Nd7 27. Rf2 Ne5 28. Kh2 Rc1 29. Ree2 Nc6 {It was absolutely vital to seal the c-file this way so the White Rooks are denied play.} 30. Rc2 Re1 {The exchange of Rooks would lose for Black since the Knight then becomes a totally passive file blockader which can soon be driven out of the way by P-b4-b5. If Black brought his King to d7 to hold the seventh and eighth ranks, the passed pawn White could get by h4, g4 and h5 would decide.} 31. Rfe2 Ra1 32. Kg3 Kg7 33. Rcd2 Rf1 34. Rf2 Re1 35. Rfe2 Rf1 36. Re3 a6 {Fischer rules out the idea of R-d5-b5.} 37. Rc3 Re1 38. Rc4 Rf1 39. Rdc2 Ra1 40. Rf2 Re1 41. Rfc2 g5 42. Rc1 Re2 43. R1c2 Re1 44. Rc1 Re2 45. R1c2 {Fischer claimed the threefold repeti-tion of position that comes about after 45...Re1. If the repetition was not a nervous-tension error by Spassky, why did he not at least try a3 and b4, with the plan of a break at b5? Even if the active Black Rook could thwart the idea, it was worth a try.} 1/2-1/2
In der Zeitschrift New in Chess 06/2012, schilderte GM Lubomir Kavalek, der in Reykjavik erst als Journalist und in der zweiten Hälfte des Wettkampfs als Sekundant von Fischer vor Ort war, was während der Hängepartie geschah: "In Partie 17 opferte Bobby eine Qualität, aber konnte eine Festung errichten. Spasskys einzige Möglichkeit, auf Gewinn zu spielen, bestand darin, die Qualität zurückzugeben, um ins Turmendspiel abzuwickeln. ‘Der einzige Weg, dieses Endspiel zu beurteilen, besteht darin, es zuzulassen,’ erklärte Bobby zu Beginn unserer Analyse. Rasch bewegte er die Figuren auf dem Schachbrett und die schwerfälligen Türme wurden auf einmal leichtfüßig. Irgendwann dachte ich, dass der schwarze Turm hinter die weißen Bauern gehen sollte. ‘Nein,’ sagte er ohne zu zögern, ‘der Turm muss sie von der Seite angreifen. Ich weiß das.’ Manche Spieler berechnen Endspiele, andere vertrauen ihrem Instinkt. Bobby wusste, was zu tun war."
Etwa um diese Zeit kam Nikolai Krogius, der Leiter von Spasskys Delegation, zu dem Schluss, dass sich Spassky Sekundant Ivo Nei merkwürdig verhielt und viel Zeit allein mit GM Robert Byrne verbrachte. In dem Bobby Fischer Goes to War von David Edmonds und John Eidinow wird die Situation wie folgt beschrieben:
Nei wurde strengen Befragungen unterzogen. Er leugnete seine Kontakte zu Byrne nicht, dass er und der Amerikaner den Wettkampf analysieren würden, und dass er Byrne seine Anmerkungen zu den Partien übergeben würde, damit sie später in den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden könnten.

Seine skeptischen Zuhörer bedrängten Nei weiter: “Warum widmete er sich einer zusätzlichen Arbeit solch verdächtiger Natur, und heimlich, ohne Spasskys Erlaubnis? Und was hatte er in dem Material, das er dem Amerikaner übergeben hatte, bislang über Spasskys Verfassung und Spasskys Schach gesagt?” Neis Antworten reichten ihnen nicht aus. Die Unterhaltung wurde extrem erhitzt. Nei wurde gesagt, dass seine Dienste nicht länger benötigt würden, und dass er gehen müsste.
Am Tag darauf [Partie 17, am 22. August 1972] verließ der Este Reykjavik per Flugzeug. Nei meinte, viele Leute in der Schachwelt wären über seine Rückkehr nach Estland überrascht gewesen; sie hatten geglaubt, er würde in Siberien oder im Westen landen. Aber, so fragt er, warum? Er hatte sich nicht inkorrekt verhalten. Aus Tallinn schickte er seine weiteren Beiträge zu dem Buch in die Staaten, in sieben Teilen. Ein wenig unwohl muss ihm bei dem Projekt doch gewesen sein: denn jeden einzelnen dieser Abschnitte schickte er an eine andere Adresse in Kanada und auch in den Vereinigten Staaten.
Später wurde daraus das Buch Both Sides of the Chessboard von Robert Byrne and Ivo Nei (rechts ein Abbild des Covers).
Partie 18
In Chess Life & Review vom Januar 1973 setzte GM Robert Byrne seine Serie über den Wettkampf des Jahrhunderts fort. Auf Seite 17 erzählt er, was nach Partie 17 geschehen ist, und schreibt: "Verdoppelte Anstrengungen von Boris Spassky, den Vorsprung des Herausforderers um einen Punkt zu verkürzen, führten im nächsten Abschnitt des Wettkampfs zu brillantem, hart umkämpftem Schach, wobei Fischer dem Sieg allmählich immer näher kam, nachdem die Partien 18, 19 und 20 alle mit Remis endeten. War Bobby zufrieden damit, sich mit Punkteteilungen zum Titel zu schleichen? Ich glaube nicht—das war nie sein Stil. Ich glaube, die Erklärung für die Remispartien lässt sich in Spasskys Verbesserungen seiner Eröffnungen finden. In den Partien 18 und 20 kehrte Boris zum Sizilianer zurück, der in Partie 4 so gut für ihn funktioniert hatte. Die 18. Begegnung war ein großer Kampf, in dem die Chancen von Schwarz nie schlechter waren als die von Weiß."
In New in Chess 6/2012 schrieb GM Lubomir Kavalek: "Bobby war vom Gewinnen besessen und nicht zufrieden, bis er alle Möglichkeiten erschöpft hatte. Das wurde deutlich, als wir die Stellung analysierten, in der die 18. Partie abgebrochen worden war. Wir erkannten bald, dass jeder Gewinnversuch zum Scheitern verdammt war. Die Chancen lagen stets auf Seiten Spasskys, aber konnte Boris tatsächlich gewinnen? Bobbys leuchteten, als ich ein Damenmanöver vorschlug, das Spassky zur Zugwiederholung zwang. ‘Phantastisch! Wir haben ein Remis. Suchen wir noch einmal nach einem Gewinn,’ und dann haben wir noch einmal vier Stunden damit verbracht, nach etwas zu suchen, das nicht da war. Für einen einzigen Sieg konnte Bobby bis zur Erschöpfung arbeiten."

[Event "Reykjavik World Championship (18)"] [Site "Reykjavik"] [Date "1972.08.24"] [Round "18"] [White "Fischer, Robert James"] [Black "Spassky, Boris Vasilievich"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B69"] [WhiteElo "2785"] [BlackElo "2660"] [Annotator "Byrne,Robert"] [PlyCount "94"] [EventDate "1972.07.11"] [EventType "match"] [EventRounds "21"] [EventCountry "ISL"] [SourceTitle "MainBase"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1999.07.01"] 1. e4 {From game 14 on to the end of the match Bobby sticks to 1.e4, perhaps feeling that 1.d4 has used up its surprise value.} c5 {Boris has never liked the aggressive Sicilian, but in this and the other two games of this match in which he played it, he does so well that it may become the defense of his future.} 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nc6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nf6 6. Bg5 {Outside of 6.Bc4, which Spassky countered strongly in game 4, this is the most ambitious move to put Black under pressure.} ({After the tame} 6. Be2 e5 {Black has little trouble getting an acceptable game.}) 6... e6 7. Qd2 a6 8. O-O-O Bd7 9. f4 Be7 10. Nf3 {Some may has to be sought to breach Black's solid position; this move threatens e5. In game 20, Fischer tries 10.Be2, but without success.} b5 { The only good reply.} 11. Bxf6 {Having come so far, this is the only alternative to create sharp play, since the immediate 11.Bd3 has never proven to yield White anything.} ({The move 10...b5 intends} 11. e5 b4 12. exf6 bxc3 13. Qxc3 gxf6 14. Bh4 {reaching a position in which Black relies on his preponderance in the center to make up for his slighly uncomfortable King situation. Boris's heading for it and Bobby's avoidance of it by his next move indicate they are unanimous in the judgment that Black's chances are fully adequate.}) 11... gxf6 ({Had Fischer been expecting Spassky to venture Simagin's gambit,} 11... Bxf6 $6 12. Qxd6 Be7 13. Qd2 b4 14. Na4 Ra7 {–? While there is a considerable amount of play in it, its soundness is still questionable. By his recapture, Spassky enters into an old line of the defense which has long been considered inferior, but which may get a new lease on life as a result of this game.}) 12. Bd3 {This move has little force. White's only correct idea must be to aim at exploiting the doubled pawns by g3, Bh3, f5, etc., with the intention of forcing ...e5, so that the d5 square can be occupied. Mikhail Tal won a fine game from me in that manner in the Varna Olympiad, 1962.} Qa5 13. Kb1 b4 14. Ne2 Qc5 {Spassky makes room for the advance of his a-pawn to break open a file for attack on the enemy King, a far better plan than 0-0-0, which constricts Black's own counterplay.} 15. f5 { Such a pawn sacrifice is routine in proceeding against the doubled pawns,} a5 ( {Acceptance by} 15... exf5 $2 16. exf5 Bxf5 17. Bxf5 Qxf5 18. Nf4 {followed by Nd5, fatally wrecks both Black's pawn position and the defense of his King.}) 16. Nf4 a4 17. Rc1 {Measures must be taken against ...b3, while Fischer looks toward using the QB his for his own benefit. It is difficult to suggest an alternative.} Rb8 18. c3 {While Spassky was not yet threatening ...b3, it is impossible for White to go ahead with any plans without securing his King position first.} b3 ({Fridrik Olafsson criticized the blocking of the Queenside, recommending instead} 18... Ne5 {However, after} 19. Nd4 bxc3 20. Qxc3 Qxc3 21. Rxc3 Nxd3 22. Nxd3 {tha game is about even. The more ambitious text move confines the White King to the first rank and, later on. gives Black dangerous opportunities to work with mate threats when only Rooks and Queens remain.}) 19. a3 Ne5 20. Rhf1 ({The attempt to go all out against Black's weak e6 square would not succeed, for} 20. fxe6 fxe6 21. Nd4 Kf7 ({The sacrifice line} 21... Nc4 22. Qe2 Nxa3+ {is not sound:} 23. bxa3 Qxa3 24. Nfxe6 { threatening Qh5 mate} Bxe6 25. Nxe6 b2 26. Bb5+ Kf7 27. Qh5+ $1 Kg8 (27... Kxe6 28. Qd5#) 28. Rcf1 Qa1+ 29. Kc2 Qa2 30. Kd3 {and White wins since} ({Actually} 30. Qg4+ {forces mate:} Kf7 31. Qg7+ Kxe6 32. Rxf6+ Bxf6 33. Qd7+ Ke5 34. Qf5# {–ed.}) 30... Qxe6 {is answered by} 31. Bc4) 22. Be2 Ng6 $1 {keeps everything well defended.}) 20... Nc4 21. Bxc4 Qxc4 22. Rce1 Kd8 {Removing the King from the center is a good idea and the destination c7 is the safest on the board.} 23. Ka1 $6 {It is dangerous to take the King so far into the corner, because in the event of simplification and a heavy-piece ending, Black could operate with back-rank mate threats.} ({The alternative would be} 23. g4 {when White could plan Nh5 to put pressure directly on the doubled pawns.}) 23... Rb5 {The fourth rank is a good place for the Rook since it may be convenient to defend the e-pawn by ...Re5 if the Queens are exchanged.} 24. Nd4 Ra5 25. Nd3 Kc7 26. Nb4 h5 {Q-h6-g7 was an annoying threat.} 27. g3 Re5 (27... h4 {can be answered by} 28. g4 {It is very difficult for either side to make progress in this involved position.}) 28. Nd3 Rb8 $5 {It is not entirely clear that this Exchange sacrifice is sound.} 29. Qe2 {Now as long as White can get rid of the Queens too, grabbing the Exchange bceomes a serious possibility.} ({ White would have his hands full of problems after} 29. fxe6 fxe6 30. Nxe5 dxe5 31. Nf3 {The King pawn is vulnerable, the central Black pawn mass controls a great number of important squares, making it hard for White to maneuver his pieces, and White must be on guard every moment against the possible sacrifice, ...Bxa3 ...b2+, etc. The main trouble is that Fischer cannot be compelled to take the Rook.}) 29... Ra5 30. fxe6 $6 {Something had to be done about the threat, 30...e5 31.Nf3, d5, but undoubling the pawns gets White into trouble.} ({Correct was} 30. Nb4 {and if} Qxe2 31. Nxe2 $1 {and White menaces Nf4.}) 30... fxe6 31. Rf2 $2 {Fischer is letting himself in for more than either player realizes; Nb4 or Nf4 had to be played.} e5 $1 32. Nf5 Bxf5 33. Rxf5 d5 $1 34. exd5 {[#]} Qxd5 $2 {Spassky has just engineered a fine break in the center and now muffs it!} ({After} 34... Rd8 {White is hard put for a defense:} 35. Nf4 Qxe2 36. Rxe2 Kd6 37. Nxh5 Rxd5 38. Rf1 Kc7 39. Ree1 Rd2 40. h4 { gives Black a draw by} Bxa3 41. bxa3 Ra2+ 42. Kb1 Rdd2 {but he should decline it and play for a win, since White is all tied up guarding against back-rank mates. Readying the advance of the e-pawn to the queening square is the idea.}) 35. Nb4 Qd7 36. Rxh5 $2 {Now it's Fischer's turn to blow his chance!} (36. Qc4+ $1 Kb6 37. Rxh5 Rd8 38. Rb1 Bxb4 39. Qxb4+ Rb5 40. Qh4 $1 Qd3 41. Qxf6+ Ka5 42. Qg5 {while fraught with dangers at every turn, could well be tried by a player hot after the point.}) 36... Bxb4 {Naturally the terrifically strong Knight cannot be permitted to remain on the board, and besides, Bobby was threatening Rh7, with a decisive pin.} 37. cxb4 Rd5 {The back-rank mate threats give Black the edge in this position, although Fischer demonstrates that White can just hold on.} 38. Rc1+ Kb7 39. Qe4 Rc8 $1 {Spassky wants to give his Queen in return for mate.} 40. Rb1 (40. Rxc8 Kxc8 41. Rh8+ Kc7 42. Rh7 Rd1+) ({Quite useless is the pin} 40. Rd1 {since the Black King can simply step out of it and nothing can be won.}) 40... Kb6 41. Rh7 Rd4 $1 {Even though he is a pawn down the Rook ending following the exchange of Queens is in Spassky's favor, once again because of the abysmal position of the White King. That holds true regardless of whether there are two or four Rooks remaining.} 42. Qg6 Qc6 43. Rf7 Rd6 44. Qh6 $1 {Now Spassky is tied down to the defense of the f-pawn and cannot shake free to do any mating.} Qf3 ({He also has to be on guard against} 44... -- 45. Qe3+ Rd4 46. Qf2 {winning.}) 45. Qh7 Qc6 ({Of course} 45... Rd1 { fails against} 46. Rxf6+) 46. Qh6 Qf3 47. Qh7 Qc6 1/2-1/2
Beleuchtung und Stühle – der Verdacht der Manipulation
Das Buch Bobby Fischer Goes to War (dt: Wie Bobby Fischer den Kalten Krieg gewann) von David Edmonds und John Eidinow, das 2004 bei Harper Collins erschien, beschreibt die Stimmung, die im sowjetischen Lager zu diesem Zeitpunkt des Wettkampfs herrschte:
 In Moskau hatte man Ende Juli große Sorgen über Spasskys Leistung... Der Vorschlag taucht auf, dem Weltmeister Kogitum zu schicken—ein Mittel gegen nervöse Anspannung—und es herrscht eine gewisse Verzweiflung nach seiner Weigerung, es zu nehmen. Ein Bericht, der den KGB erreicht haben soll, behauptete, dass Fischer Hilfe von einem Computer (im Russischen IBM genannt—ein sowjetischer Tribut an die amerikanische Geschäftswelt) und einer Apparatur in seinem Sessel erhielt. In der westlichen Presse hatte es bereits Berichte gegeben, dass Fischer Computerhilfe erhielt, Berichte, die in Reykjavik von Spassky, Geller und Krogius spöttisch zurückgewiesen worden waren. Auch in Moskau glaubt der KGB nicht, dass silizium-basierter Unfug besonders praktikabel wäre. Ein Genosse Lvov, ein technischer Offizier des KGB, erklärt dem stellvertretenden Minister, dass Fischer ein ganzes Jahr benötigt haben würde, um das entsprechende Computerprogramm zu entwickeln und ein tragbaren Empfänger und eine Membran in seinem Ohr haben müsste, um die Signale zu empfangen.
In Moskau hatte man Ende Juli große Sorgen über Spasskys Leistung... Der Vorschlag taucht auf, dem Weltmeister Kogitum zu schicken—ein Mittel gegen nervöse Anspannung—und es herrscht eine gewisse Verzweiflung nach seiner Weigerung, es zu nehmen. Ein Bericht, der den KGB erreicht haben soll, behauptete, dass Fischer Hilfe von einem Computer (im Russischen IBM genannt—ein sowjetischer Tribut an die amerikanische Geschäftswelt) und einer Apparatur in seinem Sessel erhielt. In der westlichen Presse hatte es bereits Berichte gegeben, dass Fischer Computerhilfe erhielt, Berichte, die in Reykjavik von Spassky, Geller und Krogius spöttisch zurückgewiesen worden waren. Auch in Moskau glaubt der KGB nicht, dass silizium-basierter Unfug besonders praktikabel wäre. Ein Genosse Lvov, ein technischer Offizier des KGB, erklärt dem stellvertretenden Minister, dass Fischer ein ganzes Jahr benötigt haben würde, um das entsprechende Computerprogramm zu entwickeln und ein tragbaren Empfänger und eine Membran in seinem Ohr haben müsste, um die Signale zu empfangen.
Lvov ist auch der Überbringer anderer dubioser Nachrichten: er berichtet, es sei möglich, dass Spassky einen Brief erhalten haben könnte, der seine Familie bedroht, falls er als Wettkampfsieger nach Moskau zurückkehrt. Das wird untersucht, aber keinen Beweis für die Existenz dieses Briefes wird gefunden. Der Ursprung dieses Briefes ist unklar; heute sagt Spassky, er hätte davon keine Kenntnis gehabt.
Andere Mittel Spassky zu unterstützen, werden in die Wege geleitet. Während der Juli zum August wird, nimmt ein ungenannter forensischer Psychiater an einem Treffen mit Lvov und Gostiev teil. Lvov ist fest entschlossen, "vor Ort" — vermutlich im Spielsaal, einen Test durchführen zu lassen, um Funkwellen und Röntgenstrahlen aufzuspüren.

Die ganze Zeit über wird auch die Möglichkeit diskutiert, dass Spassky Ziel von Hypnose und Telepathie sein könnte. Es gibt einen Hinweis, einen Psychiater nach Reykjavik zu schicken... Dann gibt es Aufregung wegen Spasskys Erfrischungsgetränken—am 15. August hätte er Saft getrunken und sei danach von Müdigkeit überwältigt worden... Eine Probe wird nach Moskau geschickt. KGB-Wissenschaftler analysieren die Problem — nichts Verdächtiges wurde gefunden.
Aber der KGB begnügt sich nicht damit, eine rein reagierende Rolle zu spielen. Die Vorstellung der Organisation, hilfreich zu sein, umfasst auch das Ergreifen der Initiative, und sie setzen selber ein Gerücht in die Welt, dass Fischer mit einem Hilfsmittel, das in seinem Sessel versteckt ist, betrügen könnte—einem Hilfsmittel, so das Gerücht, das Spasskys Spiel schadet und/oder Fischer zugute kommt.
In seinem Bericht für die New York Times vom 25. August — der am 24. August, als die 18. Partie noch Hängepartie war — schrieb Harold Schonberg:
Vor ein paar Stunden wurden heute zwei isländische Wissenschaftler in den Spielsaal gebracht, um die Vorwürfe elektronischer und chemischer Trickserei zu untersuchen, die gestern durch Efim Geller von der sowjetischen Delegation erhoben worden sind... Sigmundur Gudbjarnason, ein Chemieprofessor, und Dadi Augustin, ein Elektroingenieur, wurden gebeten, den Saal zu überprüfen. Mr. Augustin führte eine Sicht- und eine technische Untersuchung der Beleuchtung durch, die Geller Verdacht hatte schöpfen lassen, und das Einzige, was er fand, waren zwei tote Fliegen. Er kam zu dem Schluss, dass die Beleuchtung nicht manipuliert worden war.
Mr. Augustin brachte Geräte für einen Röntgentest auf die Bühne, und machte Fotos der Sessel, vor allem von Fischers. Geller hatte sich gefragt, warum Fischer immer auf seinem eigenen Sessel bestand. Nach dem Röntgentest konnte Mr. Augustin bezeugen, dass Fischers Sessel in jeder Hinsicht identisch mit dem von Spassky wäre. Weder in dem einen noch in dem anderen Sessel befinde sich irgendetwas Ungewöhnliches.
Nachdem er Abschabungen auf beiden Sessels einer chemischen und einer chromatographischen Analyse unterzogen hatte, kam Mr. Gudbjarnason zu dem Schluss, dass in den Körperpartikeln beider Spieler keine Fremdkörper oder giftige Chemikalien vorhanden waren. Als die chemischen und elektronischen Untersuchungen durchgeführt wurden, war kein Russe zugegen, aber Donald Schultz von der Delegation der Vereinigten Staaten war vor Ort.

Anzeige in Chess Life and Review
In Bobby Fischer Goes to War schreiben David Edmonds und John Eidinow:
Es bleibt eine offene Frage, ob ein KGB-Spion irgendetwas in Fischers Sessel deponiert hat, das die Röntgenstrahlen entdecken sollten, als Teil eines ungeschickten Versuchs, den Ruf des Titelverteidigers zu retten, oder sogar, um Fischer in Misskredit geraten und ihn zu disqualifizieren lassen. Überraschenderweise ist sogar der Amerikaner Don Schultz, von Beruf IBM-Ingenieur und von 1996 bis 1999 Präsident des US-Amerikanischen Schachverbands, misstrauisch. Fischers Team hatte Schultz als Beobachter geschickt, um beim Röntgentest als Beobachter dabei zu sein. Die Notizen, die er damals gemacht hat, hat er immer noch, darunter eine Skizze des Objekts mit der Schleife, das er beim ersten Röntgentest gesehen hat.
|
 Don Schultz, ehemaliger Präsident des USCF war zu dem Zeitpunkt in Reykjavik und machte die Notiz, die links zu sehen ist. Die Notiz ist schwer eindeutig zu entziffern, aber scheint Folgendes zu sagen: Don Schultz, ehemaliger Präsident des USCF war zu dem Zeitpunkt in Reykjavik und machte die Notiz, die links zu sehen ist. Die Notiz ist schwer eindeutig zu entziffern, aber scheint Folgendes zu sagen:
"Freitag, 25. Aug 3:10: Nach der Hängepartie erhielt ich einen Anruf von Gudmundur Thrarin(sson) ICF Präs., der mich bat, in den Saal zu kommen, um die Ergebnisse zu prüfen, eine große Gruppe von Leuten war da. Mir wurde gesagt, dass Röntgentest ??? in Sesseln gezeigt hat. Andere Test wurden geprüft und waren." |
In der Öffentlichkeit machte er sich damals über die Unterstellungen lustig. Aber später räumte er Zweifel ein: “Nicht alles wurde umfassend erklärt.” Was ihn stutzig werden ließ, waren die Unterschiede zwischen den beiden Röntgenaufnahmen. Er war dabei, als die zweite Reihe der Röntgentests entwickelt wurde und sah, dass das Objekt, das wie eine Schleife aussah, die, wie er es nennt, "Anomalie", verschwunden war.
Ich habe lange darüber nachgedacht. Die einzige plausible Erklärung—und die klingt wirklich radikal und ich wollte sie damals nicht erwähnen, weil ich dachte, dass niemand mir glauben würde—ist die, dass eine kleine Möglichkeit besteht, dass irgendein durchgeknallter russischer Agent den Plan hatte, die USA in Verlegenheit zu bringen, indem er irgendetwas in den Sessel schmuggelte, um sich anschließend zu beschweren und es finden zu lassen. Und ihre Sicherheitskräfte haben herausgefunden, was er gemacht hat, und das für eine durchgeknallte Idee gehalten und irgendwie haben sie es wieder herausbekommen."
Nach der 18. Partie führte Fischer immer noch mit drei Punkten Vorsprung. Allmählich wurde es für Titelverteidiger Spassky wirklich eng.

Vorherige Artikel
Vor 45 Jahren – Bobby Fischer in Island (1)
In der letzen Juniwoche 1972 war die Schachwelt im Aufruhr. Der Weltmeisterschaftskampf zwischen Titelverteidiger Boris Spassky und Herausforderer Bobby Fischer sollte am 1. Juli in Reykjavik beginnen. Aber von Fischer war in der isländischen Hauptstadt nichts zu sehen. Die Eröffnungsfeier fand ohne ihn statt und die 1. Partie, die am 2. Juli gespielt werden sollte, wurde verschoben. Doch in den frühen Morgenstunden des 4. Juli traf Fischer schließlich in Reykjavik ein. Frederic Friedel berichtet.
Vor 45 Jahren – Bobby Fischer in Island (2)
Das legendäre "Match des Jahrhunderts" zwischen Boris Spassky und Bobby Fischer wurde in der Laugardalshöllin in Reykjavik gespielt. Dies ist Islands größte Sportarena, 5.500 Zuschauer haben hier Platz. Auch Konzerte finden hier statt - Led Zeppelin, Leonard Cohen und David Bowie haben hier schon gespielt. 45 Jahre nach dem Spassky-Fischer Spektakel besuchte Frederic Friedel die Laugardalshöllin und hat ein paar Schätze entdeckt.
Vor 45 Jahren - Bobby Fischer in Island (3)
Am 11. Juli 1972 begann das legendäre "Match des Jahrhunderts" zwischen Boris Spassky und Bobby Fischer endlich. Doch Fischer kam zu spät zur ersten Partie, der Straßenverkehr hatte ihn aufgehalten. Fischer hatte in der ersten Partie Schwarz und spielte zur allgemeinen Überraschung nicht wie meist Grünfeld oder Königsindisch, sondern Nimzo-Indisch. Die Partie verlief in ruhigen Bahnen und die meisten Experten rechneten mit einem Remis. Doch dann, im 29. Zug, nahm Fischer einen vergifteten Bauern. "Ein Zug und wir machen in der ganzen Welt Schlagzeilen!", kommentierte einer der Organisatoren glücklich.
Vor 45 Jahren – Bobby Fischer in Island (4)
Bobby Fischer, Herausforderer und Favorit im WM-Kampf gegen Boris Spassky in Reykjavik 1972, verlor die erste Wettkampfpartie auf dramatische Weise. Fischer erklärte, ihn hätten die Kameras gestört. Zur zweiten Partie trat der Amerikaner aus Protest nicht an und verlor kampflos. Damit lag er im Wettkampf 0-2 zurück. Fischer hatte schon einen Rückflug nach New York gebucht, aber spielte die dritte Partie dann doch – in einem Raum hinter der Bühne!
Vor 45 Jahren - Bobby Fischer in Island (5)
Nach drei Partien stand es im Match des Jahrhunderts 2:1 für den amtierenden Weltmeister. In Partie vier spielte Spassky eine gut vorbereitete Variante des Sizilianers und erhielt starken Angriff. Fischer verteidigte sich zäh und die Partie endete mit Remis. Dann folgte eine Schlüsselpartie, über die GM Robert Byrne, US-Meister 1972 und Korrespondent der New York Times und Chess Life, berichtet hat. In Reykjavik verfolgte Schachenthusiast Lawrence Stevens aus Kalifornien die Partien besonders aufmerksam: er schrieb per Hand auf, wie viel Bedenkzeit die Spieler für jeden Zug verbraucht hatten.
Vor 45 Jahren - Bobby Fischer in Island (6)
Im sechsten Teil unserer Serie schauen wir uns an, was beim Wettkampf des Jahrhunderts Fischer gegen Spassky 1972 in Reykjavik hinter den Kulissen geschah. Spassky wurde von seinen Sekundanten umsorgt und von den sowjetischen Autoritäten unter Druck gesetzt. Geholfen hat es ihm nicht. Ein schwerer Schlag war Spasskys Niederlage in der sechsten Partie. Fischer spielte zum ersten Mal in seinem Leben Damengambit mit Weiß, Spassky konnte oder wollte sich nicht an seine Vorbereitung erinnern und Fischer gewann eine Glanzpartie.
Vor 45 Jahren - Bobby Fischer in Island (7)
Boris Spassky startete mit einer 2-0 Führung in den "Wettkampf des Jahrhunderts" gegen Bobby Fischer in Reykjavik 1972. Aber dann schlug Fischer zurück: aus den nächsten acht Partien holte er 6,5 Punkte und führte so nach zehn Partien mit 6,5-3,5. Die Partien 8, 9 und 10 hatten viele dramatische Momente.
Vor 45 Jahren - Bobby Fischer in Island (8)
Nach zehn Partien stand es im Weltmeisterschaftskampf 1972 in Reykjavik 6,5-3,5 für den Herausforderer Bobby Fischer. Der Wettkampf schien praktisch schon entschieden, denn Titelverteidiger Boris Spassky hatte aus den letzten acht Partien nur 1,5 Punkte geholt. Doch in der elften Partie schlug Spassky zurück und fügte Fischer in der Najdorf-Variante eine vernichtende Niederlage zu.
Vor 45 Jahren - Bobby Fischer in Island (9)
Die 13. Partie des Wettkampfs zwischen Bobby Fischer und Boris Spassky in Reykjavik 1972 war ein packender Kampf. Fischer verzichtete auf seinen geliebten Sizilianer und griff zur Aljechin-Verteidigung. Eine unangenehme Überraschung für Spassky und der Auftakt einer dramatischen Partie mit entscheidender Bedeutung für den Wettkampf.
Vor 45 Jahren - Bobby Fischer in Island (10)
Die zweite Hälfte des Weltmeisterschaftskampfs zwischen Bobby Fischer und Boris Spassky in Reykjavik 1972 verlief ausgeglichen. In etlichen Partien hatte Spassky sogar gute Chancen, aber es gelang ihm nicht, eine Partie zu gewinnen. Das Ende des Wettkampfs rückte unaufhaltsam näher und Fischer verteidigte seinen 3-Punkte-Vorsprung.